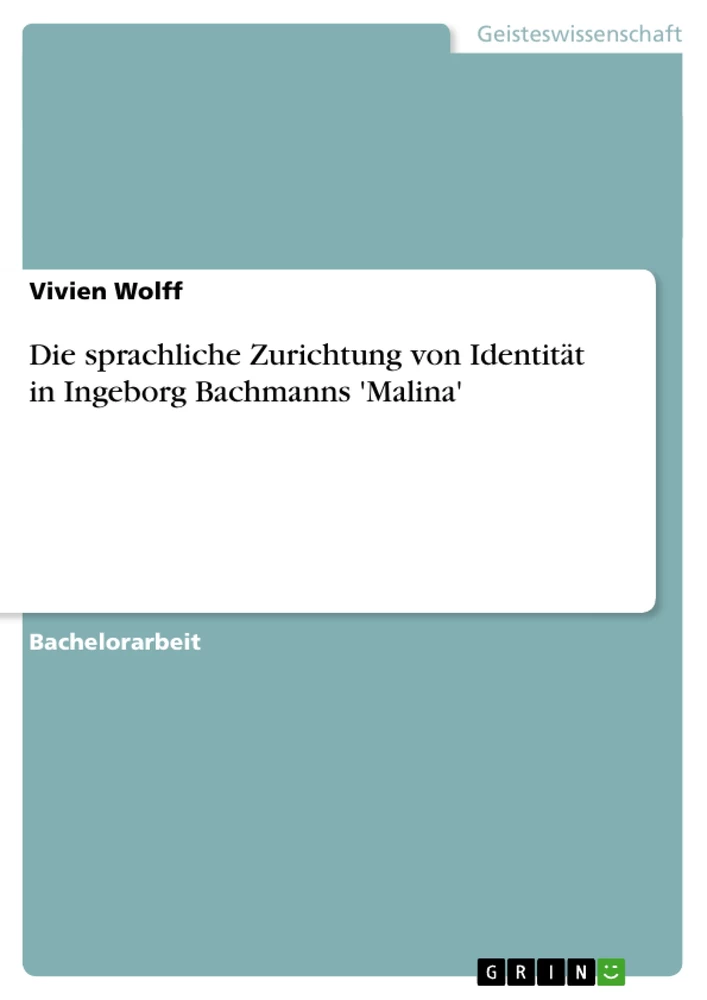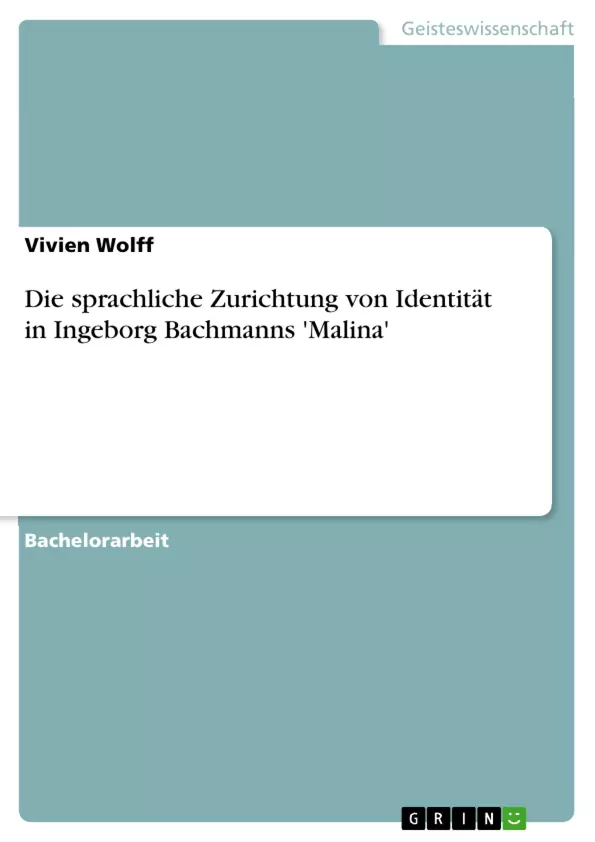Bereits die erste Lektüre von Ingeborg Bachmanns Malina lässt den Leser die
Komplexität des Romans erahnen und zwingt ihn unweigerlich in die Position des
eigenständigen Interpreten. Je nach Rezeptionserfahrung und den aus dem Text
gewonnenen Erkenntnissen werden unterschiedliche Schwerpunkte und Zugangsweisen
zu einem Deutungsversuch gewählt. So lassen sich im Rahmen der Malina-Forschung
zahlreiche Herangehensweisen – unter anderem sprachphilosophische, psychoanalytische,
strukturalistische oder feministische – ausmachen. Der Hinweis auf die Vielschichtigkeit
von Malina soll das Unterfangen, einen weiteren Interpretationsansatz zu finden,
keinesfalls für sinnlos erklären, sondern lediglich darauf aufmerksam machen, dass eine
Auslegung eben nur eine unter vielen möglichen ist. Da sich Ingeborg Bachmanns Roman
nicht einfach als Geschichte einer äußeren Handlung lesen lässt, ist der Ausgangspunkt
einer jeden Interpretation in der eigensten Erfahrung im Umgang mit dem Text zu suchen:
„Man muß überhaupt ein Buch auf verschiedene Arten lesen können und es heute anders lesen als
morgen.“
Bei der Lektüre von Malina fallen als erstes die Erzählschwierigkeiten ins Auge. Mit eben
diesen wird die Arbeit sich zunächst beschäftigen und verdeutlichen, dass sie die
unausweichliche Folge der Verkettung von Identitäts- und Sprachproblematik darstellen.
Der Versuch die tiefgreifende Identitätsbeschädigung in Malina erzählerisch zu
rekonstruieren und den Prozess einer Identitätsfindung zu vermitteln, muss zwangsweise
an die Grenzen der Möglichkeiten des Erzählens stoßen, handelt es sich doch um den
Versuch „einer Artikulation von 'Unerzählbarem'“. Inwieweit es Ingeborg Bachmann mit
ihrem Roman letztlich aber doch gelingt, diese Grenze zu überschreiten und zu erzählen,
was nicht erzählbar ist, soll im Rahmen einer Strukturanalyse beleuchtet werden.[...]
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Sprache und Identität
- 1 Gesellschaft und Sprache
- 2 Die Rolle der Sprache bei der Bildung von Identität
- 3 Die Zuschreibung der Identität
- 4 Identitätsbehauptungen
- 5 Fazit
- III Die (Un-)Möglichkeit des Erzählens: Eine Analyse der Erzählstruktur des Romans Malina
- 1 Die Personen
- 1.1 Ivan
- 1.2 Malina
- 1.3 Ich
- 2 Einheit von Zeit und Ort
- 2.1 Die Zeit
- 2.2 Der Ort
- 3 Die Montage
- 3.1 Die Telefongespräche
- 3.2 Die Briefe
- 3.3 Das Interview
- 3.4 Die Träume
- 3.5 Die Malina-Dialoge
- 3.6 Die Bezüge auf Literatur und Musik
- IV Die sprachliche Zurichtung von Identität in Malina
- 1 Glücklich mit Ivan: Die Dokumentation eines zerstörten Ich
- 1.1 Liebesutopie oder Der Versuch eines Identitäsentwurfs
- 1.2 Die Sprachspiele zwischen Ich und Ivan
- 2 Der dritte Mann: Die Rekonstruktion der Identitätsdeformation
- 2.1 Die Sprache der Träume
- 2.2 Der sprachsymbolische Aufbau der Welt im Ich
- 3 Von letzten Dingen: Die Transformation als letzte Behauptung
- 3.1 Die Dialoge zwischen Ich und Malina
- 3.2 Das Verschwinden in der Wand oder Die Unhintergehbarkeit der symbolischen Ordnung
- V Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Konstruktion von Identität in Ingeborg Bachmanns Roman Malina. Sie analysiert die Erzählstruktur des Romans im Hinblick auf die Identitätsproblematik der Protagonistin und beleuchtet den untrennbaren Zusammenhang von Sprache und Identität. Die Arbeit verwendet soziologische Identitätstheorien, insbesondere den Symbolischen Interaktionismus, um die im Roman dargestellten Prozesse zu interpretieren.
- Die Darstellung der Identitätsproblematik der Ich-Erzählerin.
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und der Konstruktion von Identität.
- Analyse der Erzählstruktur und der Montage verschiedener Textformen.
- Die Rolle von Träumen und Sprachspielen in der Identitätsfindung.
- Die Grenzen des Erzählens im Umgang mit unerzählbarer Erfahrung.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II (Sprache und Identität): Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen für die Interpretation von Malina, indem es den Symbolischen Interaktionismus und die Identitätszuschreibung nach Goffman vorstellt.
Kapitel III (Die (Un-)Möglichkeit des Erzählens): Hier wird die Erzählstruktur von Malina analysiert, insbesondere die Montage verschiedener Textformen wie Telefongespräche, Briefe und Träume, im Hinblick auf die inhaltliche Uneinheitlichkeit und die Darstellung des Ichs und der Zeitlichkeit.
Kapitel IV (Die sprachliche Zurichtung von Identität in Malina): Dieses Kapitel interpretiert die drei Hauptteile des Romans. Der erste Teil („Glücklich mit Ivan“) wird als Dokumentation eines zerstörten Ichs gelesen und die Liebesbeziehung als utopische Projektion untersucht. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Rekonstruktion der Identitätsdeformation anhand der Analyse der Träume. Der dritte Teil („Von letzten Dingen“) behandelt die Dialoge zwischen Ich und Malina und die Frage nach der Unhintergehbarkeit der symbolischen Ordnung.
Schlüsselwörter
Identität, Sprache, Ingeborg Bachmann, Malina, Erzählstruktur, Symbolischer Interaktionismus, Identitätszuschreibung, Träume, Sprachspiele, Montage, Identitätsdeformation.
- Quote paper
- B.A. Vivien Wolff (Author), 2010, Die sprachliche Zurichtung von Identität in Ingeborg Bachmanns 'Malina', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183212