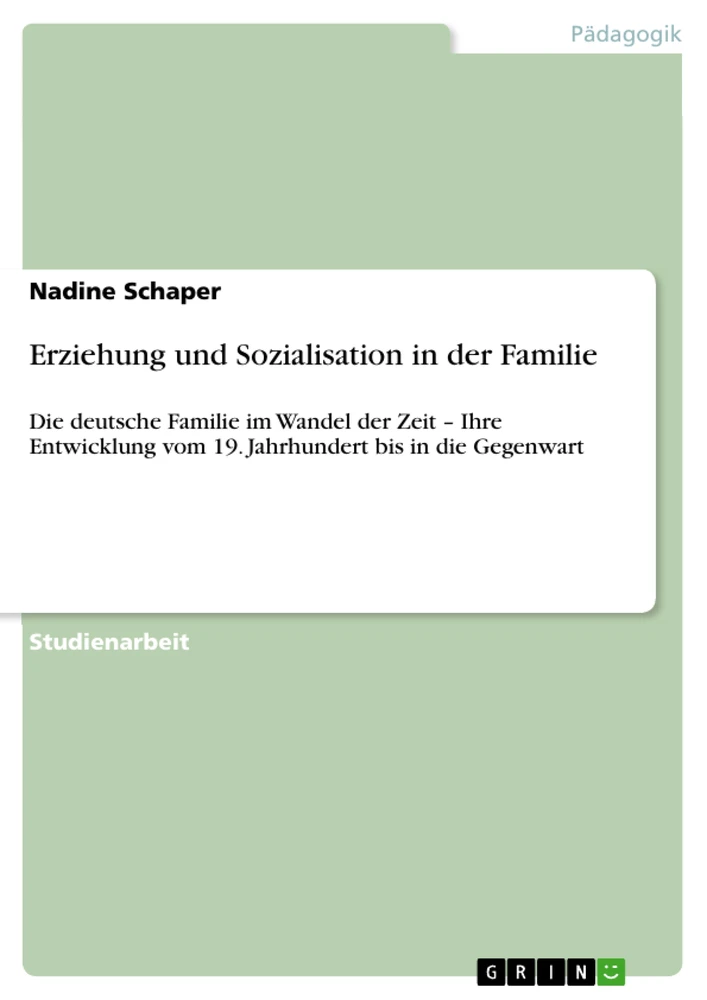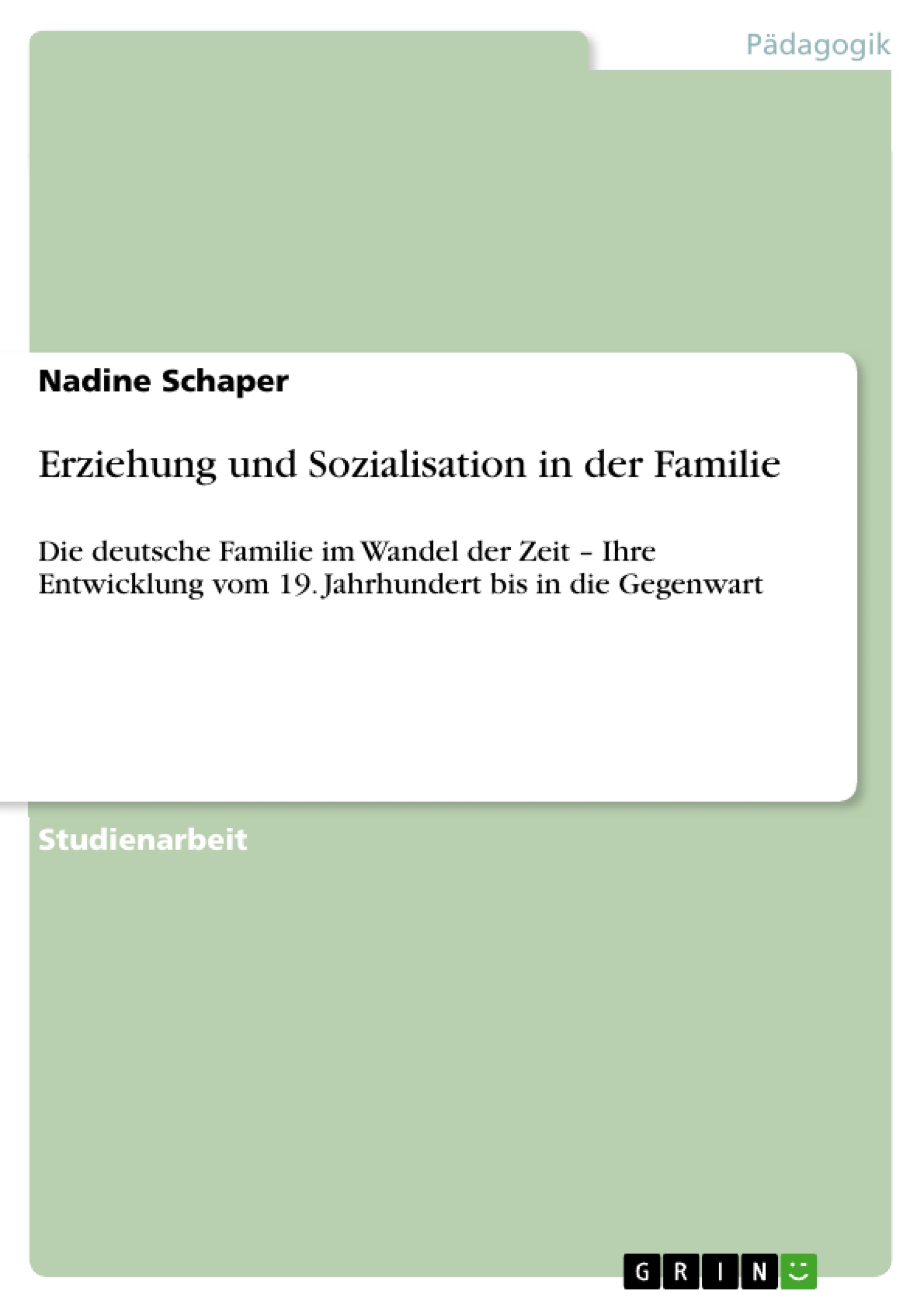1. Einleitung
Die Gesellschaft - und damit auch die Familie - ist von je her starken Veränderungsprozessen unterworfen, in die wir von Geburt an eingebunden sind und die wir als selbstverständlich wahrnehmen. In der familiensoziologischen Forschung, welche sich erst Ende des 19.
Jahrhunderts als Einzeldisziplin herausbildete, (vgl. Nave Herz 2004 S. 10) besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass wir uns seit Jahren im Wandel befinden. Während das klassische Familienmodell (Ehepaar männlich/weiblich mit Kind/ern) mehr und mehr an Bedeutung
verliert, gehören alternative Lebensformen und Scheidungen mittlerweile zu unserem Alltag. Wurde die Familie früher als selbstverständliche, gesellschaftliche Konvention verstanden, ist sie
heute zu etwas geworden, das – abhängig von den jeweiligen Lebensbedingungen – künstlich geschaffen werden muss. (vgl. Hans – Böckler – Stiftung 2001 S. 7ff)
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Familiensoziologie in Deutschland ab dem 19.
Jahrhundert bis heute. Welche Entwicklungsphasen hat die Institution Familie durchgemacht, um zu dem zu werden, was sie heute ist? Welche positiven und welche negativen Aspekte sind diesbezüglich zu beobachten? Um den Rahmen ein wenig einzugrenzen, wird speziell auf die unterschiedlichen Formen und Funktionen von Familie im Wandel der Zeit eingegangen. Nachdem einige Begrifflichkeiten definiert wurden, werden abschließend verschiedene Erklärungsansätze für
diese sozialen Veränderungen vorgestellt. Ziel der Arbeit ist es, einen groben historischen Einblick ins Thema Familiensoziologie zu geben, die einzelnen Epochen zu charakterisieren und dadurch
ein besseres Verständnis für aktuelle Entwicklungstendenzen zu erlangen. Schließlich soll eine kritische Auseinandersetzung mit den gewonnenen Erkenntnissen erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung mit Begriffsklärung
- Die Grundtypen der Familie im 19. Jahrhundert
- Die bürgerliche Familie
- Die Arbeiterfamilie
- Die ländliche Familie
- Familie in der Weimarer Republik
- Familie in der Zeit des Nationalsozialismus
- Familie nach 1945
- Die postmoderne Familie
- Familie aus funktionalistischer und differenzierungstheoretischer Sicht
- Die Reproduktionsfunktion
- Die Sozialisationsfunktion
- Die Platzierungsfunktion
- Die Freizeitfunktion
- Die Spannungsausgleichsfunktion
- Erklärungsansätze für den sozialen Wandel
- Die Individualisierungstheorie
- Die Theorie der sozialen Differenzierung
- Zusammenfassung/Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Familie in Deutschland vom 19. Jahrhundert bis heute. Sie beleuchtet die verschiedenen Phasen, die die Institution Familie durchlaufen hat, und analysiert sowohl positive als auch negative Aspekte dieser Entwicklung. Der Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichen Formen und Funktionen von Familie im Wandel der Zeit. Das Ziel der Arbeit ist es, einen historischen Einblick in die Familiensoziologie zu geben, die einzelnen Epochen zu charakterisieren und damit ein besseres Verständnis für aktuelle Entwicklungstendenzen zu erlangen. Abschließend erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den gewonnenen Erkenntnissen.
- Der Wandel der Familienformen im 19. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Familie in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
- Die Familie im Nachkriegsdeutschland und in der postmodernen Gesellschaft
- Die verschiedenen Funktionen der Familie aus funktionalistischer und differenzierungstheoretischer Sicht
- Erklärungsansätze für den sozialen Wandel der Familie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung mit Begriffsklärung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Familienwandel dar und definiert grundlegende Begriffe wie „Familie“ und „Sozialisation“. Es wird die Bedeutung der Familie als gesellschaftliche Institution und der Wandel vom traditionellen Familienmodell hin zu neuen Lebensformen hervorgehoben.
2. Die Grundtypen der Familie im 19. Jahrhundert
Dieses Kapitel beleuchtet die beiden wichtigsten Familientypen im 19. Jahrhundert: die bürgerliche und die Arbeiterfamilie. Es werden die jeweiligen Lebensbedingungen, die gesellschaftliche Rolle und die Familienstrukturen der beiden Familienformen analysiert.
3. Familie in der Weimarer Republik
Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung der Familie in der Weimarer Republik und die Einflüsse, die die politische und wirtschaftliche Situation auf die Familienstrukturen hatten.
4. Familie in der Zeit des Nationalsozialismus
Hier wird die Familienpolitik des Nationalsozialismus und deren Auswirkungen auf die Familienstrukturen und Lebensverhältnisse der Menschen in Deutschland analysiert.
5. Familie nach 1945
Dieses Kapitel behandelt die Veränderungen der Familie nach dem Zweiten Weltkrieg und die Anpassung an die neue gesellschaftliche Situation. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Nachkriegszeit im Hinblick auf die Familie beleuchtet.
6. Die postmoderne Familie
Dieser Abschnitt betrachtet die verschiedenen Familienformen und Lebensentwürfe in der postmodernen Gesellschaft und die Gründe für den Wandel der Familie.
7. Familie aus funktionalistischer und differenzierungstheoretischer Sicht
Hier werden die verschiedenen Funktionen der Familie aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven beleuchtet. Es wird die Bedeutung der Familie für die Reproduktion, Sozialisation, Platzierungs- und Freizeitfunktion sowie die Spannungsausgleichsfunktion dargestellt.
8. Erklärungsansätze für den sozialen Wandel
Dieses Kapitel stellt verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung des sozialen Wandels der Familie vor, wie z.B. die Individualisierungstheorie und die Theorie der sozialen Differenzierung.
Schlüsselwörter
Familiensoziologie, Familienwandel, bürgerliche Familie, Arbeiterfamilie, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, postmoderne Familie, Funktionen der Familie, Reproduktionsfunktion, Sozialisationsfunktion, Individualisierung, soziale Differenzierung.
- Quote paper
- Nadine Schaper (Author), 2011, Erziehung und Sozialisation in der Familie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183241