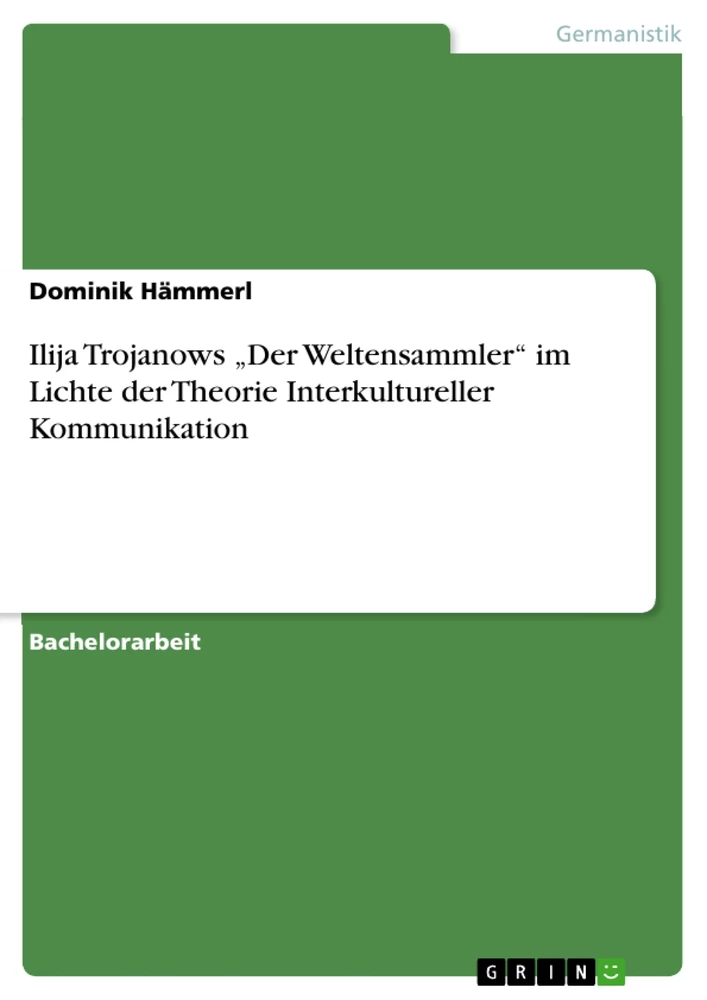Viele Rezensionen zu Ilija Trojanows „Der Weltensammler“ stellen einen Aspekt ihrer Betrachtung besonders heraus: die biographische Nähe des Autors zu seiner Romanfigur Richard F. Burton. Dass Trojanow in Bulgarien geboren, in Südafrika aufgewachsen sei, aber auf Deutsch schreibe, beschwört einen Vergleich mit dem britischen Soldaten aus dem 19.Jahrhundert ja fast schon herauf – im Hinblick zumindest auf die Interkulturalität ihrer Lebenssituationen. Trojanow heute und Burton damals müssen sich aber freilich mit anderen Gegebenheiten auseinandersetzen: um interkulturelle Kommunikation zu erleben, muss man in diesen Tagen nicht mehr weit reisen – moderne Medien und wachsende Mobilität haben die Welt zusammenrücken lassen. Auch wenn der Text seine Handlung im 19. Jahrhundert ansiedelt, so sind die darin verhandelten interkulturellen Problemfelder doch hochaktuell. Diese Arbeit fragt sich daher, wie sich Theorien interkultureller Kommunikation in Trojanows Roman spiegeln. Es wird daher zunächst der Frage nach einem interkulturell anschlussfähigen Kulturbegriff auf den Grund zu gehen sein, bevor die Arbeit eine Diskussion grundlegender Begriffe und Definitionen Interkultureller Kommunikation leistet, die im Hinblick auf die Betrachtung von „Der Weltensammler“ unerlässlich sind. Auf diese Begriffe baut die Arbeit in der Folge auf. Sie setzt sich mit ihnen in einer Textanalyse von Trojanows „Weltensammler“ auseinander und beleuchtet und hinterfragt die Thesen Interkultureller Kommunikation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ilija Trojanows „Der Weltensammler“ im Lichte der Theorie Interkultureller Kommunikation
- Begriffsdiskussion: Kultur - Interkulturalität
- Kultur
- Interkulturalität
- Interkulturelle Kommunikation
- Begriffsklärung
- Interkulturelle Kompetenz und Interkulturelles Lernen
- Ilija Trojanow: „Der Weltensammler“ - ein interkultureller Roman
- Interkulturelle Kommunikation in Trojanows „Weltensammler“
- Der Elitemigrant: Richard F. Burton
- Ignoranz der kulturellen Andersheit
- Der Sonderweg Burtons: Entwicklung interkultureller Kompetenz
- Schwierigkeiten in der interkulturellen Kommunikation
- Richard Burton zwischen Assimilation und „Verwandlung“
- Begriffsdiskussion: Kultur - Interkulturalität
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ilija Trojanows Roman „Der Weltensammler“ unter dem Blickwinkel der Theorie interkultureller Kommunikation. Ziel ist es, die im Roman dargestellten interkulturellen Herausforderungen und Kommunikationsmuster im Kontext theoretischer Konzepte zu analysieren.
- Der Kulturbegriff und seine verschiedenen Ausprägungen
- Theorien und Konzepte interkultureller Kommunikation
- Die Darstellung interkultureller Begegnungen und Konflikte in Trojanows Roman
- Die Entwicklung interkultureller Kompetenz bei der Romanfigur Richard F. Burton
- Der Vergleich zwischen der Lebenssituation des Autors und seiner Romanfigur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Spiegelung interkultureller Kommunikationstheorien in Trojanows Roman vor und skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit. Das Kapitel „Ilija Trojanows „Der Weltensammler“ im Lichte der Theorie Interkultureller Kommunikation“ beginnt mit einer Diskussion des Kulturbegriffs und der Theorie interkultureller Kommunikation. Es werden verschiedene Definitionen von Kultur beleuchtet, um eine Grundlage für die Analyse des Romans zu schaffen. Anschließend wird der Roman selbst im Kontext interkultureller Kommunikation eingeordnet, mit einem Fokus auf die Darstellung der Figur Richard F. Burton und seinen interkulturellen Erfahrungen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Kulturbegriff, Ilija Trojanow, Der Weltensammler, Richard F. Burton, Interkulturelle Kompetenz, Assimilation, Kulturanthropologie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ilija Trojanows Roman „Der Weltensammler“?
Der Roman erzählt das Leben des britischen Forschers Richard Francis Burton, der im 19. Jahrhundert verschiedene Kulturen (Indien, Arabien, Afrika) bereiste und tief in diese eintauchte.
Welche Verbindung besteht zwischen dem Autor und der Hauptfigur?
Beide teilen eine interkulturelle Biografie: Trojanow wurde in Bulgarien geboren und wuchs in Südafrika auf, was Parallelen zu Burtons Grenzgängertum zwischen den Kulturen schafft.
Was ist „Interkulturelle Kompetenz“ im Kontext des Romans?
Es beschreibt Burtons Fähigkeit, Sprachen, Bräuche und Denkweisen fremder Kulturen so perfekt zu übernehmen, dass er zwischen Assimilation und dem Verlust der eigenen Identität schwankt.
Welche interkulturellen Problemfelder werden thematisiert?
Der Roman beleuchtet die Ignoranz gegenüber kultureller Andersheit, die Schwierigkeiten der Kommunikation und die Machtstrukturen des Kolonialismus.
Warum ist der Roman für die Theorie der interkulturellen Kommunikation relevant?
Er dient als literarisches Fallbeispiel für Konzepte wie Kulturanthropologie, Fremdwahrnehmung und die Dynamik von Begegnungen zwischen Orient und Okzident.
- Quote paper
- Dominik Hämmerl (Author), 2009, Ilija Trojanows „Der Weltensammler“ im Lichte der Theorie Interkultureller Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183374