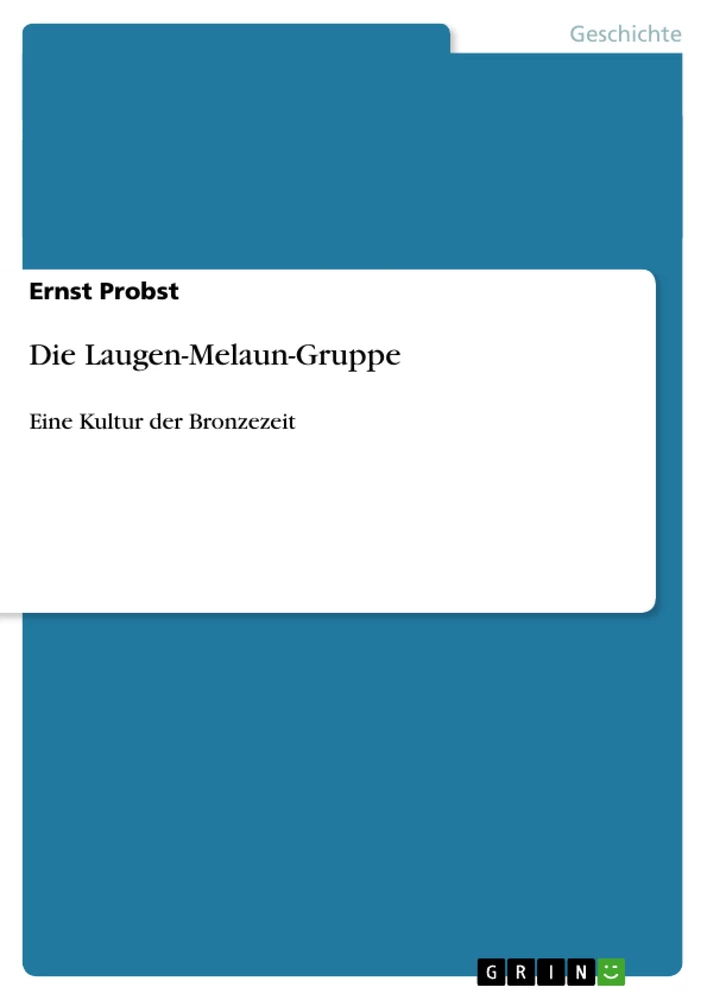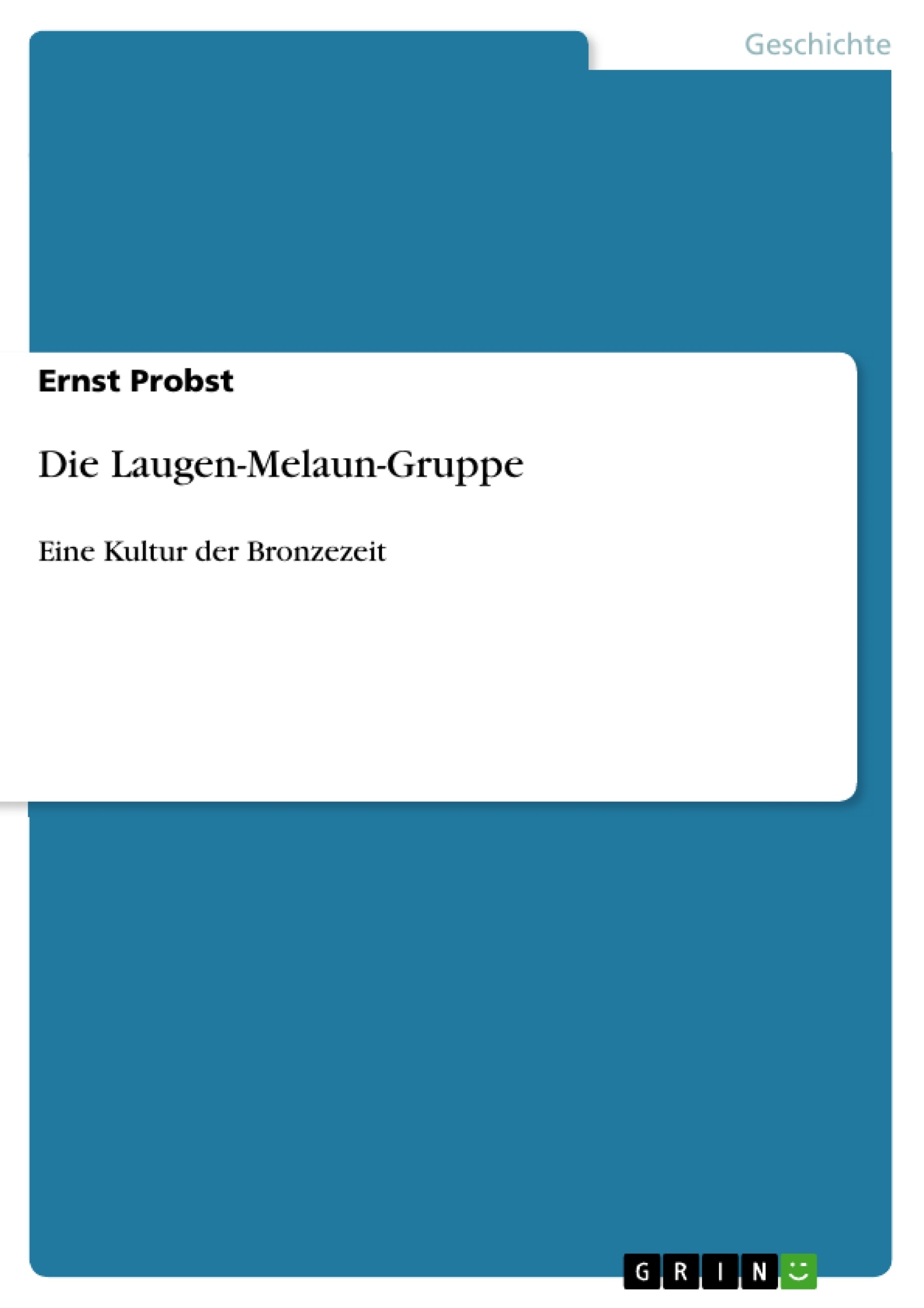Eine Kulturstufe, die von etwa 1200 bis 400 v. Chr. in Südtirol, im Trentino (Italien), Nordtirol, Osttirol, Kärnten, Vorarlberg (Österreich) sowie in Graubünden, Sankt Gallen (Schweiz) und im Fürstentum Liechtenstein existierte, steht im Mittelpunkt des Taschenbuches »Die Laugen-Melaun-Gruppe«. In ihrer Blütezeit reichte sie vom Bodensee im Norden bis zum Gardasee im Süden. Geschildert werden die Siedlungen, Kleidung, der Schmuck, die Keramik, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, Jagdtiere, der Handel, die Kunstwerke und Religion der damaligen Ackerbauern und Viehzüchter. Verfasser dieses Taschenbuches ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht. Das Taschenbuch »Die Laugen-Melaun-Gruppe« ist Dr. Elisabeth Ruttkay (1926–2009), Professor Dr. Walter Leitner und Dr. Johannes-Wolfgang Neugebauer (1949–2002) gewidmet, die den Autor mit Rat und Tat bei seinen Werken über die Steinzeit und Bronzezeit unterstützt haben.
Inhaltsverzeichnis
- So genannte »reiche Frau« der Urnenfelder-Kultur
- Eine Kultur der Bronzezeit
- Widmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung einer "reichen Frau" der Urnenfelderkultur, basierend auf einer historischen Trachtenrekonstruktion von Julius Naue. Die Zielsetzung ist die Präsentation dieser Rekonstruktion und die Einordnung in den Kontext der Bronzezeitkultur.
- Die Urnenfelderkultur
- Die Rekonstruktion von Julius Naue
- Die Bedeutung der Kleidung im Kontext der Bronzezeit
- Die Laugen-Melaun-Gruppe
- Wissenschaftliche Unterstützung und Danksagung
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel "So genannte »reiche Frau« der Urnenfelder-Kultur" beschreibt die Darstellung einer Frau der Urnenfelderkultur anhand einer Trachtenrekonstruktion. Das Kapitel "Eine Kultur der Bronzezeit" bietet einen kurzen Überblick über die Bronzezeitkultur, in welche die Frau und ihre Kleidung eingeordnet werden. Das Kapitel "Widmung" beinhaltet Danksagungen an Personen, die den Autor bei vorherigen Arbeiten unterstützt haben.
Schlüsselwörter
Urnenfelderkultur, Bronzezeit, Trachtenrekonstruktion, Julius Naue, Laugen-Melaun-Gruppe, wissenschaftliche Graphik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Laugen-Melaun-Gruppe?
Es handelt sich um eine prähistorische Kulturstufe, die von etwa 1200 bis 400 v. Chr. im Alpenraum (Südtirol, Trentino, Nordtirol, Graubünden) existierte.
Welche Regionen umfasste diese Kultur in ihrer Blütezeit?
Die Kultur reichte vom Bodensee im Norden bis zum Gardasee im Süden und umfasste Teile der heutigen Länder Italien, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.
Wer ist die „reiche Frau“ der Urnenfelderkultur?
Es ist eine bekannte Trachtenrekonstruktion von Julius Naue, die den Schmuck und die Kleidung einer hochgestellten Frau aus dieser Epoche veranschaulicht.
Welche Aspekte des täglichen Lebens beschreibt das Buch?
Das Werk schildert Siedlungen, Kleidung, Keramik, Werkzeuge, Waffen sowie die Landwirtschaft und Religion der damaligen Ackerbauern und Viehzüchter.
Wer ist der Autor Ernst Probst?
Ernst Probst ist ein bekannter Wissenschaftsautor, der sich auf Werke über die Urzeit, Steinzeit und Bronzezeit in Deutschland spezialisiert hat.
- Citar trabajo
- Ernst Probst (Autor), 2011, Die Laugen-Melaun-Gruppe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183406