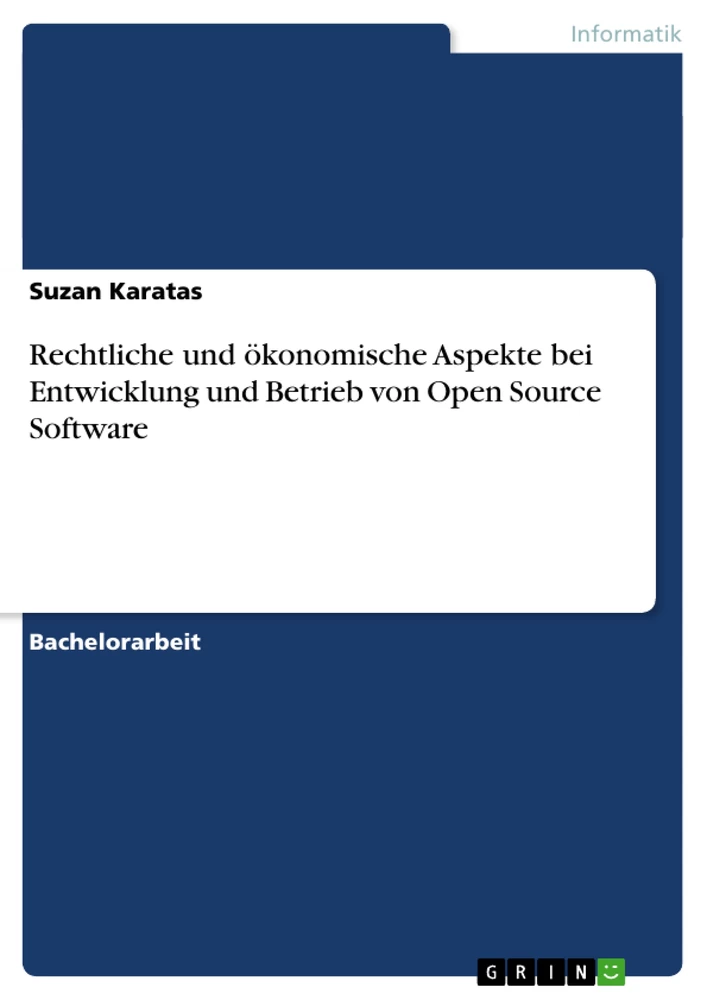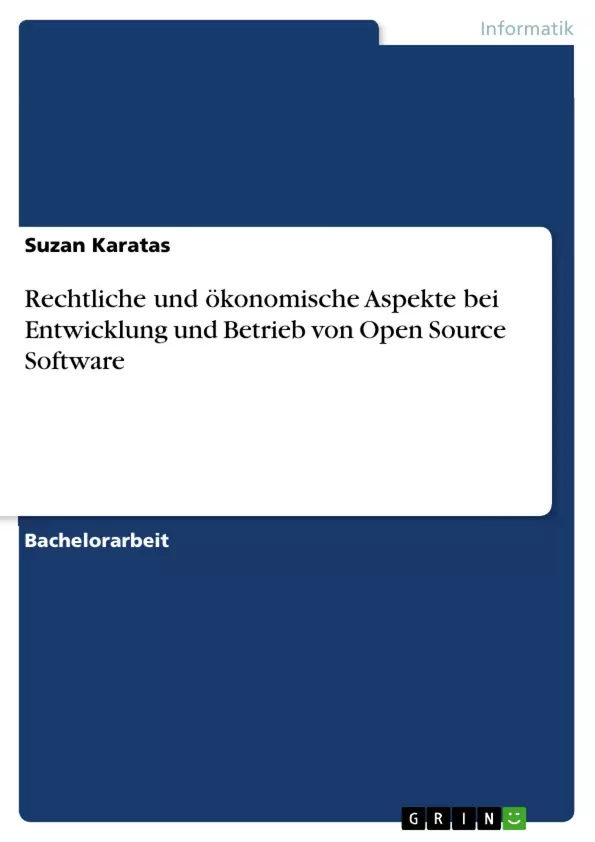Das Thema Open Source Software ist längst nicht mehr nur für talentierte Hobbyprogrammierer ein interessantes Gebiet.
Namhafte Unternehmen wie IBM, Sun Microsystems oder auch HP beteiligen sich aktiv an der Entwicklung von quelloffener Software, indem sie ihre Produktpallette um quelloffene Software erweitern oder Quellcodes ihrer Programme freigeben.
Im Gegenzug setzen immer mehr private und öffentliche Organisationen, wie Google, BMW, das Auswärtige Amt oder die bayrische Landeshauptstadt München Open Source Software und Betriebssysteme in unterschiedlichsten Bereichen ihrer Geschäftsprozesse ein.
In jüngster Zeit zeigen jedoch auch Schlagzeilen wie „Westerwelle beerdigt Linux“ oder „München zeigt Geduld und erhöht Budget für LiMux“, dass der Einsatz von quelloffenen Technologien auch problematisch sein kann. Aufgrund dieser Aktualität befasst sich die vorliegende Arbeit mit den rechtlichen und ökonomischen Aspekten bei der Entwicklung und dem Betrieb von Open Source Software.
Im Blickpunkt des zweiten Kapitels stehen rechtliche Grundlagen der Open Source Software. Nach einer definitorischen Abgrenzung werden charakteristische Merkmale von Open Source Software und wesentliche Unterschiede zu anderen Softwarearten aufgezeigt. Darüber hinaus werden die gängigsten Lizenzmodelle und die damit einhergehenden rechtlichen Verpflichtungen der Anwender und Entwickler von Open Source Software erläutert.
Anhand des ökonomischen Theorems der Nutzenmaximierung von Individuen wird im dritten Kapitel erläutert, welche Motivation Entwickler haben, Zeit, Arbeit und Geld in die Entwicklung von Programmen zu investieren, deren Quellcode für jedermann frei zugänglich ist. Dabei findet eine getrennte Betrachtung der Anreizfaktoren der privaten Entwicklergemeinde und der Unternehmen statt.
Das vierte Kapitel stellt auf Grundlage der Wertschöpfung von Software Geschäftsmodelle von Unternehmen dar, die mittels komplementärer Angebote zu Open Source Software, Profite erwirtschaften.
Anhand von drei Einrichtungen aus dem öffentlichen Sektor gibt das fünfte Kapitel einen praxisbezogenen Einblick über die Vorteile und Risiken bei einem Einsatz von Open Source Technologien. Hierzu werden die individuellen Hintergründe der Migrationsentscheidungen und Erfahrungen des Umstellungsprozesses der Stadtverwaltungen Schwäbisch Hall, der Landeshauptstadt München und des Auswärtigen Amts beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rechtliche Grundlagen der Open Source-Software
- 2.1 Definition Open Source
- 2.1.1 Abgrenzung zu proprietärer Software
- 2.1.2 Abgrenzung zu weiteren Softwarearten
- 2.2 Open Source Lizenzmodelle
- 2.2.1 Lizenzen mit strenger Copyleft-Klausel
- 2.2.2 Lizenzen mit beschränkter Copyleft-Klausel
- 2.2.3 Lizenzen ohne Copyleft-Klausel
- 2.2.4 Weitere Lizenzierungen
- 2.3 Rechtsverbindlichkeit von Open Source Lizenzen
- 2.3.1 Urheberrechte
- 2.3.2 Anspruchsgrundlage bei Lizenzverletzung
- 3 Die Entwicklergemeinde der Open Source Software
- 3.1 Die Historie des Open Source Modells
- 3.2 Motivation der privaten Entwickler
- 3.3 Anreizfaktoren der Unternehmen
- 4 Geschäftsmodelle auf der Basis von Open Source Software
- 4.1 Die Wertschöpfung von Software
- 4.2 Komplementäre Dienstleistungen
- 4.3 Komplementäre Produkte
- 4.3.1 Komplementäre Software
- 4.3.2 Komplementäre Hardware
- 4.3.3 Sonstige Geschäftsmodelle
- 4.4 Bewertung der Geschäftsmodelle
- 5 Einsatz von Open Source Software im öffentlichen Sektor
- 5.1 Schwäbisch Hall
- 5.1.1 Hintergrund und Motivation der Einsatzentscheidung
- 5.1.2 Ablauf der Migration und aktueller Stand
- 5.2 München
- 5.2.1 Hintergrund und Motivation der Einsatzentscheidung
- 5.2.2 Ablauf der Migration und aktueller Stand
- 5.3 Das Auswärtige Amt
- 5.3.1 Hintergrund und Motivation der Einsatzentscheidung
- 5.3.2 Ablauf der Migration und aktueller Stand
- 5.4 Chancen und Risiken aus der Praxiserfahrung
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die rechtlichen und ökonomischen Aspekte der Entwicklung und des Betriebs von Open-Source-Software. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Motivation der beteiligten Akteure und der verschiedenen Geschäftsmodelle im Kontext von Open-Source-Software zu entwickeln.
- Rechtliche Grundlagen von Open-Source-Lizenzen
- Motivation von Entwicklern und Unternehmen
- Geschäftsmodelle basierend auf Open-Source-Software
- Der Einsatz von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor
- Chancen und Risiken von Open-Source-Software
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und skizziert die zentralen Fragestellungen und den Aufbau der Arbeit. Sie liefert einen Überblick über die Bedeutung von Open-Source-Software und die Notwendigkeit einer Untersuchung der rechtlichen und ökonomischen Aspekte.
2 Rechtliche Grundlagen der Open Source-Software: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen von Open-Source-Software. Es definiert Open-Source-Software und grenzt sie von proprietärer Software und anderen Softwarearten ab. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung verschiedener Open-Source-Lizenzmodelle, einschließlich Lizenzen mit strenger und beschränkter Copyleft-Klausel sowie Lizenzen ohne Copyleft-Klausel. Die Rechtsverbindlichkeit der Lizenzen und die Aspekte des Urheberrechts sowie die Anspruchsgrundlage bei Lizenzverletzungen werden ausführlich behandelt. Die verschiedenen Lizenztypen werden im Detail analysiert und verglichen, um ihre Auswirkungen auf die Nutzung und Verbreitung von Open-Source-Software zu verdeutlichen.
3 Die Entwicklergemeinde der Open Source Software: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklergemeinde der Open-Source-Software. Es untersucht die historische Entwicklung des Open-Source-Modells, die Motivation privater Entwickler und die Anreizfaktoren für Unternehmen, sich an der Entwicklung zu beteiligen. Die verschiedenen Motivationen und die Dynamik innerhalb der Community werden analysiert, um die Nachhaltigkeit und den Erfolg des Open-Source-Modells zu erklären. Der Beitrag von Einzelpersonen und Unternehmen wird beleuchtet und deren unterschiedliche Zielsetzungen werden miteinander verglichen.
4 Geschäftsmodelle auf der Basis von Open Source Software: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Geschäftsmodelle, die auf Open-Source-Software basieren. Es untersucht die Wertschöpfung von Software im Open-Source-Kontext und beleuchtet komplementäre Dienstleistungen und Produkte. Es werden verschiedene Geschäftsmodelle im Detail betrachtet, wie zum Beispiel der Vertrieb von ergänzender Software oder Hardware, und diese werden hinsichtlich ihrer Effektivität und Nachhaltigkeit bewertet. Die Kapitel erläutert die Möglichkeiten der Monetarisierung trotz der offenen Verfügbarkeit des Quellcodes.
5 Einsatz von Open Source Software im öffentlichen Sektor: Dieses Kapitel untersucht den Einsatz von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor anhand von Fallbeispielen aus Schwäbisch Hall, München und dem Auswärtigen Amt. Für jeden Fall wird der Hintergrund, die Motivation der Einsatzentscheidung, der Ablauf der Migration und der aktuelle Stand detailliert dargestellt. Die Kapitel analysiert die Chancen und Risiken, die sich aus der Praxiserfahrung ergeben, und zieht Schlussfolgerungen für zukünftige Projekte.
Schlüsselwörter
Open Source Software, Open Source Lizenzen, Copyleft, Urheberrecht, Geschäftsmodelle, Entwicklergemeinde, öffentlicher Sektor, Migration, Rechtliche Aspekte, Ökonomische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rechtliche und Ökonomische Aspekte von Open-Source-Software
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die rechtlichen und ökonomischen Aspekte der Entwicklung und des Betriebs von Open-Source-Software. Sie umfasst eine detaillierte Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Motivation der beteiligten Akteure (Entwickler und Unternehmen) und verschiedener Geschäftsmodelle im Kontext von Open-Source-Software. Die Arbeit beinhaltet Fallstudien zum Einsatz von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Definition von Open-Source-Software, grenzt sie von proprietärer Software ab und erklärt verschiedene Open-Source-Lizenzmodelle (mit und ohne Copyleft-Klausel). Sie untersucht die Rechtsverbindlichkeit dieser Lizenzen, Urheberrechte und Anspruchsgrundlagen bei Lizenzverletzungen.
Welche Aspekte der Entwicklergemeinde werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des Open-Source-Modells, die Motivation privater Entwickler und die Anreizfaktoren für Unternehmen. Sie untersucht die Dynamik innerhalb der Open-Source-Community und den Beitrag von Einzelpersonen und Unternehmen.
Welche Geschäftsmodelle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Geschäftsmodelle, die auf Open-Source-Software basieren, inklusive der Wertschöpfung von Software, komplementärer Dienstleistungen und Produkte (Software, Hardware). Die Effektivität und Nachhaltigkeit dieser Modelle werden bewertet.
Wie wird der Einsatz im öffentlichen Sektor dargestellt?
Die Arbeit präsentiert Fallstudien zum Einsatz von Open-Source-Software im öffentlichen Sektor, unter anderem in Schwäbisch Hall, München und dem Auswärtigen Amt. Für jeden Fall werden Hintergrund, Motivation, Migrationsablauf und aktueller Stand detailliert beschrieben. Chancen und Risiken aus der Praxiserfahrung werden analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Rechtliche Grundlagen der Open Source-Software, Die Entwicklergemeinde der Open Source Software, Geschäftsmodelle auf der Basis von Open Source Software, Einsatz von Open Source Software im öffentlichen Sektor und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Zusammenfassung im Text.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Open Source Software, Open Source Lizenzen, Copyleft, Urheberrecht, Geschäftsmodelle, Entwicklergemeinde, öffentlicher Sektor, Migration, Rechtliche Aspekte, Ökonomische Aspekte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Motivation der beteiligten Akteure und der verschiedenen Geschäftsmodelle im Kontext von Open-Source-Software zu entwickeln.
- Quote paper
- Suzan Karatas (Author), 2011, Rechtliche und ökonomische Aspekte bei Entwicklung und Betrieb von Open Source Software, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183418