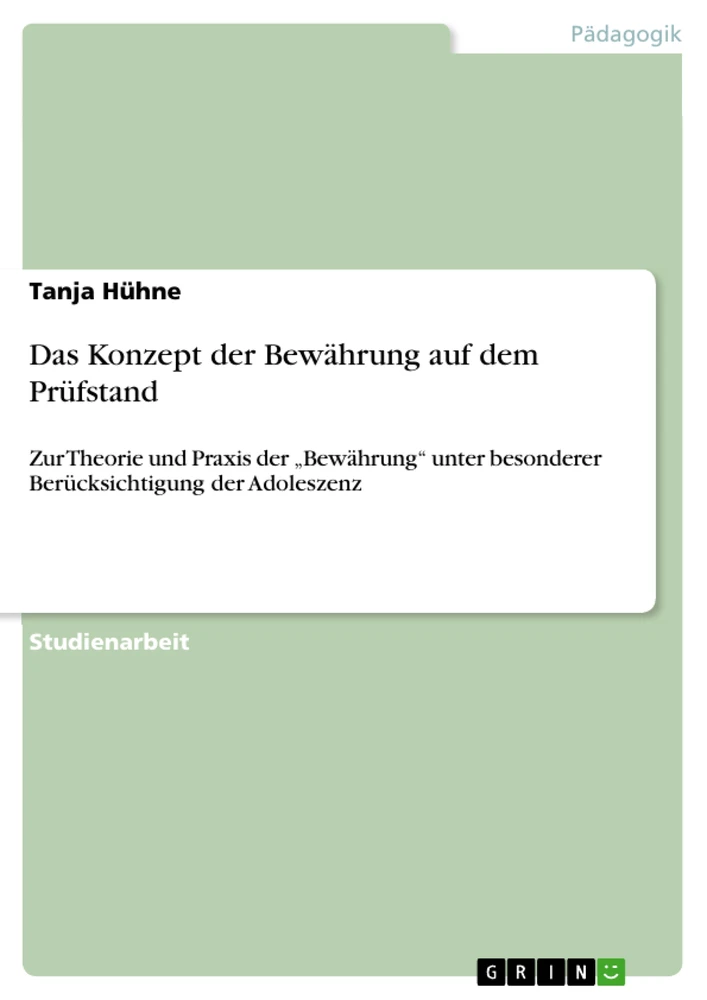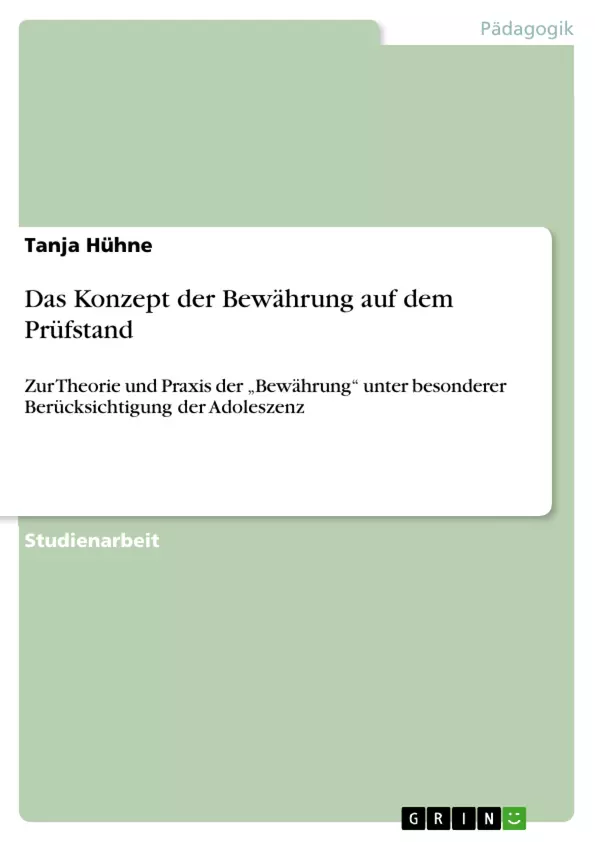Jugendliche sind faul, hängen in Gruppen herum und tun einfach nichts, außer vielleicht an Bushaltestellen vorbeigehende Passanten anzupöbeln. Sie sind unfreundlich zu Erwachsenen, beleidigen ihre Eltern, sprechen in ihrer eigenen Gossensprache, verbringen die Zeit, in der sie mal nicht Passanten anpöbeln entweder in ihren Zimmern und spielen Ballerspiele oder aber sie besaufen sich auf „Flatrate-Partys“. In der Schule machen sie Lehrern die Hölle heiß, mobben die Kleinen und verschmutzen den Schulhof. Sie haben zu nichts Bock und tragen dies auch gerne mit ihrer Null-Bock-Mine zur Schau. Schaut man sich ihre Kleidung an, so sind die weiblichen Jugendlichen so aufgetakelt, dass man gerade nicht weiß, ob sie auf dem Weg zu einer Modenschau oder auf dem Weg zur Schule sind. Die männlichen Jugendlichen hingegen sehen so aus, als seien sie gerade erst von der Couch aufgestanden mit ihren weiten Jogginghosen, bei denen der Schritt schon in den Kniekehlen hängt und ihre Unterwäsche deutlich zu sehen ist.
Das ist das Bild der Jugend im 21. Jahrhundert. Jedenfalls wenn man die großen und auch kleinen Schlagzeilen der Medien liest und denen unkritisch Glauben schenkt. Jugendliche jedoch sind zu Höchstleistungen fähig, man muss ihnen nur einen für sie geeigneten Rahmen schaffen, in dem sie diese Leistungen vollbringen können. Das ist die These von Hartmut von Hentig, die er in seinem Buch „Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein“ (2005), aufstellt und praxisorientiert ausarbeitet, so dass ein Konzept entsteht: das Bewährungskonzept. Dieses Konzept wird in seiner Grundidee in dieser Arbeit vorgestellt werden. Da Hartmut von Hentig sein Konzept für Jugendliche, die sich in der Adoleszenz befinden, entwickelte, sollen sie in einem zweiten Schritt besonders in den Blick genommen werden. Das Bewährungskonzept hat durch die Montessori- Oberschule in Potsdam in Form eines Landbauprojektes bereits praktische Umsetzung erfahren - diese wird hier im dritten Teil dieser Arbeit zur Geltung kommen. In einem abschließenden Fazit werden diese drei Elemente - die Theorie des Bewährungskonzeptes, dessen erste praktische Umsetzung als auch die Jugendlichen, um die sich das Konzept dreht - miteinander verbunden, sodass eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema möglich werden kann. Die Frage, die hinter dieser kritischen Auseinandersetzung steht, lautet: Ist das Bewährungskonzept wirklich für Jugendliche, die sich mitten in der Adoleszenz befinden, geeignet?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Bewährung- Hentigs Manifest
- Die Besonderheiten des Jugendalters
- Die Adoleszenz
- Die Frühadoleszenz
- Die mittlere bzw. eigentliche Adoleszenz
- Was es bedeutet, in der heutigen Zeit Jugendlicher zu sein
- Die Umsetzung des „Bewährungskonzeptes“ am Beispiel der Montessori- Oberschule in Potsdam
- Die Montessori- Oberschule Potsdam
- Das Projekt „Schlänitzsee“
- Vorstellung des Projektes
- Pädagogisches Konzept zum Projekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das „Bewährungskonzept“ von Hartmut von Hentig und setzt sich kritisch mit seiner Anwendbarkeit in der heutigen Jugendphase auseinander. Die Analyse fokussiert auf die Besonderheiten des Jugendalters, insbesondere der Adoleszenz, und untersucht, inwieweit das Konzept den Bedürfnissen junger Menschen gerecht wird. Die Arbeit zeigt zudem die praktische Umsetzung des Bewährungskonzeptes anhand des Projektes „Schlänitzsee“ an der Montessori-Oberschule in Potsdam.
- Das Konzept der „Bewährung“ von Hartmut von Hentig
- Die Bedeutung der Adoleszenz für die Entwicklung von Jugendlichen
- Die Notwendigkeit von Erfahrungen und Selbstwirksamkeit für Jugendliche
- Die Rolle von Bildung und Schule im Bewährungsprozess
- Die praktische Umsetzung des Bewährungskonzeptes im Projekt „Schlänitzsee“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Diskurs über Jugendliche und stellt das Konzept der Bewährung von Hartmut von Hentig als Gegenentwurf dar. Kapitel 2 erläutert das Bewährungskonzept und geht auf die Kritik von Hentig an der traditionellen Schule ein. Kapitel 3 untersucht die Besonderheiten des Jugendalters und beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen in der Adoleszenz. Kapitel 4 zeigt die praktische Umsetzung des Bewährungskonzeptes im Projekt „Schlänitzsee“ an der Montessori-Oberschule in Potsdam.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Bewährungskonzept von Hartmut von Hentig, der Adoleszenz, Jugendphase, Selbstwirksamkeit, Bildung, Schule, Montessori-Pädagogik, Projekt „Schlänitzsee“ und praktische Umsetzung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Bewährungskonzept" von Hartmut von Hentig?
Das Konzept basiert auf der These, dass Jugendliche die Erfahrung brauchen, nützlich zu sein. Durch praktische Herausforderungen außerhalb des klassischen Klassenzimmers sollen sie Selbstwirksamkeit erfahren.
Was ist das Projekt "Schlänitzsee"?
Es ist ein Landbauprojekt der Montessori-Oberschule Potsdam, bei dem Schüler durch praktische Arbeit auf einem Bauernhof das Bewährungskonzept in der Realität umsetzen.
Warum ist die Adoleszenz für dieses Konzept so wichtig?
In der Adoleszenz suchen Jugendliche nach Identität und Autonomie. Das Konzept bietet einen Rahmen, in dem sie über sich hinauswachsen und Verantwortung übernehmen können.
Wie kritisiert Hentig die traditionelle Schule?
Er kritisiert, dass Schulen Jugendliche oft in eine passive Rolle drängen und ihnen zu wenig Raum für echte, lebensnahe Erfahrungen und Bewährungsproben bieten.
Ist das Konzept heute noch relevant?
Ja, die Arbeit diskutiert, ob dieses Konzept gerade in einer Zeit, in der Jugendliche oft als "lustlos" stigmatisiert werden, einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten kann.
- Citation du texte
- Tanja Hühne (Auteur), 2010, Das Konzept der Bewährung auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183425