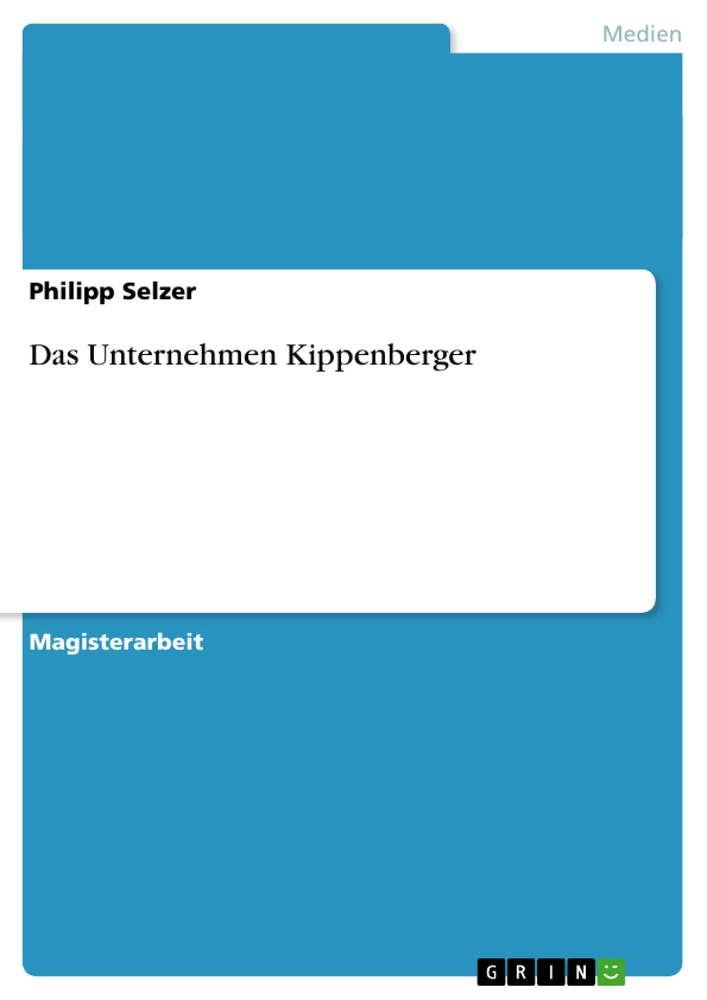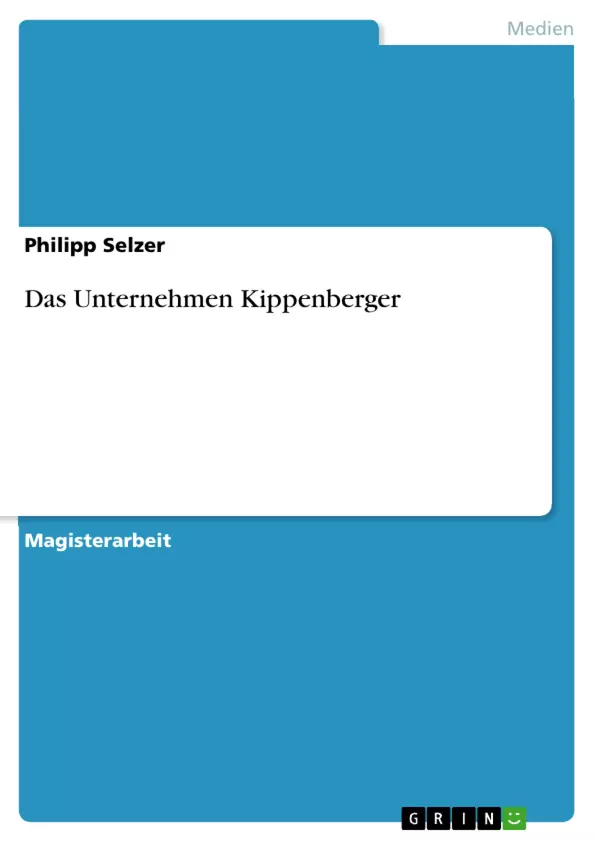Martin Kippenberger (1953-1997) ist einer der wichtigsten und zugleich umstrittensten Künstler der deutschen Nachkriegskunst. Als singulär kann man seine Vita beschreiben, die im Ruhrgebiet 1953 begann und tragisch mit seinem Tod 1997 in einem Krankenhaus in Wien endete. In einer Schaffensperiode von nur zwanzig Jahren entwickelte Kippenberger ein gigantisches und hochreferentielles Werk für eine jedes Maß übersteigende Zahl von Ausstellungen. Weitestgehend abgelehnt von deutschen Kunstinstitutionen ehrten ihn die Teilnahme an der Documenta X, 1997 in Kassel und die Repräsentation Deutschlands 2003 auf der Biennale in Venedig zusammen mit Candida Höfer erst posthum. Mit diesem Jahr setzte eine Rezeption ein, die sich weitestgehend unbeeindruckt von Kippenbergers Umstrittenheit seinem Werk nähert und ihn heute als exemplarischen Wegbereiter identifiziert hat.
Aber warum Kippenberger heute? Was scheint heute so faszinierend an ihm, was vor rund 15 Jahren noch umstritten war? Kippenberger erscheint heute vielen als Modell, als utopische und exemplarisch realisierte Selbstbehauptung eines Künstlers, indem er weitestgehend als Autodidakt und durch die Kommunikation und Interaktion mit einer breiten Öffentlichkeit sein Werk und ein öffentliches Bild von sich entwickelte. Kippenberger hat wie kein anderer das Spiel mit der Ökonomie der Aufmerksamkeit beherrscht. Durch die Verschränkung mit einer großen Öffentlichkeit entstand ein Mythos, ein Gewebe aus Anekdoten, Erinnerungen, Meinungen und Parteien. Über Kippenberger zu schreiben, bedeutet folglich, sich auf Polaritäten und Verstrickungen einzulassen, mit ihnen umzugehen und bestenfalls die Art und Weise der Verstrickung der unterschiedlichen Ebenen zu beschreiben. Wie die Untersuchung dabei zeigen möchte, hat man es mit einem materiellen Werk und mit einer performativen und fiktionalen Figur „Kippenberger“ zu tun. Der Titel der Untersuchung bezieht sich nicht auf die Analyse von Kippenbergers Künstlerkarriere unter dem Fokus ökonomischer Faktoren, denn diese darf man primär als posthum bezeichnen. Das substantielle Geld wird heute auf dem Kunstmarkt vor allem mit Kippenbergers Malerei verdient. Das „Unternehmen Kippenberger“ bezeichnet Kippenbergers programmatischen Ansatz, sich durch den mit der Öffentlichkeit verschränkten Komplex des „Kippenbergers“ in Verbindung mit seinem Werk in die Kunstgeschichte einzuschreiben zu wollen und als Künstler damit Anerkennung zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- I.1 Literatur und Forschungsstand
- I.2 Kippenbergers besondere Problematik und ein theoretischer Versuch
- I.3 Kippenberger im Kontext - der Kunstbetrieb der achtziger Jahre und die Kunstmetropole Köln
- Die Metropole Köln
- II Kippenberger als... : Öffentlichkeitsstrategien
- II.1 Kippenberger: Der Impresario, der Organisator, der Auteur
- Kippenberger in Florenz
- Berlin: Kippenbergers Büro und das SO 36
- Kippenberger als „Homme de Lettre“ in Paris
- „Kippenberger raus aus Berlin“
- II.2 Der Verleger Kippenberger
- II.3 Der Kurator Kippenberger
- II.4 Die Sammler Kippenberger
- II.5 Das soziale Gefüge um Kippenberger
- III Produktionsstrategien
- III.1 Die wiederkehrenden Motive, der "Running Gag"
- III.2 Papier als Stil: Zeichnungen auf Hotelbriefpapier
- III.3 Inflationäre Produktion
- III.4 Die Organisation von Autorschaft und Assistenz
- III.5 Kippenberger in der Tradition der Kunstgeschichte
- IV Die Rezeption
- IV.1 Die Rezeption Kippenbergers: Die Jahre 1994, 1997 und 2006
- IV.2 Die Mythologisierung von Köln der achtziger und neunziger Jahre
- IV.3 Kippenberger exemplarisch
- V Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das „Unternehmen Kippenberger“, d.h. Martin Kippenbergers programmatischen Ansatz, sich durch die Verschränkung seines Werks mit der Öffentlichkeit in die Kunstgeschichte einzuschreiben. Sie analysiert seine Strategien der Selbstinszenierung und die vielschichtigen Aspekte seiner künstlerischen Produktion.
- Kippenbergers Öffentlichkeitsstrategien und Selbstinszenierung als Künstlerfigur
- Analyse seiner Produktionsmethoden und -strategien
- Kippenbergers Positionierung innerhalb der Kunstgeschichte und im Kontext des Kölner Kunstbetriebs der 80er Jahre
- Die Rezeption seines Werks und die Entstehung seines Mythos
- Kippenbergers vielfältige künstlerische Aktivitäten (Malerei, Zeichnung, Installation, Kurator, Verleger etc.)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Martin Kippenberger und seine Bedeutung für die deutsche Nachkriegskunst vor. Sie skizziert seinen Lebensweg und seine postume Anerkennung. Kapitel II analysiert Kippenbergers Öffentlichkeitsarbeit und seine strategische Nutzung verschiedener Rollen (Impresario, Kurator, Sammler etc.). Kapitel III untersucht seine Produktionsstrategien, seine wiederkehrenden Motive und die Organisation seiner Arbeit. Das Kapitel IV beleuchtet die Rezeption von Kippenbergers Werk.
Schlüsselwörter
Martin Kippenberger, Kunstgeschichte, Öffentlichkeitsarbeit, Selbstinszenierung, Produktionsstrategien, Kölner Kunstbetrieb, Rezeption, Mythos, Gesamtkunsturheber, Autodidakt.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Martin Kippenberger?
Kippenberger (1953–1997) war ein einflussreicher deutscher Künstler, bekannt für sein gigantisches Werk in Malerei, Installation und seine provokante Selbstdarstellung.
Was bedeutet der Titel „Unternehmen Kippenberger“?
Er bezeichnet Kippenbergers strategischen Ansatz, sich durch die gezielte Verschränkung seiner Person und seines Werks mit der Öffentlichkeit in die Kunstgeschichte einzuschreiben.
Welche Rollen nahm Kippenberger im Kunstbetrieb ein?
Er agierte nicht nur als Maler, sondern auch als Verleger, Kurator, Sammler, Organisator und „Impresario“ seiner eigenen Ausstellungen.
Warum war sein Werk zu Lebzeiten umstritten?
Kippenberger provozierte durch seine inflationäre Produktion, seinen Humor und die bewusste Missachtung traditioneller künstlerischer Autorschaft.
Was macht Kippenberger heute so faszinierend?
Er gilt heute als Modell für die „Selbstbehauptung“ eines Künstlers, der die Ökonomie der Aufmerksamkeit perfekt beherrschte und einen bleibenden Mythos schuf.
- Citar trabajo
- Philipp Selzer (Autor), 2008, Das Unternehmen Kippenberger, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183499