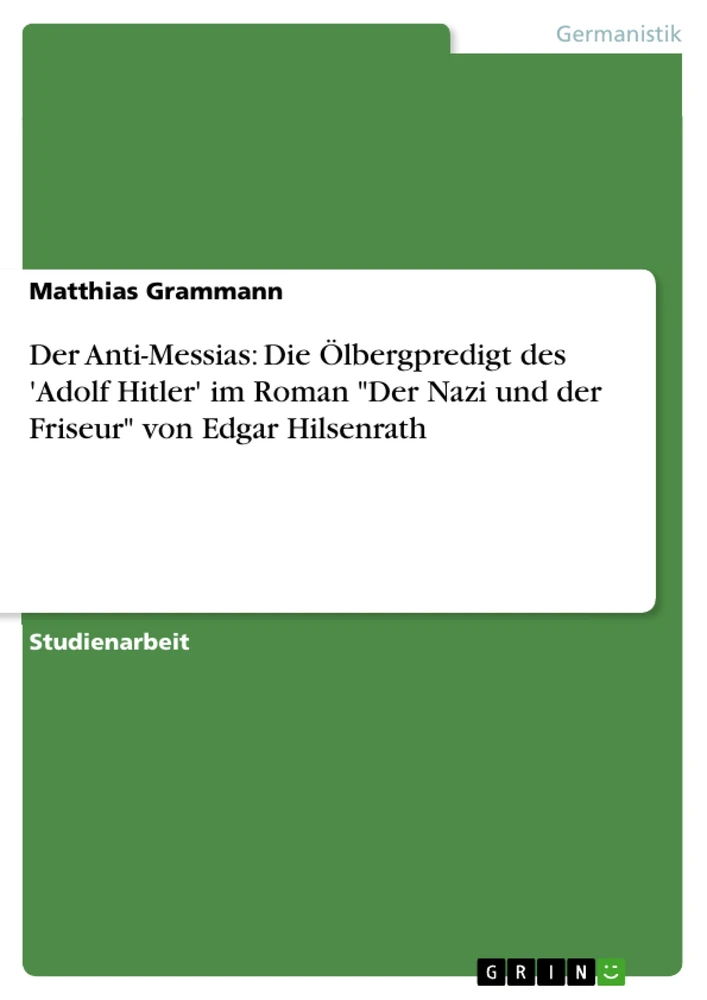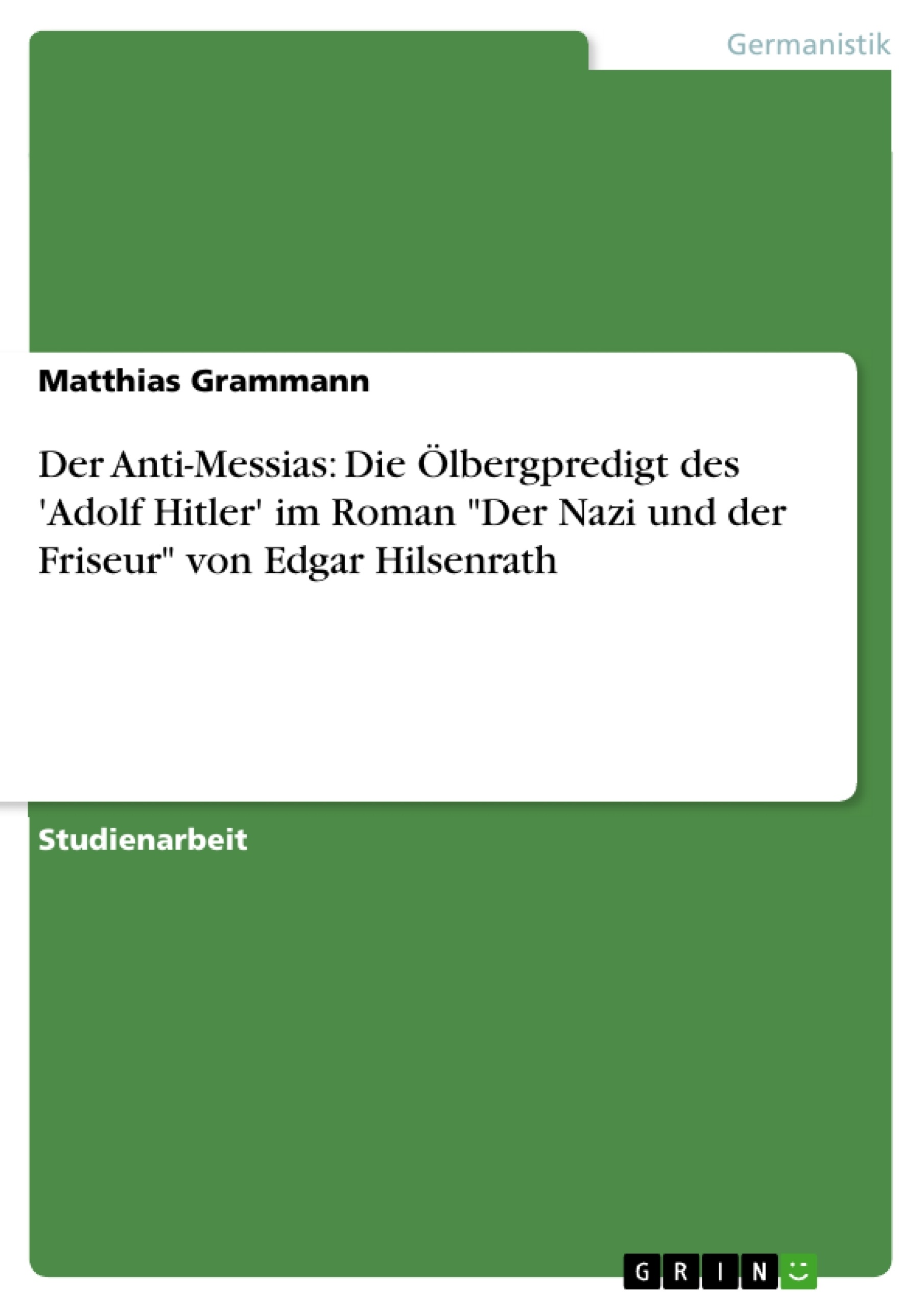Religiöse Begriffe und Bilder sind in der Propagandasprache des Nationalsozialismus
stark vertreten. Dabei griffen die Redner und Schreiber „weniger auf vergangene oder
zeitgenössische Denkansätze zurück, sondern fast nur auf deren Terminologie.“1 Durch
das Aufnehmen religiöser Anschauungen bekam der Nationalsozialismus eine
„geschichtliche Pseudorechtfertigung“2. Cornelia Berning schreibt: „In der Zeit, in der
Herrschaftsordnung und Glaubenssysteme von jahrhundertealter Tradition ihren Einfluss
auf den Menschen verloren hatten, in der Religion nicht mehr lebenschaffende
Wirklichkeit war, lag es nah, die Bereitschaft der Masse für neue innerweltliche Teilsysteme
politisch auszunutzen.“3
Auf diese Verwendung von religiöser Rhetorik untersucht Alexandra Heberger den
grotesk-satirischen Roman „Der Nazi und der Friseur“4 von Edgar Hilsenrath, der ihrer
Meinung nach diese Sprachelemente der Nazis aufgreift und parodiert.5 Diese satirische
Form der Sprachkritik findet auch Hans Otto Horch.6
In dieser Arbeit soll ebenfalls die religiöse Rhetorik des Romans untersucht werden.
Dabei wird der Frage nachgegangen, ob die diese im Roman neben der satirischen
Sprachkritik an Propagandaverfahren des Nationalsozialismus7 auch als literarisches
Verfahren zur Religionskritik zu lesen ist. Diese Untersuchung soll exemplarisch an einer
Szene des Romans, der Ölbergpredigt8, durchgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Religiöse Rhetorik im Nationalsozialismus
- 1.2. Groteske und satirische Sprache
- 1.3. Zielsetzung der Arbeit
- 2. Struktur und Aufbau der Szene
- 2.1. Strukturanalyse
- 2.2. Der Ölberg als Ort der Hitler'schen Bergpredigt
- 2.3. Die Figur, Adolf Hitler'
- 3. Analyse der Rede
- 3.1. Lukaslesung
- 3.2. Seligpreisungen
- 3.3. Antithesen
- 3.4. Die exponierte Seligpreisung
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die religiöse Rhetorik im Roman „Der Nazi und der Friseur“ von Edgar Hilsenrath, um herauszufinden, ob sie neben der satirischen Sprachkritik an Propagandaverfahren des Nationalsozialismus auch als literarisches Verfahren zur Religionskritik zu lesen ist. Die Untersuchung konzentriert sich dabei exemplarisch auf die Szene der „Ölbergpredigt“.
- Analyse der Struktur und des Aufbaus der „Ölbergpredigt“
- Untersuchung der Verwendung religiöser Sprachelemente und Bilder
- Beurteilung der satirischen Elemente der Rede
- Interpretation der „Ölbergpredigt“ als literarisches Verfahren zur Religionskritik
- Diskussion der Rolle der Figur Hitler im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Verwendung religiöser Begriffe und Bilder in der Propagandasprache des Nationalsozialismus und stellt den Zusammenhang zwischen Religion und politischer Ideologie dar. Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Struktur und dem Aufbau der „Ölbergpredigt“, wobei der Fokus auf dem Ort der Szene, dem Ölberg, und der Figur Hitlers liegt. Das dritte Kapitel analysiert die Rede Hitlers, indem es die Lukaslesung, die Seligpreisungen, die Antithesen und die exponierte Seligpreisung untersucht.
Schlüsselwörter
Religiöse Rhetorik, Nationalsozialismus, Propaganda, Groteske, Satire, „Der Nazi und der Friseur“, Edgar Hilsenrath, Ölbergpredigt, Hitler, Religionskritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Romans "Der Nazi und der Friseur"?
Der Roman von Edgar Hilsenrath thematisiert die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust durch eine grotesk-satirische Perspektive, wobei insbesondere die Sprache der Täter parodiert wird.
Was wird unter der "Ölbergpredigt" im Kontext dieser Arbeit verstanden?
Die Ölbergpredigt ist eine zentrale Szene im Roman, in der die Figur Adolf Hitler eine Rede hält. Die Arbeit untersucht diese Szene als Parodie auf biblische Texte und als Instrument der Religionskritik.
Wie nutzten die Nationalsozialisten religiöse Rhetorik?
Nationalsozialistische Redner griffen häufig auf religiöse Terminologie zurück, um ihrer Ideologie eine "pseudorechtfertigende" geschichtliche Tiefe zu verleihen und die Massen emotional anzusprechen.
Welche literarischen Mittel nutzt Edgar Hilsenrath in seinem Werk?
Hilsenrath verwendet vor allem die Groteske und die Satire, um die Absurdität und Grausamkeit der nationalsozialistischen Propaganda und Sprache zu entlarven.
Dient der Roman auch der allgemeinen Religionskritik?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Verwendung religiöser Bilder im Roman nicht nur die NS-Propaganda kritisiert, sondern auch als grundsätzliches literarisches Verfahren zur Religionskritik verstanden werden kann.
- Citation du texte
- Matthias Grammann (Auteur), 2008, Der Anti-Messias: Die Ölbergpredigt des 'Adolf Hitler' im Roman "Der Nazi und der Friseur" von Edgar Hilsenrath, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183501