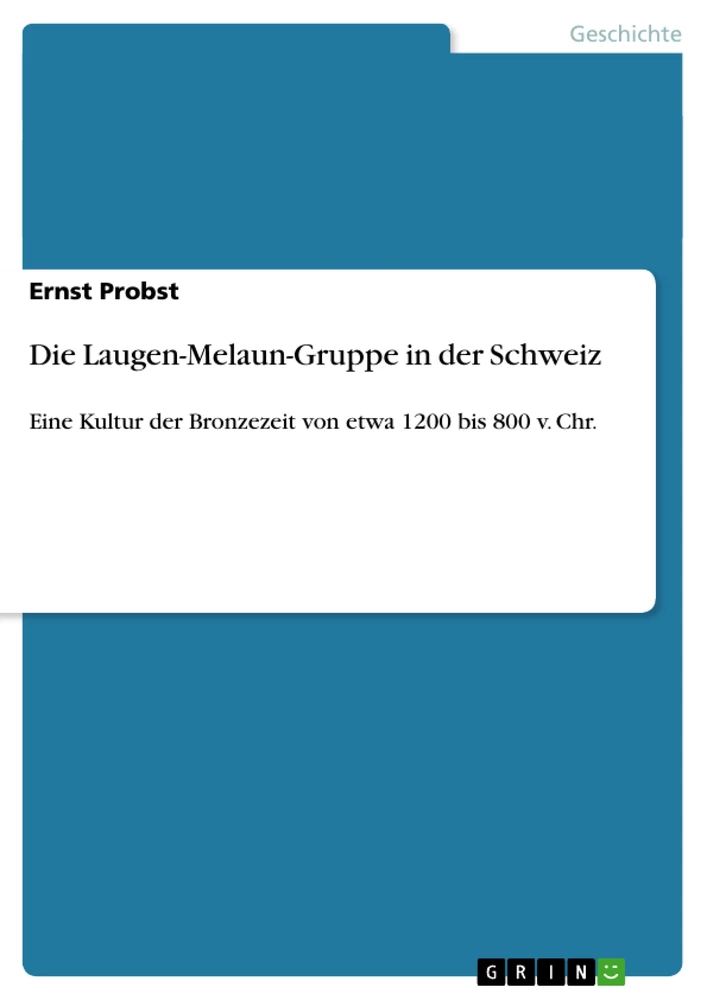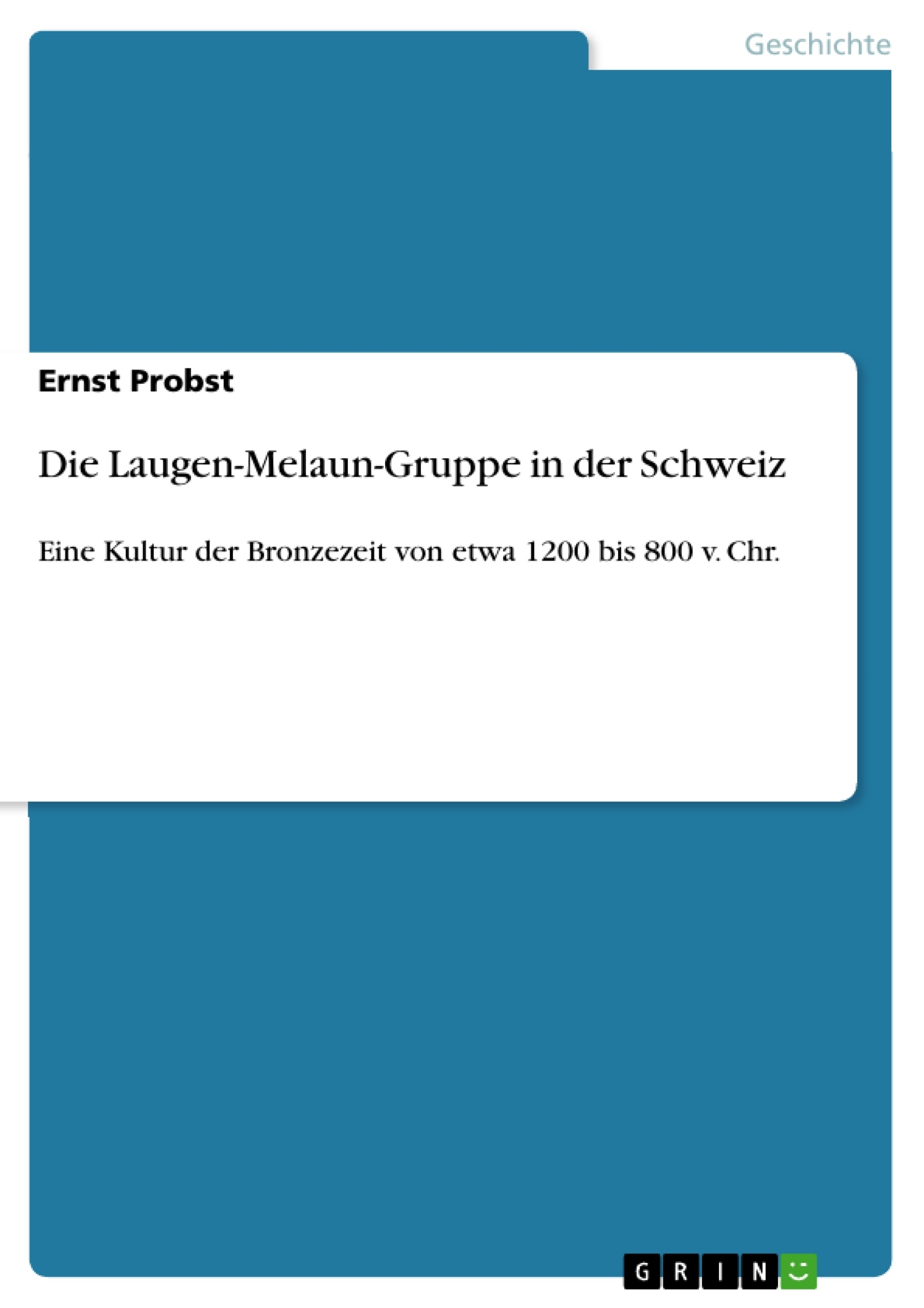Eine Kultur der Bronzezeit, die von etwa 1200 bis 800 v. Chr. gebietsweise in den Kantonen Graubünden und Sankt Gallen sowie in Liechtenstein existierte, steht im Mittelpunkt des Taschenbuches »Die Laugen-Melaun-Gruppe in der Schweiz«. Geschildert werden die Anatomie der damaligen Ackerbauern, Viehzüchter und Bronzegießer, ihre Siedlungen, Kleidung, ihr Schmuck, ihre Keramik, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, Jagdtiere, ihr Handel und ihre Religion. Verfasser dieses Taschenbuches ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht. Das Taschenbuch »Die Laugen-Melaun-Gruppe in der Schweiz« ist Dr. Gretel Gallay (heute Callesen), Dr. Albert Hafner und Dr. Jürg Rageth gewidmet, die den Autor mit Rat und Tat bei seinem Buch »Deutschland in der Bronzezeit« unterstützt haben.
Inhaltsverzeichnis
- So genannte »reiche Frau« der Urnenfelder-Kultur
- Eine Kultur der Bronzezeit von etwa 1200 bis 800 v. Chr.
- Widmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Vorschau bietet einen Überblick über das Buch, das sich mit der Laugen-Melaun-Gruppe in der Schweiz und einer "reichen Frau" der Urnenfelder-Kultur befasst. Das Buch beleuchtet Aspekte der Bronzezeit in der Schweiz und bietet eine historische Trachtenrekonstruktion.
- Die Laugen-Melaun-Gruppe und ihre kulturelle Bedeutung
- Die Urnenfelder-Kultur und ihre Bestattungsrituale
- Historische Trachtenrekonstruktion der Bronzezeit
- Die Rolle von Frauen in der Bronzezeit
- Die Bedeutung archäologischer Funde
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit der Beschreibung einer "reichen Frau" der Urnenfelder-Kultur, basierend auf einer historischen Trachtenrekonstruktion von Julius Naue. Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Laugen-Melaun-Gruppe und ihrer kulturellen Einordnung innerhalb der Bronzezeit (ca. 1200-800 v. Chr.). Die Widmung benennt Personen, die den Autor bei einem früheren Werk unterstützt haben.
Schlüsselwörter
Urnenfelderkultur, Bronzezeit, Laugen-Melaun-Gruppe, Schweiz, historische Trachtenrekonstruktion, Julius Naue, Archäologie, Bestattungsrituale.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Laugen-Melaun-Gruppe?
Eine bronzezeitliche Kultur (ca. 1200–800 v. Chr.), die in Teilen der Schweiz (Graubünden, St. Gallen), Liechtenstein und Südtirol existierte.
Wer war die „reiche Frau“ der Urnenfelder-Kultur?
Es handelt sich um eine archäologische Rekonstruktion einer Bestattung, die Aufschluss über Tracht, Schmuck und den sozialen Status von Frauen in der Bronzezeit gibt.
Wovon lebten die Menschen der Laugen-Melaun-Gruppe?
Die Menschen waren Ackerbauern, Viehzüchter und geschickte Bronzegießer, die zudem regen Handel in der Alpenregion trieben.
Welche Fundstücke sind typisch für diese Kultur?
Besonders charakteristisch ist die Keramik (Laugen-Melaun-Ware) sowie spezifische Werkzeuge, Waffen und Schmuckgegenstände aus Bronze.
Wer ist der Autor Ernst Probst?
Ernst Probst ist ein Wissenschaftsautor, der für seine Werke über die Ur- und Frühgeschichte Deutschlands und Europas bekannt ist.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2011, Die Laugen-Melaun-Gruppe in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183508