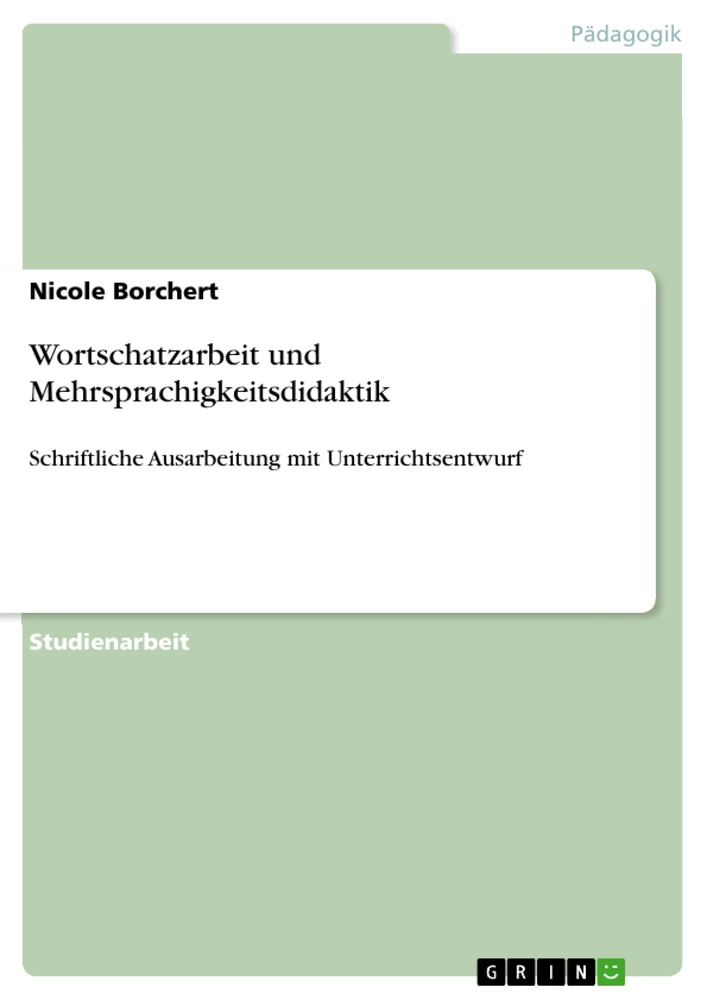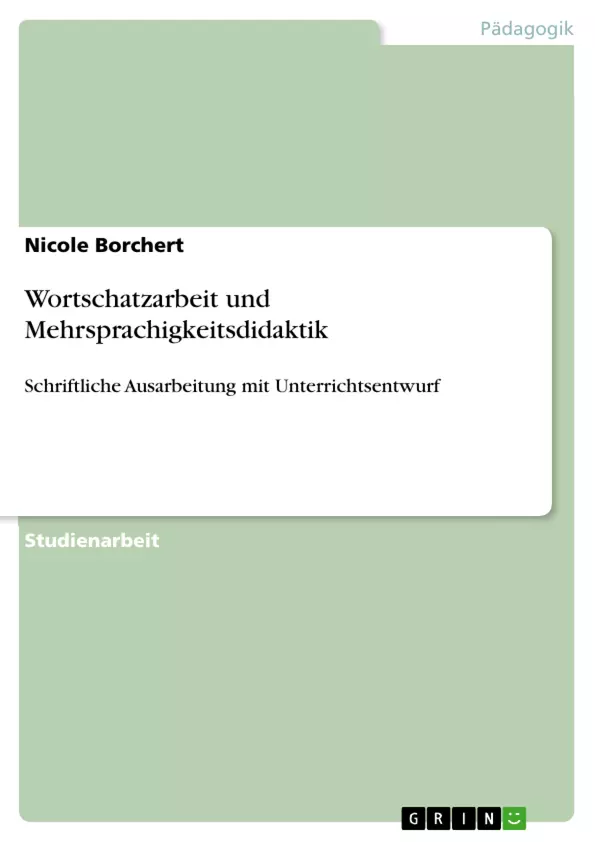Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik
Im Kontext der Spracherwerbsforschung und der Allgemeinen Didaktik ist seit den letzen 30 Jahren ein Paradigmenwechsel zu konstatieren. Während zuvor Fragen der Lehrstoffauswahl und der Lernkontrolle im Mittelpunkt standen, kann in jüngster Zeit von einer verstärkten „Hinwendung zur Erforschung und Entfaltung der Lernerperspektive“ gesprochen werden (vgl. Hufeisen/ Neuner 2005: 13). Die Konzentration auf die Lerner als Subjekte des individuellen Aneignungsprozesses führt auch zu einem vermehrten wissenschaftlichen und didaktischen Interesse an deren Lernvoraussetzungen und Lernerfahrungen. Auch wenn dieser positive Trend durchaus zu verzeichnen ist, scheint „Multilingualismus als Norm“ eher auf theoretischer Ebene relevant zu sein.
In der Unterrichtspraxis wird das Konzept der Mehrsprachigkeit noch relativ wenig beachtet, vor allem aber wird Mehrsprachigkeit leider immer noch als Hindernis gesehen, das dem „Ideal des monolingualen Sprechers“ vor allem im Sprachunterricht entgegensteht (vgl. Kärchner-Ober 2009: 45).
Die Notwendigkeit und der Sinn potenzielle Mehrsprachigkeit positiv zu nutzen und so in den Unterricht einzubinden, dass die Lerner in ihrem Spracherwerb davon profitieren können, muss noch den Sprung von der Forschung in das Klassenzimmer schaffen, damit angewandte Mehrsprachigkeitsdidaktik zum Regelfall an Schulen und Hochschulen werden kann.
Die lernerorientierte Forschung und Fremdsprachendidaktik hat sich dieser Notwendigkeit bereits angenommen und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit Fragen nach dem Sprachbesitz und den vorausgehenden Sprachkenntnissen. Der Fokus liegt hierbei auf dem Aspekt der sprachlichen und außersprachlichen Vorerfahrungen und Vorkenntnisse der Lerner. Zu Hinterfragen ist hier in erster Linie, welche Rolle diese Fähigkeiten beim Fremdsprachenlernen spielen und wie diese sinnvoll aktiviert und in die Unterrichtspraxis integriert werden können (vgl. Hufeisen/ Neuner 2005: 14).
Wichtig hierbei ist das Bewusstsein, dass Lerner einer Fremdsprache mit dem Beginn des Fremdsprachenerwerbs bereits über ein muttersprachliches System und andere fremdsprachlichen Kenntnisse einerseits, über ein breites Kontext- und Weltwissen andererseits verfügen, sie also niemals bei „Null“ anfangen. Fremdsprachenerwerb ist auf dieser Grundlage deshalb immer als Prozess von Spracherweiterungen beziehungsweise Sprachveränderungen zu betrachten (vgl. Hufeisen 1991: 24).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik
- 1.2 Zielsetzung und Herangehensweise
- 2. Mehrsprachigkeitsdidaktik und Wortschatzarbeit
- 2.1 Verarbeitungsstrategien für den Wortschatzerwerb
- 2.1.1 Herstellen von Zusammenhängen
- 2.1.2 Verankerung im Gedächtnis
- 2.1.3 Übungen zum Wortschatz
- 2.2 Nutzung von Mehrsprachigkeit beim Wortschatzerwerb
- 2.2.1 Inferieren
- 2.2.2 Transfer
- 3. Didaktische Umsetzung am Beispiel einer Unterrichtseinheit
- 3.1 Allgemeine Erläuterungen zur Aufgabenstellung
- 3.2 Hinweise zur didaktischen Umsetzung: Teil 1
- 3.3 Hinweise zur didaktischen Umsetzung: Teil 2
- 4. Schlussbemerkungen
- 4.1 Resümee und Stellungnahme
- 4.2 Seminarreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Wortschatzarbeit im Deutschunterricht im Kontext der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Sie analysiert die kognitiven Prozesse beim Erlernen neuer Wörter, besonders im Hinblick auf mehrsprachige Lerner, und zeigt auf, wie ihr sprachliches Vorwissen in den Lernprozess integriert werden kann.
- Verknüpfung von Wortschatz und Mehrsprachigkeit
- Strategien zum Wortschatzerwerb bei mehrsprachigen Lernern
- Didaktische Umsetzung von Mehrsprachigkeitsdidaktik im Unterricht
- Einsatz von Vorwissen und Transfer als Lernstrategien
- Konkrete Unterrichtsbeispiele für den L3-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Mehrsprachigkeitsdidaktik und Wortschatzarbeit
- Kapitel 3: Didaktische Umsetzung am Beispiel einer Unterrichtseinheit
Dieses Kapitel führt das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik ein und beschreibt den Paradigmenwechsel in der Spracherwerbsforschung hin zu einer lernerorientierten Perspektive. Es wird betont, dass Mehrsprachigkeit nicht als Hindernis, sondern als Lernressource betrachtet werden sollte und die Notwendigkeit, diese im Unterricht zu nutzen, hervorgehoben.
Dieses Kapitel befasst sich mit den Verarbeitungsstrategien beim Wortschatzerwerb, wie z.B. dem Herstellen von Zusammenhängen im mentalen Lexikon und der Verankerung neuer Wörter im Gedächtnis. Es wird aufgezeigt, wie Mehrsprachigkeit genutzt werden kann, um den Wortschatzerwerb zu erleichtern und den Transfer von Wissen zwischen verschiedenen Sprachen zu fördern.
Dieses Kapitel stellt eine konkrete Unterrichtseinheit für L3-Lerner im Fach Deutsch als Fremdsprache vor. Es wird gezeigt, wie die Muttersprache und die bereits erlernte L2 Englisch als Ressourcen für den Wortschatzerwerb genutzt werden können. Dabei werden auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Orthografie und Phonetik thematisiert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeitsdidaktik, Wortschatzarbeit, Spracherwerb, Lernerorientierung, mentale Lexikon, Transfer, Inferieren, Unterrichtsgestaltung, L3-Unterricht, Deutsch als Fremdsprache.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Mehrsprachigkeitsdidaktik?
Ein didaktischer Ansatz, der die bereits vorhandenen Sprachkenntnisse (Muttersprache, Zweitsprache) der Lerner aktiv als Ressource für das Erlernen weiterer Sprachen nutzt.
Wie hilft Mehrsprachigkeit beim Vokabellernen?
Durch Strategien wie Transfer (Übertragung von Strukturen) und Inferieren (Erschließen von Bedeutungen aus bekannten Sprachen).
Was ist das „mentale Lexikon“?
Die Art und Weise, wie Wörter im Gehirn gespeichert und vernetzt sind. Bei Mehrsprachigen sind Begriffe oft über Sprachgrenzen hinweg verknüpft.
Warum sollte man im L3-Unterricht (z.B. Deutsch) Englisch nutzen?
Weil viele Lerner bereits Englisch beherrschen und Ähnlichkeiten in Wortschatz und Grammatik den Erwerb von Deutsch erheblich beschleunigen können.
Ist Mehrsprachigkeit ein Hindernis im Unterricht?
Früher oft so gesehen, zeigt die moderne Forschung heute, dass die gezielte Aktivierung von Vorwissen den Lernerfolg steigert.
- Citation du texte
- Nicole Borchert (Auteur), 2011, Wortschatzarbeit und Mehrsprachigkeitsdidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183517