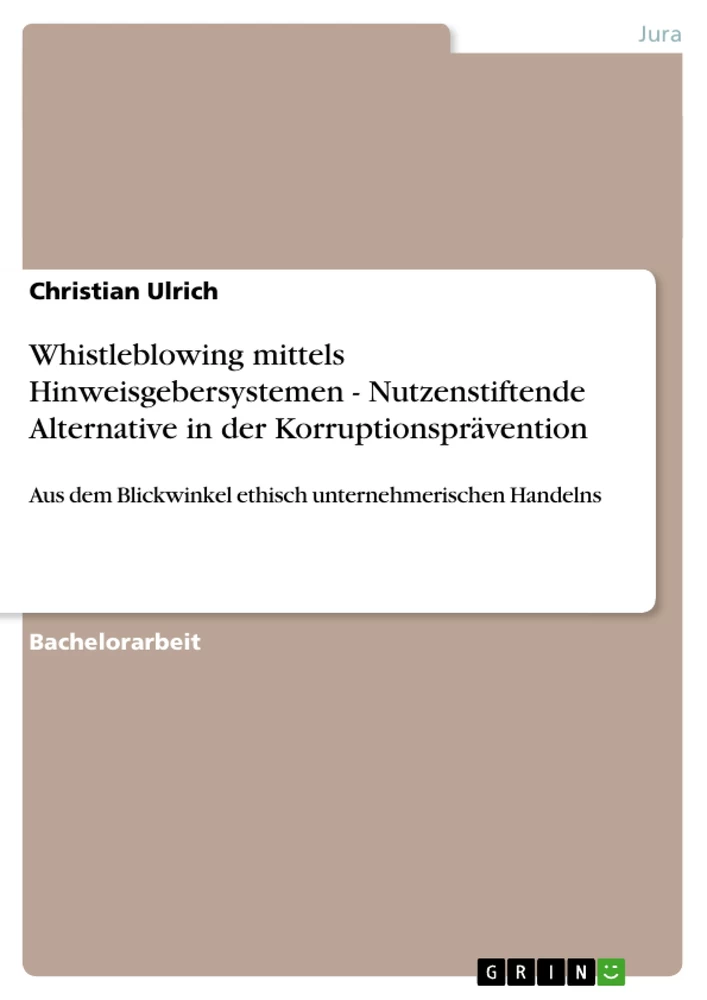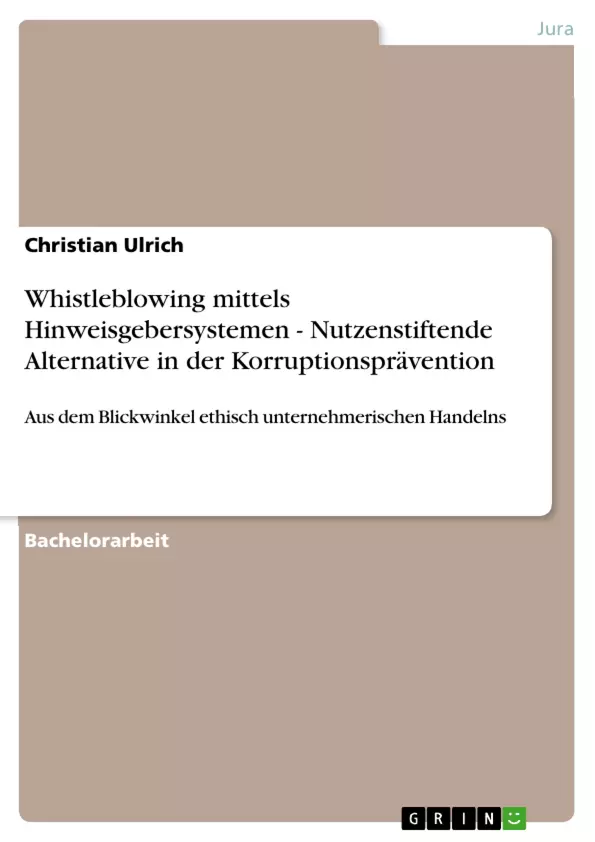„Jeder Mensch ist bestechlich; entscheidend ist nur die Höhe des Preises“ . Nach dieser Maxime scheinen immer mehr Organisationen zu handeln.
Korruption ist kein neues Thema, aber eines mit neuer Brisanz. Das öffentliche Interesse für das Ausmaß an Wirtschaftskriminalität hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen.
In vielen Unternehmen sind Bestechung und Korruption an der Tagesordnung. Geschäftspartner werden bestochen, Betriebsräte umgarnt, Aufsichtsgremien schauen weg.
Die Korruptionsaffären bei Siemens, Infineon, Enron, VW, der Deutschen Bank, Continental, Mannesmann, etc. – um nur einige Beispiele anzuführen – machen dies deutlich und offenbaren zugleich ein zu¬nehmendes Interesse der Bevölkerung an lückenloser Aufklärung. Die spektakulären Prozesse sind in aller Munde. Allein im Schmiergeldskandal bei Siemens wurde gegen 270 Beschuldigte ermittelt.
Korruption bleibt ein weltweit ernst zu nehmendes Problem. Sie beeinträchtigt die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Bolko von Oetinger schrieb in einem Beitrag für das Manager-Magazin: „Entscheidend für die Rettung des Kapitalismus wird das Selbstverständnis der Unternehmer sein. Natürlich müssen sie ihre wirtschaftlichen Ziele verfolgen. Aber sie sollten die wirtschaftliche Betrachtung des Gesellschaftlichen wieder mit der gesellschaftlichen Betrachtung des Wirtschaftlichen verbinden“.
Nicht nur Wirtschaftsethiker und Sozialwissenschaftler befassen sich mit der Thematik einer scheinbar zunehmenden Verwahrlosung der Unternehmen. Korruption und verantwortungslosem Handeln stehen Tür und Tor offen, wenn durch betrügerische Absichten selbst in scheinbar seriösen Großkonzernen ehemals verbindliche Grenzen überschritten werden.
In der Debatte um Ethik in der Wirtschaft werden vielfach Moral und Ökonomie als zwei miteinander unvereinbare Konzepte dargestellt. Für den Wirtschaftsakteur ergeben sich daraus zunächst scheinbar nur zwei Handlungsalternativen: Entweder er richtet seine Aufmerksamkeit auf seinen Gewinn und verachtet jedes Moralgefühl oder er übernimmt moralische Verantwortung, erzielt dadurch aber schlechtere Ergebnisse.
Insofern galt zu untersuchen, wie sich diese Situation auf das Phänomen der Korruption auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2. Allgemeine Einführung in die Unternehmens- und Wirtschaftsethik
- 2.1 Historischer Rückblick
- 2.2 Begriffsbestimmungen
- 2.2.1 Werte
- 2.2.2 Normen
- 2.2.3 Ethik
- 2.2.4 Moral
- 2.2.5 Eigeninteresse
- 2.2.6 Investition
- 2.2.7 Ökonomik
- 2.3 Abgrenzungen von Individual-, Unternehmens- und Wirtschaftsethik
- 2.4 Dilemma von Wettbewerb und Moral
- 2.5 Aufgaben und Herausforderungen der Unternehmensethik heute
- 2.6 Unternehmensethik praktizieren
- 2.6.1 Soziales Engagement
- 2.6.2 Verhaltenskodizes
- 2.6.3 Darstellungen aus der Praxis
- 2.7 Kritische Würdigung
- 3. Wie lässt sich das Phänomen Korruption verstehen?
- 3.1 Historische Überlieferungen
- 3.2 Was ist Korruption?
- 3.2.1 Wesenszüge und Merkmale von Korruption
- 3.2.1.1 Typische Täterprofile von Wirtschaftsstraftätern
- 3.2.1.2 Motive für Wirtschaftskriminalität
- 3.2.1.3 „Laufbahn“ eines Wirtschaftskriminellen
- 3.2.2 Straftatbestände im Bereich der Korruption
- 3.2.3 Mögliche Ursachen von Korruption
- 3.2.4 Auswirkungen von Korruption
- 3.2.5 Wie wird Korruption wahrgenommen und erfasst?
- 3.2.6 Hell- und Dunkelfeld
- 3.2.7 Durch Korruption hervorgerufene Schäden
- 3.2.8 Repression und Prävention
- 3.2.8.1 Schaffung von mehr Transparenz
- 3.2.8.2 Turnusmäßige Kontrollen
- 3.2.1 Wesenszüge und Merkmale von Korruption
- 3.3 Kritische Würdigung
- 4. Whistleblowing - ein geeignetes Antikorruptionsinstrument?
- 4.1 Was ist Whistleblowing?
- 4.1.1 Begriffsdefinition Whistleblowing
- 4.1.2 Whistleblower - Dissidenten oder Reformer?
- 4.1.3 Arten von Whistleblowing
- 4.1.3.1 Offenes Whistleblowing
- 4.1.3.2 Anonymes Whistleblowing
- 4.1.3.3 Internes Whistleblowing
- 4.1.3.4 Externes Whistleblowing
- 4.2 Rechte, Pflichten und mögliche Konsequenzen für Whistleblower
- 4.2.1 Rechte von Whistleblowern
- 4.2.2 Pflichten von Whistleblowern
- 4.2.2.1 Grenzen der Verschwiegenheitspflicht
- 4.2.2.2 Voraussetzungen des Anzeigerechts
- 4.2.3 Arbeitsrechtliche Konsequenzen für Whistleblower
- 4.3 Kritische Würdigung
- 4.1 Was ist Whistleblowing?
- 5. Hinweisgebersysteme - ein Instrument für Whistleblower
- 5.1 Vorteile von Hinweisgebersystemen
- 5.2 Schwierigkeiten und Risiken von Hinweisgebersystemen
- 5.3 Etablierte Hinweisgebersysteme aus der Praxis
- 5.3.1 BKMSⓇ des Landes Niedersachsen
- 5.3.2 Wikileaks
- 5.4 Kritische Würdigung
- 6. Ausblick
- 6.1 Zielerreichung
- 6.2 Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Whistleblowing und Hinweisgebersysteme im Kontext der Korruptionsprävention aus ethisch-unternehmerischer Sicht. Ziel ist es, den Nutzen von Hinweisgebersystemen als Alternative zur Korruptionsprävention zu evaluieren.
- Wirtschaftsethik und deren Bedeutung für Unternehmen
- Das Phänomen Korruption: Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung
- Whistleblowing als Instrument der Korruptionsprävention
- Analyse von Hinweisgebersystemen: Vor- und Nachteile
- Bewertung der Effektivität von Hinweisgebersystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und definiert die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Unternehmens- und Wirtschaftsethik, inklusive historischer Entwicklung und Begriffserklärungen. Kapitel 3 beleuchtet das Phänomen Korruption umfassend, von historischen Aspekten bis zu den Auswirkungen und Bekämpfungsstrategien. Kapitel 4 widmet sich dem Whistleblowing, definiert den Begriff und untersucht die Rechte und Pflichten von Whistleblowern. Kapitel 5 analysiert Hinweisgebersysteme als Instrument für Whistleblower, ihre Vor- und Nachteile werden eingehend betrachtet.
Schlüsselwörter
Whistleblowing, Hinweisgebersysteme, Korruptionsprävention, Unternehmensethik, Wirtschaftsethik, Whistleblower, Compliance, Transparenz, Antikorruption.
- Quote paper
- Christian Ulrich (Author), 2011, Whistleblowing mittels Hinweisgebersystemen - Nutzenstiftende Alternative in der Korruptionsprävention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183642