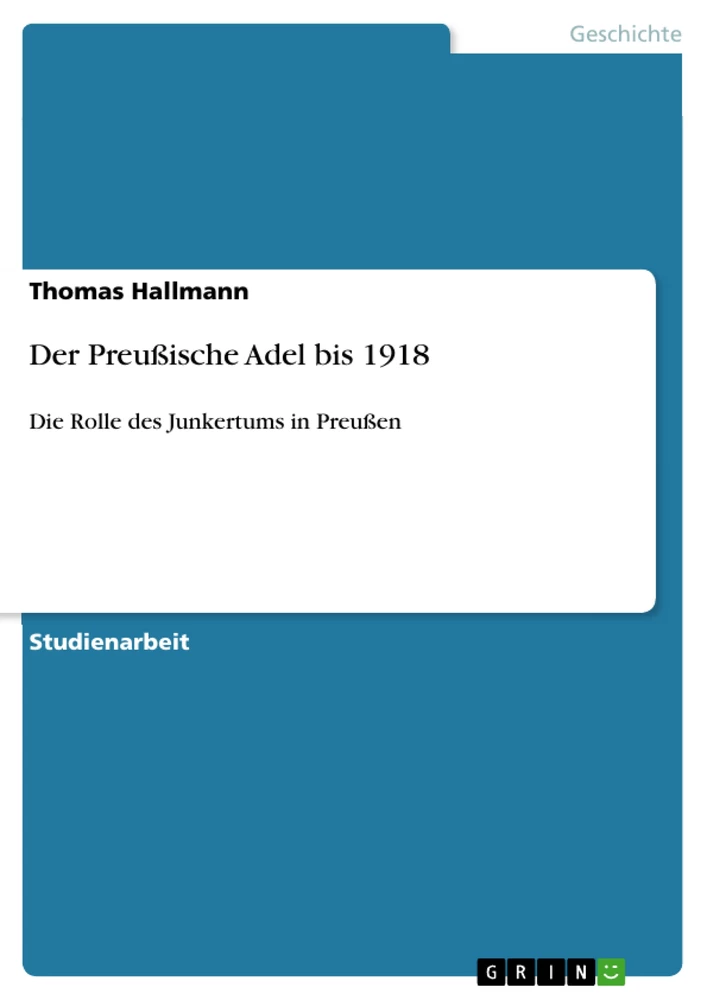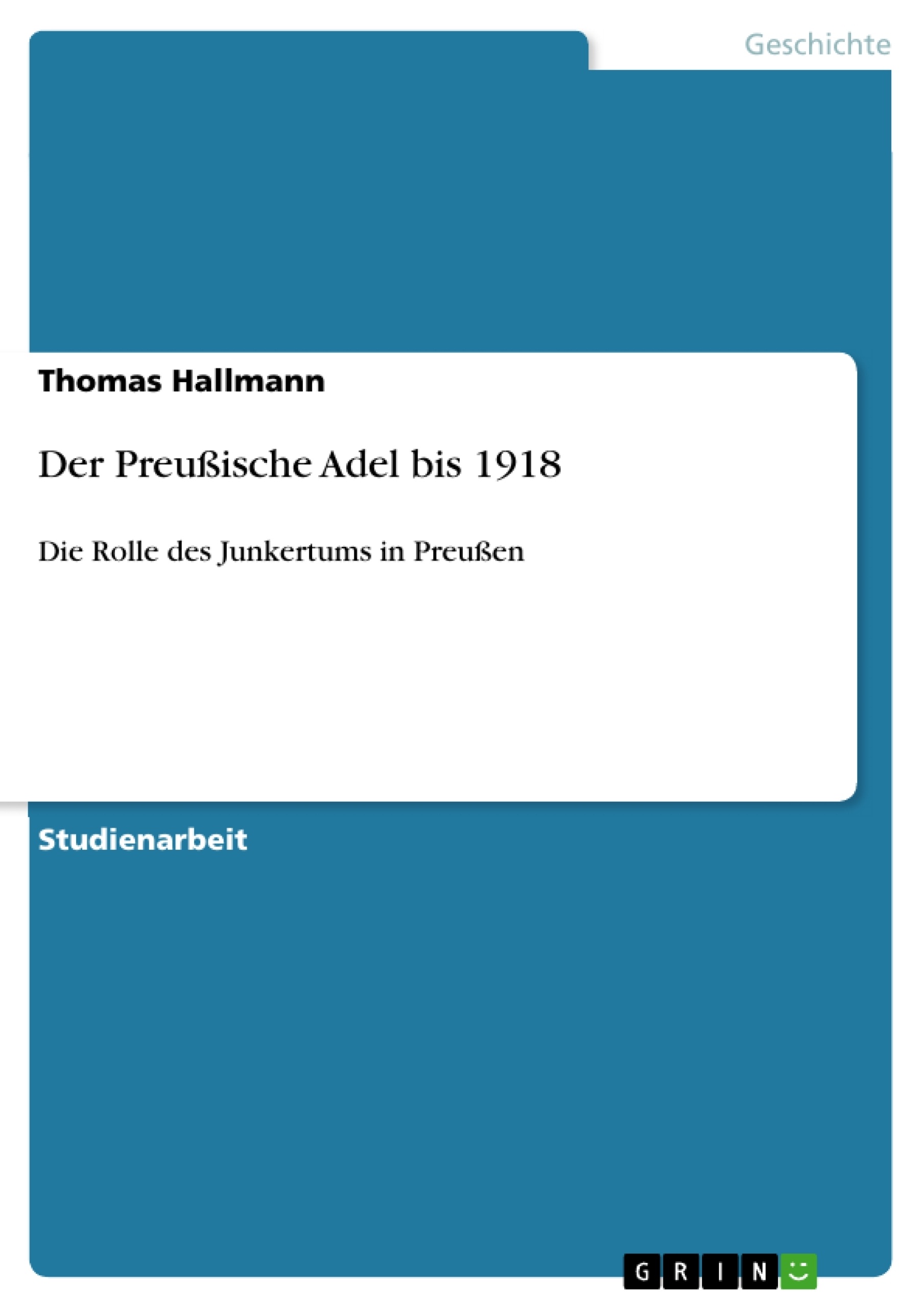Zu den wohl bedeutendsten Vertreter der europäischen Oberschicht müssen die preußischen Junker gezählt werden, die wie kaum ein anderer Adelszweig die Geschichte ihres eigenen Landes geprägt und aktiv beeinflusst haben. Als vorherrschende, adelige Elite Preußens betätigten sie sich sowohl machtpolitisch im Verwaltung, Staats- und Militärdienst als auch wirtschaftlich als Großgrundbesitzer und Agrarier auf dem eigenen Gut. Dabei gelang es ihnen über längere Zeit hinweg nicht nur das Geschick der Ostprovinzen sondern ganz Preußens und letztendlich ganz Deutschlands mitzubestimmen. Jedoch waren ihr Ruf und ihr Ende nicht minder mit Preußen und schließlich dem Deutschen Reich verbunden. Viel mehr lässt sich sagen, dass die Geschichte der Junker nicht von der Preußens zu trennen ist. Doch wofür stand das Junkertum wirklich? Welche Interessen verfolgten die „Ostelbier“ und wo war ihr Platz im preußischen Staat und in dem seit 1871 bestehenden Deutschen Kaiserreich? Diesen Fragen soll im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stellung im preußischen Staat im 17. und 18. Jahrhundert
- Die Zeit der Reformen und des Liberalismus
- Die Preußischen Reformen
- Die Zeit des Vormärz
- Die Revolution von 1848/49
- Die Rolle im Deutschen Kaiserreich
- Die Ära Bismarck
- Die Wilhelminische Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des preußischen Adels, insbesondere des Junkertums, in Preußen und Deutschland vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Sie analysiert die Entwicklung der Machtposition des Adels, seine Beziehungen zum preußischen Staat und seine Einflussnahme auf politische und gesellschaftliche Prozesse.
- Entwicklung der Machtposition des Junkertums in Preußen
- Beziehungen zwischen Junkertum und preußischem Staat
- Der Einfluss des Junkertums auf Politik und Gesellschaft
- Die Rolle des Junkertums in den preussischen Reformen und Revolutionen
- Der Wandel der Stellung des Adels im Deutschen Kaiserreich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Bedeutung des preußischen Junkertums und dessen enge Verknüpfung mit der Geschichte Preußens und Deutschlands. Sie formuliert die Forschungsfrage nach der tatsächlichen Rolle des Junkertums und kündigt den Untersuchungszeitraum an.
Die Stellung im preußischen Staat im 17. und 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die Vormachtstellung des Junkertums im 17. und 18. Jahrhundert, seine Privilegien und seinen Einfluss auf Staat und Gesellschaft. Es wird die Bedeutung der Gutswirtschaft und die Abhängigkeit des Staates von der finanziellen Unterstützung des Adels hervorgehoben. Die Versuche der Landesherren, die Macht des Adels einzuschränken, werden ebenfalls thematisiert.
Die Zeit der Reformen und des Liberalismus: Dieser Abschnitt behandelt die Veränderungen in der Stellung des Adels während der preussischen Reformen, der Zeit des Vormärz und der Revolution von 1848/49. Die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Macht des Junkertums werden analysiert.
Schlüsselwörter
Preußischer Adel, Junkertum, Preußen, Deutsches Kaiserreich, Gutsherrschaft, politische Macht, soziale Privilegien, Reformen, Liberalismus, Revolution 1848/49, Machtverhältnisse, Ostelbien.
- Quote paper
- Thomas Hallmann (Author), 2007, Der Preußische Adel bis 1918, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183702