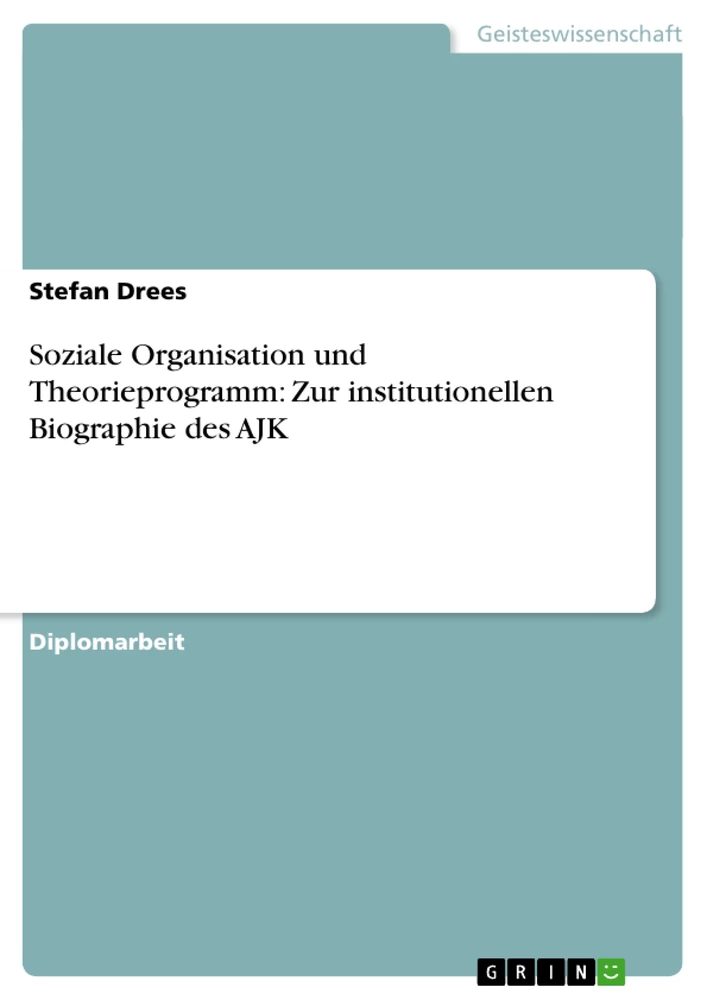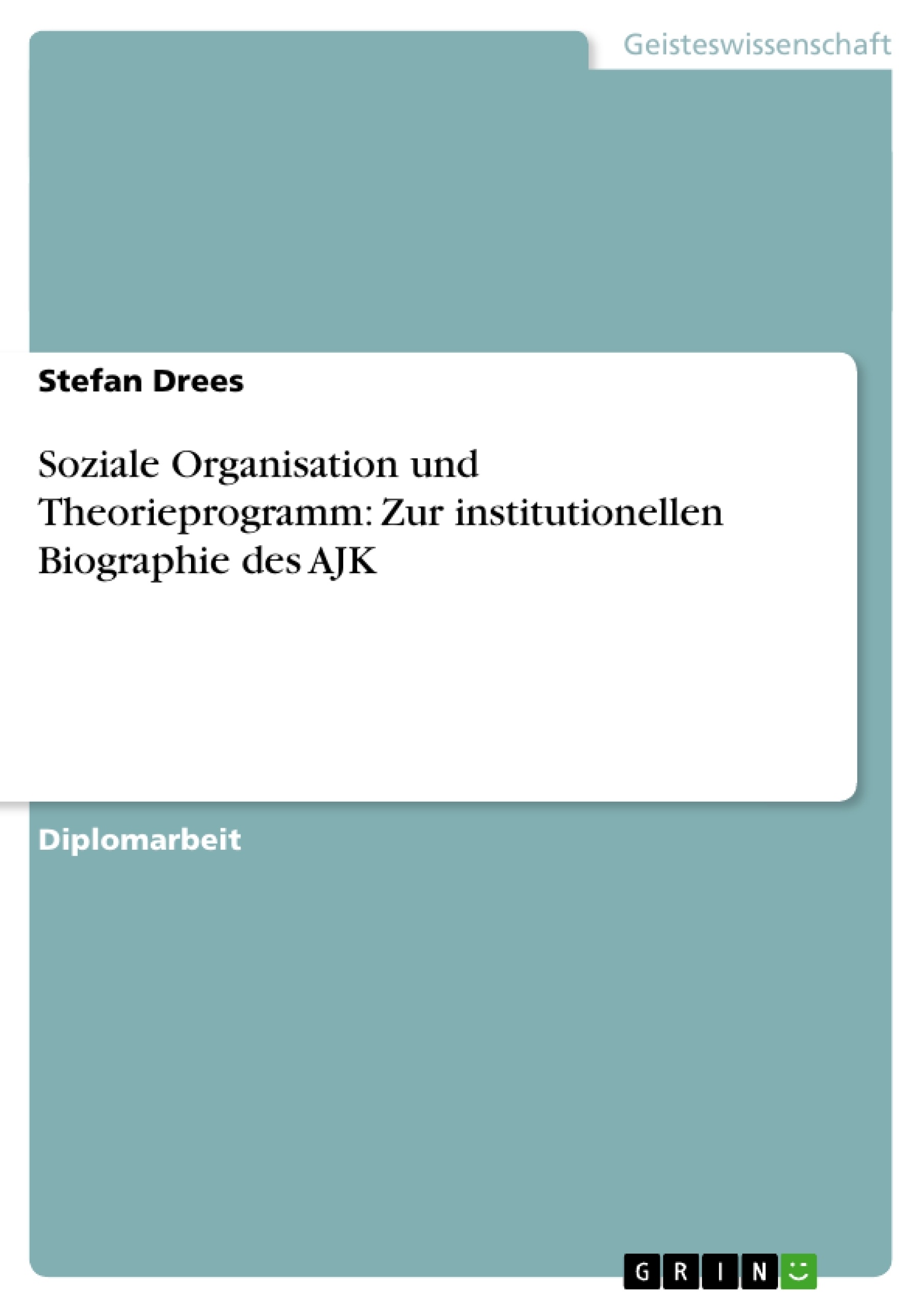In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, die Entwicklung der sogenannten "kritischen Kriminologie" in Deutschland unter wissenschaftssoziologischen Gesichtspunkten zu rekonstruieren und aufzuzeigen, inwiefern sich die soziale Organisation einer scientific community und ihr Theorieprogramm gegenseitig beeinflussen.
Anhand der institutionellen Biographie des Arbeitskreis Junger Kriminologen (AJK) und des im wesentlichen aus den Veröffentlichungen des Kriminologischen Journals (KrimJ) rekonstruierten Theorieprogramms kritischer Kriminologie sind die Debatten und Kontroversen innerhalb der kritischen Kriminologie auf der Grundlage eines von T.S. Kuhns Idee der Paradigmenentwicklung inspirierten Schemas systematisiert worden. Die Untersuchung erstreckt sich auf den Zeitraum von 1969 bis 1996 und umfasst somit die ersten zwanzig Jahre der Geschichte des AJK. Diese wird dargestellt durch eine Auswertung vom Autor erschlossener Dokumente, im wesentlichen Rundschreiben des AJK und Korrespondenz unter den Mitgliedern, durch Gespräche mit der damaligen Sprecherin des wissenschaftlichen Beirates, durch bibliometrische Analysen der im KrimJ publizierten Beiträge und deren inhaltliche Systematisierung, sowie durch Rekurs auf weitere Quellen. Der Hauptteil der Arbeit teilt sich, dem theoretischen Ausgangsüberlegungen entsprechend in eine Untersuchung der sozialen Organisation des AJK, eine Untersuchung über das KrimJ als Kommunikationsmedium und eine umfassende Darstellung der Entwicklung des Theorieprogramms der kritischen Kriminologie.
Es wird hier aus der Beobachtungsperspektive ein Systematisierungs- und Rekonstruktionsversuch der Entwicklung eines wissenschaftlichen Diskussionszusammenhangs unternommen, der zu Ergebnissen und Einsichten führt, die aus der Teilnehmerperspektive in dieser Deutlichkeit so nicht ohne weiteres gewonnen werden können. So zeigt sich am Ende der Arbeit deutlich, dass Selbstdeutung und extern rekonstruierbare Entwicklung an vielen Stellen auseinander fallen.
Inhaltsverzeichnis
- Vowort
- 1. Einleitung
- I. Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftssoziologie: Perspektiven für eine integrative Analyse wissenschaftlichen Wissens
- 2. Entwicklungslinien in der Wissenssoziologie und Wissenschaftssoziologie
- 2.1 Die Wissenssoziologie von K. Mannheim
- 2.2 Die funktionalistische Wissenschaftssoziologie von R. K. Merton
- 2.3 Die anti-positivistische Wende in der Wissenschaftsforschung
- 2.3.1 T. S. Kuhns Konzept der Wissenschaftsentwicklung
- 2.3.2 Epistemologische Kritik an T. S. Kuhns Paradigmabegriff
- 2.4 Die Soziologie wissenschaftlichen Wissens
- 3. Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsphilosophie: Die Frage nach der Geltung wissenschaftlichen Wissens
- 4. Ein integrativer Ansatz für die Wissenschaftssoziologie: Soziale und kognitive Faktoren als konstitutive Elemente wissenschaftlichen Wissens
- II. Etablierung und Entwicklung eines neuen Paradigma in der Kriminologie: Die kritische Kriminologie und der AJK als scientific community
- 5. Die soziale Organisation des AJK und ihre Entwicklung von 1969-1996
- 5.1 Ziele des AJK
- 5.2 Formalisierung der Eintritts- und Austrittsbedingungen im AJK und seiner differenzierten Binnenstruktur
- 5.3 Geschäftsführung des AJK
- 5.4 Redaktion des KrimJ
- 5.5 Sozialpolitischer Ausschuß des AJK
- 5.6 Personelle Zusammensetzung des AJK
- 5.7 Regionale Schwerpunkte im AJK
- 5.8 Der AJK und seine Beziehungen zur Umwelt
- 5.8.1 Beziehungen zur Öffentlichkeit
- 5.8.2 Beziehungen zur Sektion „Soziale Probleme und soziale Kontrolle“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
- 5.8.3 Beziehungen zur Deutschen Forschungsgemeinschaft
- 5.8.4 Beziehungen zu anderen kriminologischen Gesellschaften in Deutschland
- 5.9 Personelle Institutionalisierung an den Lehrstühlen deutscher Universitäten
- 6. Die Analyse der Entwicklung der sozialen Organisation des AJK in bezug auf seine Funktion als scientific community
- 7. Das KrimJ als Kommunikationsmedium des AJK
- 7.1 Intention und Aufbau des KrimJ
- 7.2 Zwanzig Jahre KrimJ und ein virtuelles Beiheft
- 7.3 Bibliometrische Analyse zur thematischen Entwicklung der kritischen Kriminologie
- 7.3.1 Die Untersuchungskonzeption
- 7.3.2 Themenanalyse des Kriminologischen Journals
- 7.3.3 Autorenanalyse des Kriminologischen Journals
- 7.3.4 Auswertung der Datenbank SOLIS zum Schlagwort ,,labeling approach“
- 8. Das Theorieprogramm der kritischen Kriminologie und seine Entwicklung von 1969-1996
- 8.1 Die Krise der traditionellen Kriminologie als konstitutives Element eines neuen Paradigmas in der Kriminologie
- 8.2 Die Grundpositionen der kritischen Kriminologie Anfang der 70er Jahre
- 8.2.1 Der negative Konsensus im AJK als Ausgangspunkt einer kritischen Kriminologie: Die Kritik an der traditionellen Kriminolgie
- 8.2.2 Der fehlende positive Konsensus im AJK: Die kontroverse Konstitution der kritischen Kriminologie in 70er Jahren
- 8.2.2.1 Die Zuspitzung auf ein „Entweder-Oder“ in der kritischen Kriminologie: Zwei programmatische Versuche der theoretischen Fundierung einer kritischen Kriminologie
- 8.2.2.1.1 Die,,marxistisch-interaktionistische\" Theorie von F. Sack
- 8.2.2.1.2 Die Kontroverse zwischen F. Sack und K. D. Opp
- 8.2.2.1.3 Die Grundsatzkritik von D. und H. Peters an der traditionellen Kriminologie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive
- 8.2.2.2 Positionen eines integrierenden „Sowohl-Als-auch“ in der kritischen Kriminologie
- 8.2.2.3 Keine Integration möglich?: Probleme und Perspektiven des labeling approach aus der kritischen Sicht von W. Keckeisen
- 8.2.2.4 Die marxistische Kritik an der kritischen Kriminologie, insbesondere an Sacks,,marxistisch-interaktionistischer“ Theorie
- 8.3 Abgesänge auf den labeling approach vs. Weiterentwicklung: Die Diskussion Jahre in der kritischen Kriminologie Ende der 70er
- 8.4 Der Abolitionismus als Kriminalpolitik der kritischen Kriminologie
- 8.4.1 Die Diskussion um den Abolitionismus
- 8.4.2 Bezüge der abolitionistischen Perspektive auf die Habermassche Gesellschaftstheorie
- 8.4.3 Abolitionismus und labeling approach
- 8.5 Die gesellschaftstheoretische Wendung der Etikettierungstheorie: Ein Ausbruchsversuch aus den disziplinären Schranken der Kriminologie
- 8.6 Historisierung in der Kriminologie: Erweiterung oder Verengung der kritischen Kriminologie durch historische Forschung?
- 8.7 Die Diskussion um den „linken Realismus“ in der Kriminologie
- 8.8 Feministische Theorie und kritische Kriminologie
- 8.9 Die Ersetzung eines Begriffes? „Soziale Kontrolle“ vs. „,Soziale AusschlieBung\" als Zentralbegriff einer kritischen Kriminologie
- 8.10 Die kritische Kriminologie am Ende (des 20. Jhd.)?
- Die Entwicklung der sozialen Organisation des AJK als „scientific community“
- Die Analyse des Kriminologischen Journals (KrimJ) als Kommunikationsmedium des AJK
- Die Auseinandersetzung mit dem Theorieprogramm der kritischen Kriminologie und seinen verschiedenen Strömungen
- Die Relevanz des „labeling approach“ und seiner Kritik
- Der Einfluss von feministischen Theorien und dem „linken Realismus“ auf die kritische Kriminologie
- Die Einleitung stellt die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Arbeit dar und beleuchtet die Relevanz einer integrativen Analyse von Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsphilosophie.
- Kapitel 2 präsentiert verschiedene Entwicklungslinien in der Wissenssoziologie und Wissenschaftssoziologie, von K. Mannheim bis hin zur Soziologie wissenschaftlichen Wissens.
- Kapitel 3 diskutiert die Frage nach der Geltung wissenschaftlichen Wissens im Kontext von Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsphilosophie.
- Kapitel 4 entwickelt einen integrativen Ansatz für die Wissenschaftssoziologie, der sowohl soziale als auch kognitive Faktoren als konstitutive Elemente wissenschaftlichen Wissens berücksichtigt.
- Kapitel 5 untersucht die soziale Organisation des AJK und seine Entwicklung von 1969 bis 1996, einschließlich seiner Ziele, Strukturen, Beziehungen zu anderen Institutionen und Personalia.
- Kapitel 6 analysiert die Entwicklung der sozialen Organisation des AJK in Bezug auf seine Funktion als „scientific community“.
- Kapitel 7 analysiert das KrimJ als Kommunikationsmedium des AJK, untersucht seine Intention und seinen Aufbau sowie die thematische Entwicklung der kritischen Kriminologie anhand einer bibliometrischen Analyse.
- Kapitel 8 beleuchtet das Theorieprogramm der kritischen Kriminologie und seine Entwicklung von 1969 bis 1996, einschließlich der Diskussion um den „labeling approach“, den Abolitionismus, die gesellschaftstheoretische Wendung der Etikettierungstheorie, den „linken Realismus“ und die feministische Theorie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die institutionelle Biographie des Arbeitskreises Kritische Kriminologie (AJK) und untersucht die Entwicklung seiner sozialen Organisation sowie seines Theorieprogramms. Dabei geht es um die Entstehung und Festigung eines neuen Paradigmas in der Kriminologie, das sich durch eine kritische Perspektive auf die etablierten Theorien und Praktiken der traditionellen Kriminologie auszeichnet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Kritische Kriminologie, Arbeitskreis Kritische Kriminologie (AJK), Kriminologisches Journal (KrimJ), Labeling Approach, Abolitionismus, „linken Realismus“, feministische Theorie, Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsphilosophie, wissenschaftliche Gemeinschaft, soziale Organisation, Paradigma, Theorieprogramm.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Arbeitskreis Junger Kriminologen (AJK)?
Der AJK ist eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die 1969 gegründet wurde, um eine "kritische Kriminologie" in Deutschland zu etablieren und sich von der traditionellen, täterorientierten Kriminologie abzugrenzen.
Was versteht man unter "Kritischer Kriminologie"?
Sie betrachtet Kriminalität nicht als Eigenschaft einer Person, sondern als Ergebnis gesellschaftlicher Zuschreibungsprozesse und sozialer Kontrolle (Labeling Approach).
Welche Rolle spielt das Kriminologische Journal (KrimJ)?
Das KrimJ dient als das zentrale Kommunikationsmedium des AJK, in dem theoretische Debatten geführt, Forschungsergebnisse publiziert und das Paradigma der kritischen Kriminologie weiterentwickelt wurden.
Was besagt der "Labeling Approach"?
Der Etikettierungsansatz besagt, dass abweichendes Verhalten erst dadurch entsteht, dass Instanzen der sozialen Kontrolle (Polizei, Justiz) eine Handlung als kriminell definieren und den Akteur entsprechend etikettieren.
Was ist Abolitionismus in der Kriminologie?
Abolitionismus ist eine radikale Strömung der kritischen Kriminologie, die die Abschaffung des Strafrechtssystems und des Gefängniswesens zugunsten alternativer Konfliktlösungsmodelle fordert.
- Arbeit zitieren
- Dr. Stefan Drees (Autor:in), 1997, Soziale Organisation und Theorieprogramm: Zur institutionellen Biographie des AJK, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18372