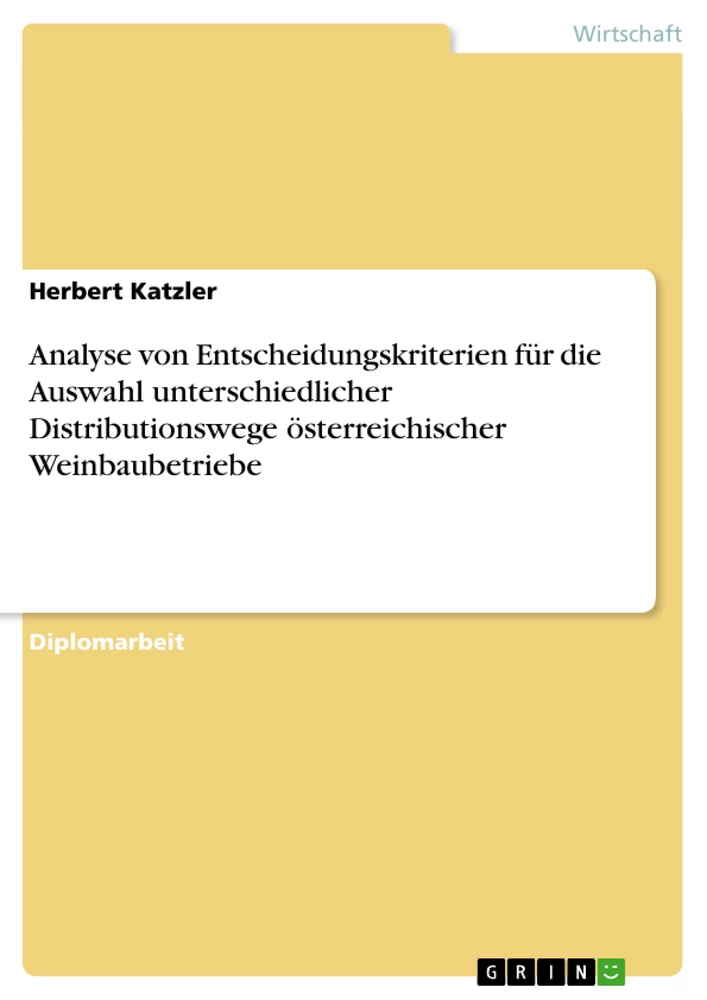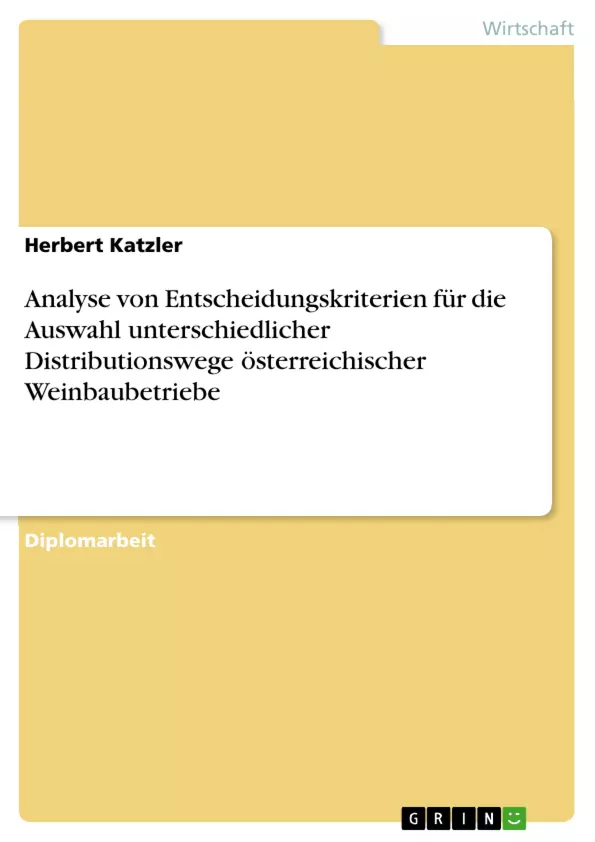Die österreichische Weinwirtschaft ist durch ihre Kleinstrukturiertheit und Heterogenität gekennzeichnet. Der Großteil der Betriebe wird als Familienunternehmen geführt. Durch diese Struktur ergeben sich Probleme bei Vermarktung, Technologie,
Know-how, Finanzierung und Lagerkapazität. Durch die extreme Produktvielfalt, wobei von jedem Wein nur kleine Mengen vorhanden sind, sind professionelle Marketingkonzepte kaum vorhanden.
Neben dem Ausschank in der eigenen Betriebsstätte (Buschenschank) hat der Weinbaubetrieb die Möglichkeiten, Trauben, Fasswein oder Flaschenwein über verschiedene Vertriebswege zu verkaufen. Weit verbreitet sind Multikanal-Systeme, bei denen über mehrere Vertriebskanäle mit einer Vielzahl von Vertriebspartnern verkauft
wird. So wird die Unabhängigkeit gestärkt und das Absatzrisiko gesenkt. Es muss aber auf die Wechselwirkungen zwischen den Vertriebswegen durch ihre Imagewirkung geachtet werden.
Bei der Vermarktung von Flaschenweinen gelten höhere persönliche Anforderungen an den Winzer (Bildung, Kreativität) als bei der Vermarktung von Trauben oder Fasswein. Es ist dabei zwischen direktem und indirektem Vertrieb zu unterscheiden, wobei zur Zeit der direkte zu Gunsten des indirekten Vertriebsweges zurückgeht.
Für erfolgreichen Weinverkauf ist es neben der Bekanntheit, dem Standort, dem Eingehen von Kooperationen, Produktaufmachung und Flexibilität wichtig, sich von der großen Anzahl der Anbieter zu differenzieren und den besonderen Vorteil und Mehrwert für den Kunden herauszuarbeiten. An sinnvollen kommunikationspolitischen
Möglichkeiten sollten dazu Messeauftritte, Direktwerbung und Förderung der Mundpropaganda genutzt werden.
Vor einigen Jahren haben einige Handelsbetriebe und Winzer bemerkt, dass die Zeit reif ist, das Sortiment auszuweiten und auch höherwertige Weine im Lebensmitteleinzelhandel anzubieten. Das geschieht zu beiderseitigem Nutzen. Der Weinbaubetrieb ist präsent und der Handelsbetrieb kann sich durch das ausgeweitete Sortiment
profilieren. Es muss dabei nicht unbedingt die Absatzmaximierung im Mittelpunkt stehen, trotzdem wurden hier die Erwartungen vielfach übertroffen. Der Lebensmitteleinzelhandel stellt sich als Absatzkanal der Zukunft heraus, auch wenn es für viele
Weinbaubetriebe schwierig sein wird, mit der konzentrierten Einkaufsmacht der Handelsbetriebe umzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgangsweise
- 2. Allgemeiner Teil
- 2.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung
- 2.2 Die Situation der österreichischen Weinwirtschaft
- 2.2.1 Struktur
- 2.2.2 Probleme
- 2.2.2.1 Absatz
- 2.2.2.2 Struktur
- 2.2.2.3 Marketing
- 2.2.2.4 Inflexibilität
- 2.3 Distributionspolitik
- 2.4 Vermarktungsformen
- 2.4.1 Traubenverkauf
- 2.4.2 Fassweinverkauf
- 2.4.3 Flaschenwein
- 2.4.4 Buschenschank
- 2.5 Vertriebswege für österreichischen Wein
- 2.5.1 Winzergenossenschaften
- 2.5.1.1 Marktposition
- 2.5.1.2 Qualitätsprobleme
- 2.5.1.3 Produktionsorientierung
- 2.5.2 Weinhändler
- 2.5.3 Lebensmitteleinzelhandel
- 2.5.3.1 Wein aus unternehmenseigenen Kellereien
- 2.5.3.2 Andere Weine
- 2.5.4 Fachhandel
- 2.5.5 Export
- 2.5.6 Gastronomie
- 2.5.7 Direktvermarktung
- 2.5.7.1 Buschenschank
- 2.5.7.2 Ab-Hof-Verkauf
- 2.5.7.3 Zustellung/Versand
- 2.5.1 Winzergenossenschaften
- 2.6 Marketingaktivitäten
- 2.6.1 Österreichische Weinmarketing Service GmbH
- 2.6.2 Districtus Austria Controllatus
- 2.6.3 Gruppenmarketing
- 2.6.4 Veranstaltungen
- 2.6.5 Einzelbetriebliche Maßnahmen
- 2.6.5.1 Messen und Ausstellungen
- 2.6.5.2 Betriebsprospekte
- 2.6.5.3 Briefe an Kunden
- 2.6.5.4 Mundpropaganda
- 2.6.5.5 Bewertungen
- 2.6.5.6 Internet
- 2.6.5.7 Public Relations
- 2.6.5.8 Klassische Werbung
- 3. Spezieller Teil
- 3.1 Voraussetzungen für und Vor- und Nachteile von Vertriebswegen
- 3.1.1 Genossenschaften
- 3.1.2 Handel
- 3.1.2.1 Trauben und Fasswein
- 3.1.2.2 Flaschenwein
- 3.1.3 Export
- 3.1.4 Gastronomie
- 3.1.5 Direktvermarktung
- 3.1.5.1 Ab-Hof-Verkauf
- 3.1.5.2 Zustellung/Versand
- 3.1.5.3 Buschenschank
- 3.2 Entscheidungskriterien
- 3.2.1 Standort
- 3.2.2 Betriebsgröße
- 3.2.3 Ertrag
- 3.2.4 Erwerbsart
- 3.2.5 Persönliche Voraussetzungen
- 3.2.5.1 Alter
- 3.2.5.2 Qualifikation
- 3.2.5.3 Persönliche Eigenschaften
- 3.2.6 Positionierung
- 3.2.7 Sortiment
- 3.2.8 Bekanntheitsgrad
- 3.2.8.1 Bekanntheit des Ortes
- 3.2.8.2 Bekanntheit des Weinbaubetriebes
- 3.2.9 Preis
- 3.3 Erfolgsfaktoren
- 3.3.1 Differenzierung
- 3.3.2 Standort
- 3.3.3 Produktaufmachung
- 3.3.4 Flexibilität
- 3.3.5 Sortiment
- 3.3.6 Verkaufsförderung
- 3.3.7 Kooperationen
- 3.3.8 Vorteile für den Kunden
- 3.1 Voraussetzungen für und Vor- und Nachteile von Vertriebswegen
- 4. Lebensmittelhandel
- 4.1 Allgemeines
- 4.1.1 Kontakte
- 4.1.2 Handelsfunktionen
- 4.2 Voraussetzungen
- 4.2.1 Qualität
- 4.2.2 Menge
- 4.2.3 Produktaufmachung
- 4.3 Konditionen
- 4.3.1 Handelsspanne
- 4.3.2 Listungs- und Werbekostenzuschüsse
- 4.3.3 Anlieferung
- 4.4 Verkaufsförderung
- 4.4.1 Sonderplatzierungen
- 4.4.2 Aktionen und Postwurfsendungen
- 4.5 Preissegmente
- 4.6 Wechselwirkungen
- 4.1 Allgemeines
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Entscheidungskriterien österreichischer Weinbaubetriebe bei der Wahl ihrer Distributionswege. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die die Auswahl des Vertriebsweges beeinflussen und den Erfolg im Weinhandel fördern.
- Analyse der Situation der österreichischen Weinwirtschaft
- Untersuchung verschiedener Distributionswege (Genossenschaften, Handel, Direktvermarktung etc.)
- Identifizierung relevanter Entscheidungskriterien für die Auswahl der Vertriebswege
- Bewertung der Vor- und Nachteile verschiedener Vertriebsstrategien
- Erfolgsfaktoren im Weinhandel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Problemstellung der Auswahl geeigneter Distributionswege für österreichische Weinbaubetriebe. Es skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit und die zu verfolgende Vorgangsweise.
2. Allgemeiner Teil: Dieser Teil beleuchtet die volkswirtschaftliche Bedeutung der Weinwirtschaft in Österreich, analysiert die aktuelle Situation der Branche inklusive ihrer strukturellen Herausforderungen und Probleme im Absatz, Marketing und der generellen Inflexibilität. Es werden verschiedene Vermarktungsformen (Trauben-, Fasswein-, Flaschenweinverkauf und Buschenschank) vorgestellt und die verschiedenen Vertriebswege für österreichischen Wein detailliert untersucht, einschließlich Winzergenossenschaften, Weinhändler, Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel, Export, Gastronomie und Direktvermarktung (Buschenschank, Ab-Hof-Verkauf, Zustellung/Versand). Abschließend werden diverse Marketingaktivitäten auf nationaler und betrieblicher Ebene analysiert, von der Österreichischen Weinmarketing Service GmbH über Districtus Austria Controllatus bis hin zu individuellen Maßnahmen wie Messen, Prospekten und Online-Marketing.
3. Spezieller Teil: Hier werden die Voraussetzungen, Vor- und Nachteile der verschiedenen Vertriebswege im Detail betrachtet. Die Analyse fokussiert auf Genossenschaften, Handel (Trauben/Fasswein und Flaschenwein), Export, Gastronomie und Direktvermarktung (Ab-Hof-Verkauf, Zustellung/Versand, Buschenschank). Im Anschluss werden zentrale Entscheidungskriterien für die Wahl des Vertriebsweges untersucht, wie z.B. Standort, Betriebsgröße, Ertrag, Erwerbsart, persönliche Voraussetzungen des Winzers (Alter, Qualifikation, Eigenschaften), Positionierung, Sortiment, Bekanntheitsgrad (Ort und Betrieb) und Preis. Schließlich werden wesentliche Erfolgsfaktoren, wie Differenzierung, Standort, Produktaufmachung, Flexibilität, Sortiment, Verkaufsförderung, Kooperationen und Kundennutzen, beleuchtet.
4. Lebensmittelhandel: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Lebensmittelhandel als Vertriebsweg für Wein. Es behandelt allgemeine Aspekte wie Kontakte, Handelsfunktionen sowie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit (Qualität, Menge, Produktaufmachung). Die Konditionen, einschließlich Handelsspanne, Listungs- und Werbekostenzuschüsse und Anlieferung werden ebenso detailliert beschrieben wie die Verkaufsförderung durch Sonderplatzierungen, Aktionen und Postwurfsendungen. Abschließend werden die relevanten Preissegmente und die Wechselwirkungen mit anderen Vertriebswegen erörtert.
Schlüsselwörter
Österreichische Weinwirtschaft, Distributionswege, Vertriebsstrategien, Entscheidungskriterien, Weinbaubetriebe, Direktvermarktung, Lebensmitteleinzelhandel, Genossenschaften, Marketing, Erfolgsfaktoren, Absatz, Qualitätsmanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Analyse der Distributionswege österreichischer Weinbaubetriebe
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Entscheidungskriterien österreichischer Weinbaubetriebe bei der Wahl ihrer Distributionswege. Ziel ist die Identifizierung der Faktoren, die die Auswahl des Vertriebsweges beeinflussen und den Erfolg im Weinhandel fördern.
Welche Aspekte der österreichischen Weinwirtschaft werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die volkswirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Weinwirtschaft, analysiert die aktuelle Situation der Branche (Struktur, Probleme im Absatz, Marketing, Inflexibilität) und beleuchtet verschiedene Vermarktungsformen (Trauben-, Fasswein-, Flaschenweinverkauf und Buschenschank).
Welche Vertriebswege werden untersucht?
Die Diplomarbeit untersucht detailliert verschiedene Vertriebswege, darunter Winzergenossenschaften, Weinhändler, Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel, Export, Gastronomie und Direktvermarktung (Buschenschank, Ab-Hof-Verkauf, Zustellung/Versand).
Welche Marketingaktivitäten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Marketingaktivitäten auf nationaler und betrieblicher Ebene, wie die Österreichische Weinmarketing Service GmbH, Districtus Austria Controllatus, Gruppenmarketing, Veranstaltungen und einzelbetriebliche Maßnahmen (Messen, Prospekte, Online-Marketing etc.).
Welche Entscheidungskriterien für die Wahl des Vertriebsweges werden betrachtet?
Die zentralen Entscheidungskriterien umfassen Standort, Betriebsgröße, Ertrag, Erwerbsart, persönliche Voraussetzungen des Winzers (Alter, Qualifikation, Eigenschaften), Positionierung, Sortiment, Bekanntheitsgrad (Ort und Betrieb) und Preis.
Welche Vor- und Nachteile der verschiedenen Vertriebswege werden diskutiert?
Die Arbeit betrachtet detailliert die Vor- und Nachteile von Genossenschaften, Handel (Trauben/Fasswein und Flaschenwein), Export, Gastronomie und Direktvermarktung (Ab-Hof-Verkauf, Zustellung/Versand, Buschenschank).
Welche Erfolgsfaktoren im Weinhandel werden identifiziert?
Wesentliche Erfolgsfaktoren sind Differenzierung, Standort, Produktaufmachung, Flexibilität, Sortiment, Verkaufsförderung, Kooperationen und Kundennutzen.
Wie wird der Lebensmittelhandel als Vertriebsweg behandelt?
Das Kapitel zum Lebensmittelhandel behandelt allgemeine Aspekte wie Kontakte, Handelsfunktionen, Voraussetzungen (Qualität, Menge, Produktaufmachung), Konditionen (Handelsspanne, Listungs- und Werbekostenzuschüsse, Anlieferung), Verkaufsförderung (Sonderplatzierungen, Aktionen) und Preissegmente.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Österreichische Weinwirtschaft, Distributionswege, Vertriebsstrategien, Entscheidungskriterien, Weinbaubetriebe, Direktvermarktung, Lebensmitteleinzelhandel, Genossenschaften, Marketing, Erfolgsfaktoren, Absatz, Qualitätsmanagement.
Wie ist die Diplomarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Allgemeinen Teil, einen Speziellen Teil, ein Kapitel zum Lebensmittelhandel und eine Zusammenfassung. Der Allgemeine Teil analysiert die Rahmenbedingungen, der Spezielle Teil die Entscheidungskriterien und Erfolgsfaktoren, und das Kapitel zum Lebensmittelhandel fokussiert auf diesen spezifischen Vertriebsweg.
- Citar trabajo
- Herbert Katzler (Autor), 2003, Analyse von Entscheidungskriterien für die Auswahl unterschiedlicher Distributionswege österreichischer Weinbaubetriebe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183743