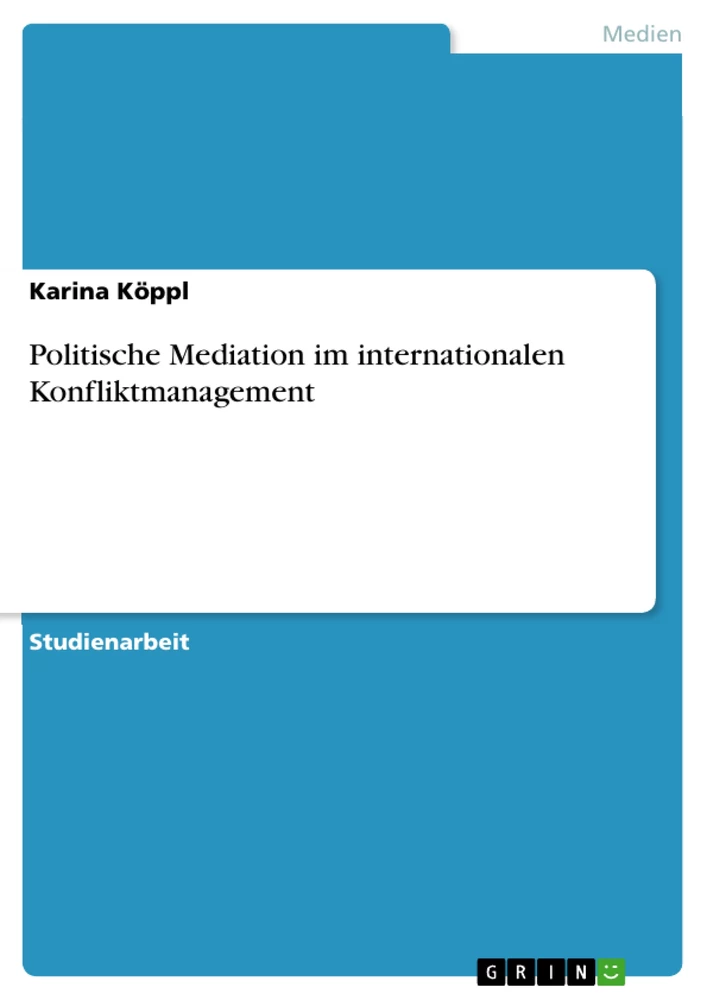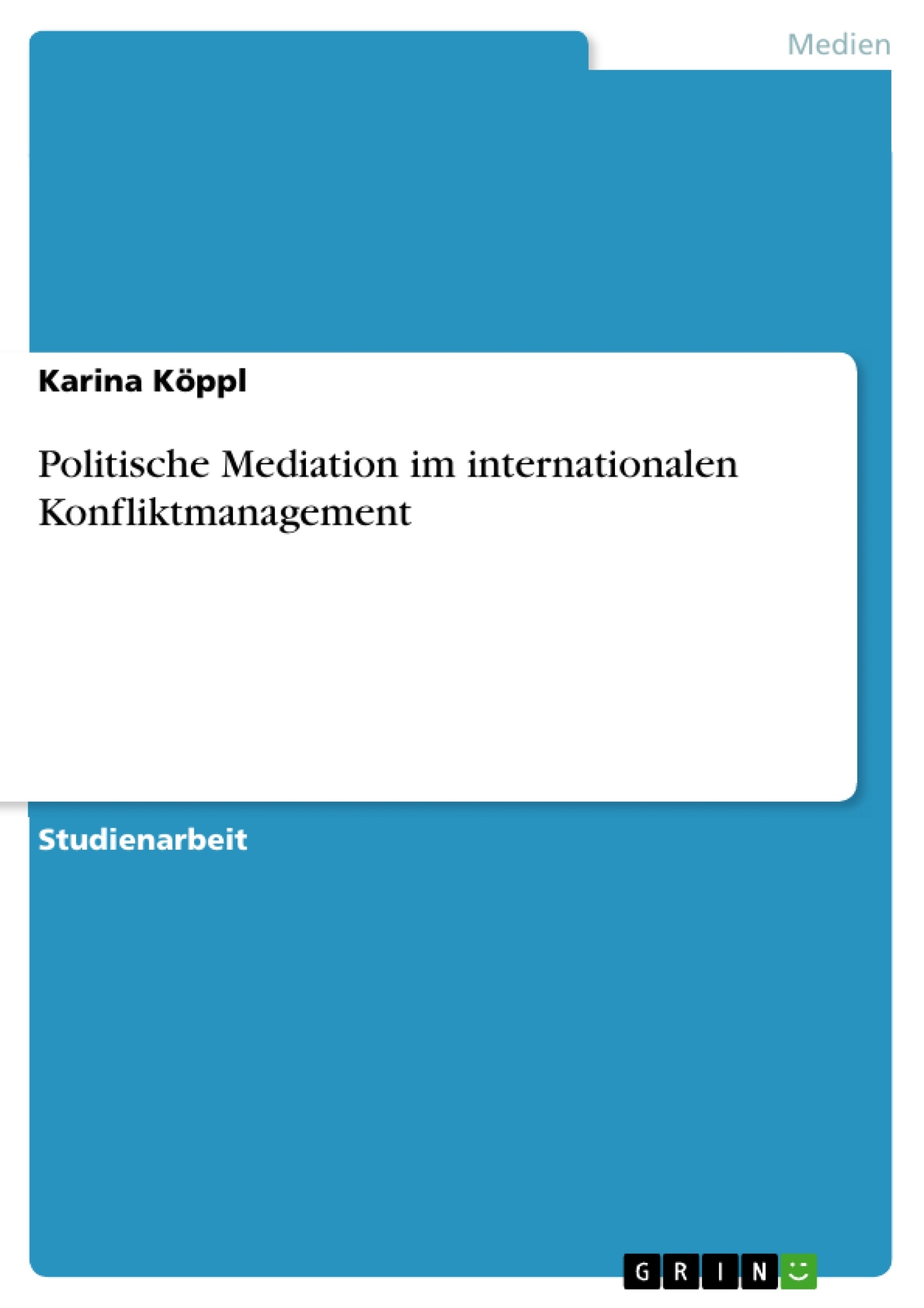Die Vergangenheit zeigt, dass der Einsatz von Gewalt viele Jahrhunderte lang als
angemessenes Mittel zur Austragung innerstaatlicher und internationaler Konflikte galt.
Auch heute eskaliert eine Vielzahl der Konflikte und endet nicht selten in ernsten Krisen.
Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung (HIIK) erfasste im Jahr 2009 365
politische Konflikte, darunter sieben Kriege, 24 ernste Krisen und weitere 112 Krisen.
Somit wurde bei 40 % der Konflikte massiv oder unregelmäßig Gewalt eingesetzt. Die
Untersuchung des HIIK macht deutlich, dass die Anzahl der Konflikte seit 1945 von 82
kontinuierlich auf 365 stieg.
Diese Entwicklung zeigt die Notwendigkeit der Intervention Internationaler
Organisationen und anderer Institutionen im Internationalen Konfliktmanagement,
wenn Streitigkeiten in direkten Verhandlungen der Konfliktparteien nicht beigelegt
werden können. Zu diesem Zweck hat das Internationale Völkerrecht verschiedene
Instrumente wie die Internationale Schiedsgerichtbarkeit festgelegt und verdeutlicht
damit seinen hohen moralischen Anspruch an die Nationalstaaten Konflikte mit nichtkriegerischen Mitteln zu lösen. Eine Methode, die sich aktuell neben den klassischen
Methoden des Internationalen Völkerrechts herausgebildet hat, ist die Politische Mediation, zu der insbesondere die zu den diplomatischen Mitteln zählenden Guten
Dienste und Vermittlung zählen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen des Internationalen
Krisenmanagements und geht dabei insbesondere auf das Gebiet der Politischen
Mediation ein. Zunächst werden die Begrifflichkeiten definiert, wobei eine Abgrenzung
der Politischen Mediation von der klassischen Mediation vorgenommen wird.
Anschließend werden die Verhandlungen von Camp David 1978 im Friedensprozess des
israelisch-palästinensischen Konflikts als Beispiel für die Anwendung Politischer
Mediation angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Definitionen
- 2.1 Was bedeutet internationales Konfliktmanagement?
- 2.1.1 Definition des Begriffes Konflikt
- 2.1.2 Konfliktmanagement
- 2.2 Was ist Mediation?
- 2.2.1 Definitionen für Mediation
- 2.2.2 Phasen der Mediation
- 2.2.3 Politische Mediation
- 2.1 Was bedeutet internationales Konfliktmanagement?
- 3. Der israelisch-palästinensische Konflikt
- 3.1 Historische Hintergründe
- 3.2 Vermittlung im Nahost-Konflikt 1978
- 4. Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Rolle der politischen Mediation im internationalen Konfliktmanagement. Sie beleuchtet die Grundlagen und Definitionen von internationalem Konfliktmanagement und Mediation, um anschließend den israelisch-palästinensischen Konflikt als Fallbeispiel zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Wirksamkeit von Vermittlungsstrategien in komplexen internationalen Konflikten.
- Definition und Anwendung von politischer Mediation
- Analyse des internationalen Konfliktmanagements
- Fallstudie: Der israelisch-palästinensische Konflikt
- Historische Hintergründe und Vermittlungsversuche
- Bewertung verschiedener Konfliktlösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des internationalen Konfliktmanagements ein und unterstreicht die wachsende Bedeutung von friedlichen Konfliktlösungsstrategien angesichts der steigenden Zahl an Konflikten. Kapitel 2 liefert die grundlegenden Definitionen von Konflikt, Konfliktmanagement und Mediation, wobei insbesondere auf die politische Mediation eingegangen wird. Kapitel 3 analysiert den israelisch-palästinensischen Konflikt, beleuchtet dessen historische Hintergründe und untersucht frühe Vermittlungsversuche, wie z.B. die Camp David Verhandlungen von 1978.
Schlüsselwörter
Politische Mediation, Internationales Konfliktmanagement, Konfliktlösung, Israelisch-palästinensischer Konflikt, Vermittlung, Camp David Akkorde, Friedensprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet politische Mediation von klassischer Mediation?
Politische Mediation findet im Kontext staatlicher Konflikte statt und umfasst oft diplomatische Mittel wie "Gute Dienste". Sie ist stärker von machtpolitischen Interessen und völkerrechtlichen Rahmenbedingungen geprägt.
Was sind "Gute Dienste" im Völkerrecht?
Gute Dienste bezeichnen die Bemühung eines unbeteiligten Dritten (Staat oder Organisation), die Konfliktparteien zu Verhandlungen zusammenzubringen, ohne selbst aktiv inhaltliche Vorschläge zu machen.
Welche Rolle spielte die Mediation bei den Camp-David-Verhandlungen 1978?
Die USA fungierten als Mediator zwischen Ägypten und Israel, was zum ersten Friedensvertrag zwischen Israel und einem arabischen Staat führte – ein Meilenstein der politischen Mediation.
Warum steigt die Zahl der internationalen Konflikte seit 1945?
Gründe sind unter anderem die Dekolonisierung, der Kalte Krieg und zunehmende innerstaatliche Spannungen, die oft in regionale Krisen eskalieren.
Was ist das Ziel des internationalen Konfliktmanagements?
Ziel ist es, gewaltsame Eskalationen zu verhindern und Streitigkeiten durch Verhandlungen, Schiedsgerichtsbarkeit oder Mediation friedlich beizulegen.
- Citation du texte
- Karina Köppl (Auteur), 2011, Politische Mediation im internationalen Konfliktmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183772