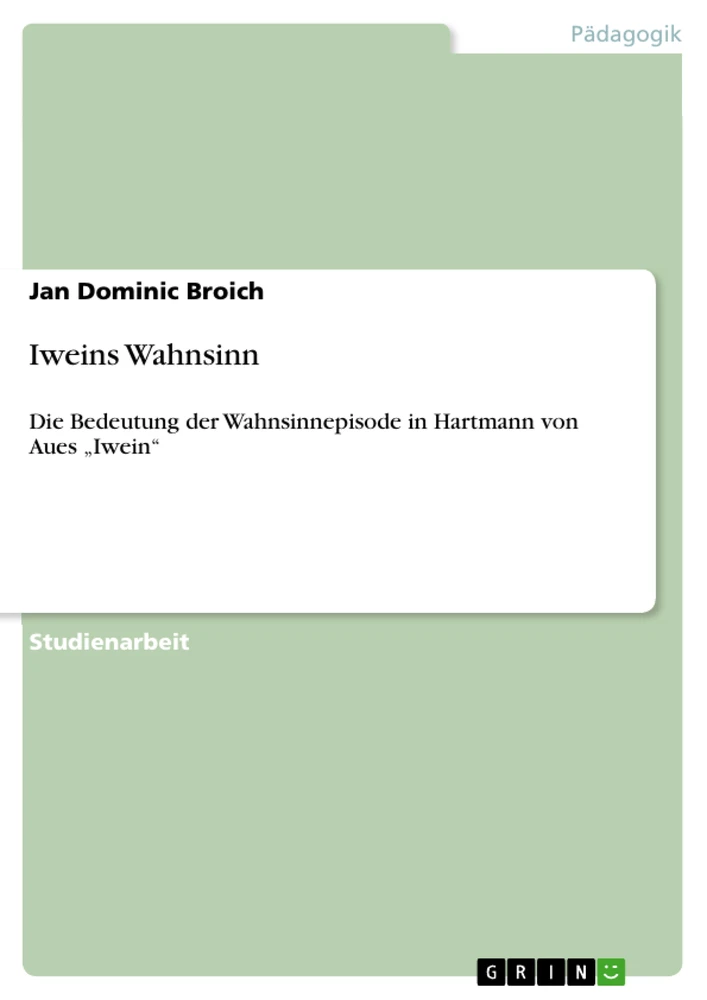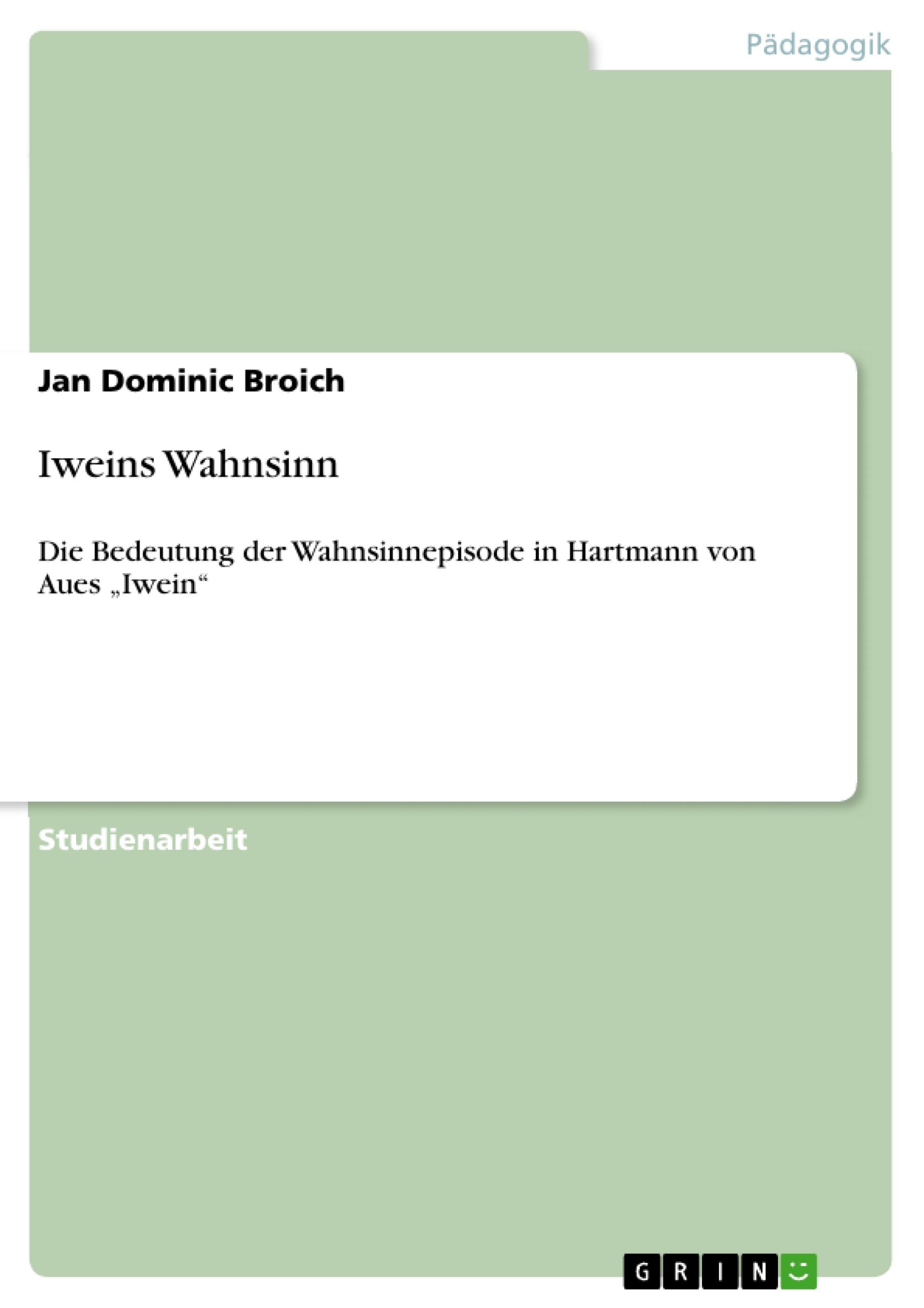Vor dem Hintergrund mittelalterlicher Heilkunde und psychoanalytischer Überlegungen untersucht diese Arbeit die Wahnsinnsepisode in H.v.Aues "Iwein". Worin das Scheitern des Protagonisten und sein Wahnsinn genau bestehen, wie er vom Wahnsinn befreit wird und sein Wahn ihm schließlich zur Katharsis gereicht - dies sind die Fragen mit denen sich diese Arbeit beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes Vorwort
- Die Humoralpathologie
- Inhaltliche Zusammenfassung der Wahnsinnsepisode im Iwein
- Die Bedeutung der Wahnsinnsepisode
- Iweins Handlungsweise vor seinem Wahnsinn
- Iweins Wahnsinn: Eine Begegnung mit dem inneren Tier
- Iweins Handlungsweise nach seinem Wahnsinn
- Abschließendes Wort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Wahnsinnsepisode in Hartmanns von Aues "Iwein". Sie untersucht die medizinischen und psychologischen Hintergründe von Iweins geistiger Umnachtung und analysiert deren Bedeutung für die Entwicklung des Helden.
- Die Rolle der Humoralpathologie in der mittelalterlichen Medizin und deren Einfluss auf die Darstellung von Wahnsinn im "Iwein"
- Die Ursachen und Folgen von Iweins Wahnsinn im Kontext des Romans
- Die Bedeutung der Wahnsinnsepisode für Iweins Identität und gesellschaftliches Ansehen
- Die Interpretation von Iweins Wahnsinn als Transformationsprozess und Katharsis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das einleitende Vorwort stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Problematik der Wahnsinnsepisode im "Iwein".
- Kapitel 2 befasst sich mit der Humoralpathologie als dominierender Krankheitslehre des Mittelalters und analysiert ihre Bedeutung für das Verständnis von Iweins Wahnsinn.
- Kapitel 3 fasst die Wahnsinnsepisode im "Iwein" inhaltlich zusammen und skizziert die Ereignisse, die zu Iweins geistiger Umnachtung führen.
- Kapitel 4 untersucht Iweins Verhaltensweise vor und nach seinem Wahnsinn und analysiert die Ursachen für seine Veränderungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen mittelalterliche Medizin, Humoralpathologie, Wahnsinn, Melancholie, Identität, gesellschaftliches Scheitern, Katharsis, Transformation, Iwein, Hartmann von Aue.
- Quote paper
- Jan Dominic Broich (Author), 2010, Iweins Wahnsinn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183819