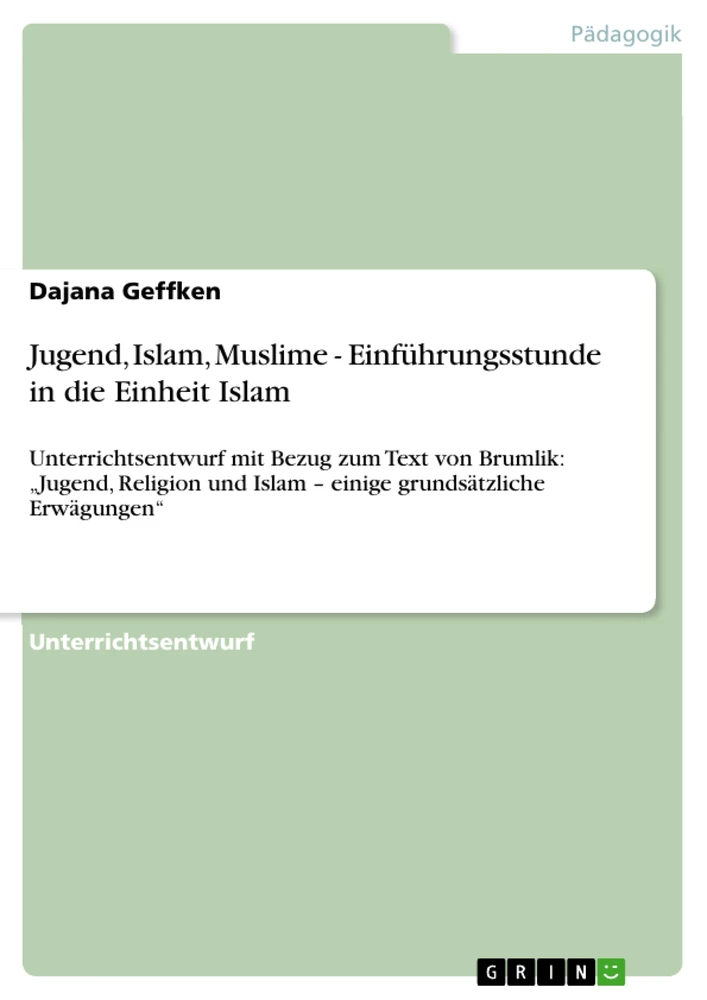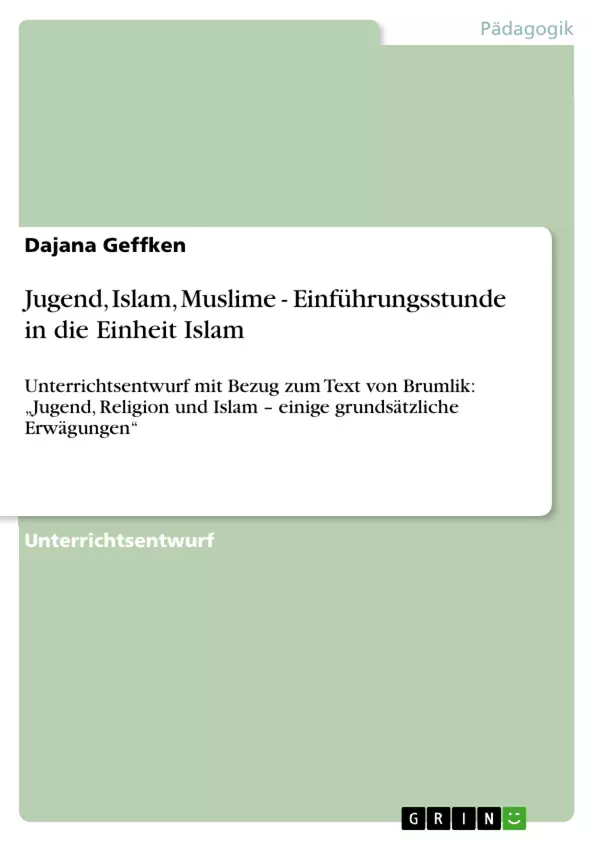Einleitung
Das Beherrschen unserer Sprache und eine umfassende Schul- und Berufsbildung sind zwei wesentliche Kriterien für die Integration, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben als Bürger mit gleichen Chancen, Rechten und Pflichten. Um künftig zugereiste Bürger besser in unsere Gemeinschaft zu integrieren, kommt unserem Bildungs- und Ausbildungssystem eine entscheidende Funktion zu. Bildung, Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt seien laut Maria Böhmer, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, wichtige Voraussetzungen, aber auch wichtige Indikatoren für die Integration.
Handlungsbedarf ist dringend erforderlich, zum einen wird dies durch die Veröffentlichung der PISA-Studien deutlich. Die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrations¬hintergrund wurde laut Bildungszentrale für politische Bildung mehrfach untermauert. Zum anderen zeigt sich dies in der Ausbildungssituation von Jugendlichen aus Zuwanderer¬familien. Sie fänden seltener Ausbildungsstellen und brächen häufiger ihre Ausbildung ab. Laut Bildungsberichte 2006 / 2007 und Bildungsbericht „Bildung in Deutschland“ haben bis zu 40 % von Jugendlichen mit Migrationshintergrund keinen Beruf erlernt.
In Deutschland leben heute ungefähr 4 Millionen Muslime. Das alltägliche Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in Deutschland gestaltet sich nicht immer als einfach. Die scheinbar friedliche Eintracht wird beinahe täglich von negativen Schlagzeilen über bedrohliche Aktionen von Islamisten überschattet. Aber auch kulturelle Traditionen und grausame Praktiken, wie sie in den islamischen Regionen gang und gäbe sind, sind uns unserem Denken unvereinbar. Als Beispiel seien hier arrangierte Ehen und Zwangsheirat, Ehrenmorde, Tod durch Steinigung , Beschneidung der Mädchen genannt. Die Beschneidung der Frau ist eine Jahrtausende alte Tradition in den islamischen Ländern. Sie werde im Koran nicht erwähnt und doch gilt sie als Sunna, als nachzuahmendes Vorbild für Mädchen und Knaben gleichermaßen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bezug zum Bildungsplan
- Aufgaben und Ziele
- Intentionen und Kompetenzen
- Bezug zum Alltag
- Micha Brumlik: Jugend, Religion und Islam – einige grundsätzliche Erwägungen
- Didaktische Analyse
- Sachdarstellung
- Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülern der Sekundarschule ein tieferes Verständnis für den Islam zu vermitteln, insbesondere im Kontext der Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft. Die Einheit soll die Schüler befähigen, ihre eigenen Vorurteile und Klischees kritisch zu hinterfragen und sich mit den vielschichtigen Aspekten des Islam auseinanderzusetzen.
- Die Bedeutung des Islam für die Integration von Muslimen in Deutschland
- Die Herausforderungen der Integration von Muslimen im Kontext von Vorurteilen und Stereotypen
- Das Verhältnis von Religion und Kultur im Islam
- Die Rolle des Islams im Leben der Menschen in Deutschland
- Die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs und der Förderung des gegenseitigen Verständnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Islam in der heutigen Gesellschaft dar und verdeutlicht die Herausforderungen der Integration von Muslimen in Deutschland. Bezugnehmend auf den Bremer Bildungsplan, werden die Aufgaben und Ziele des Unterrichtsfachs Biblische Geschichte sowie die Rolle des Islam in den verschiedenen Themenbereichen dargelegt.
Im Kapitel "Bezug zum Alltag" werden die Schwierigkeiten des Zusammenlebens verschiedener Kulturen in Deutschland beleuchtet, wobei insbesondere die Problematik von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber Muslimen hervorgehoben wird.
Der Fokus des Kapitels "Micha Brumlik: Jugend, Religion und Islam – einige grundsätzliche Erwägungen" liegt auf der Auseinandersetzung mit den Überlegungen des Religionspädagogen Micha Brumlik. In diesem Zusammenhang werden die Herausforderungen der Integration und die Notwendigkeit des gegenseitigen Verstehens zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Deutschland beleuchtet.
Die didaktische Analyse des Textes von Micha Brumlik fokussiert auf die Sachdarstellung und deren Bedeutung für die Gestaltung des Unterrichts. Das Kapitel "Fazit" bietet eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse und zeigt den Stellenwert des Themas Islam im Bildungsprozess auf.
Schlüsselwörter
Islam, Integration, Muslime, Deutschland, Religion, Kultur, Bildung, Vorurteile, Stereotype, interreligiöser Dialog, Verständnis, Zusammenleben, Micha Brumlik, Jugend, Religion, Islam, Bildungsplan, Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Muslime leben aktuell in Deutschland?
In Deutschland leben heute schätzungsweise ungefähr 4 Millionen Muslime.
Welche Rolle spielt Bildung bei der Integration von Muslimen?
Bildung und Ausbildung gelten als wesentliche Kriterien für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und als wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Integration.
Welche Thesen vertritt Micha Brumlik in diesem Kontext?
Micha Brumlik befasst sich mit den Herausforderungen der Integration und der Notwendigkeit des gegenseitigen Verstehens zwischen muslimischen Jugendlichen und der Mehrheitsgesellschaft.
Was sind die Ziele dieser Unterrichtseinheit zum Islam?
Schüler sollen Vorurteile und Klischees hinterfragen, ein tieferes Verständnis für die Religion entwickeln und zum interreligiösen Dialog befähigt werden.
Warum wird die Ausbildungssituation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund thematisiert?
Statistiken zeigen, dass bis zu 40 % dieser Jugendlichen keinen Beruf erlernen, was dringenden Handlungsbedarf im Bildungs- und Ausbildungssystem verdeutlicht.
- Citation du texte
- Dajana Geffken (Auteur), 2011, Jugend, Islam, Muslime - Einführungsstunde in die Einheit Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183847