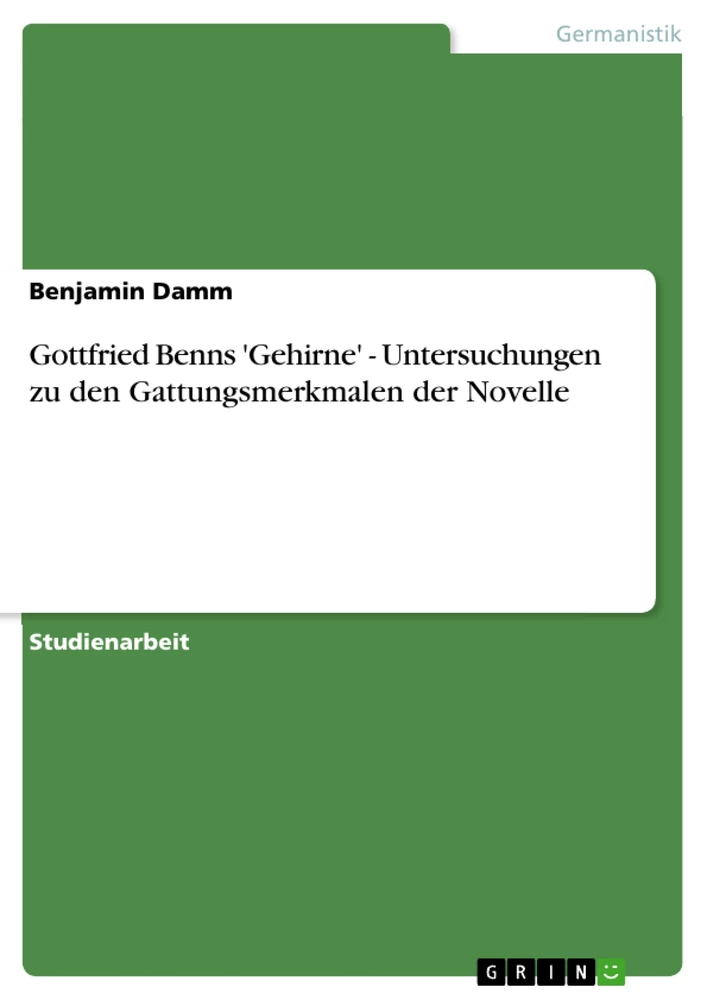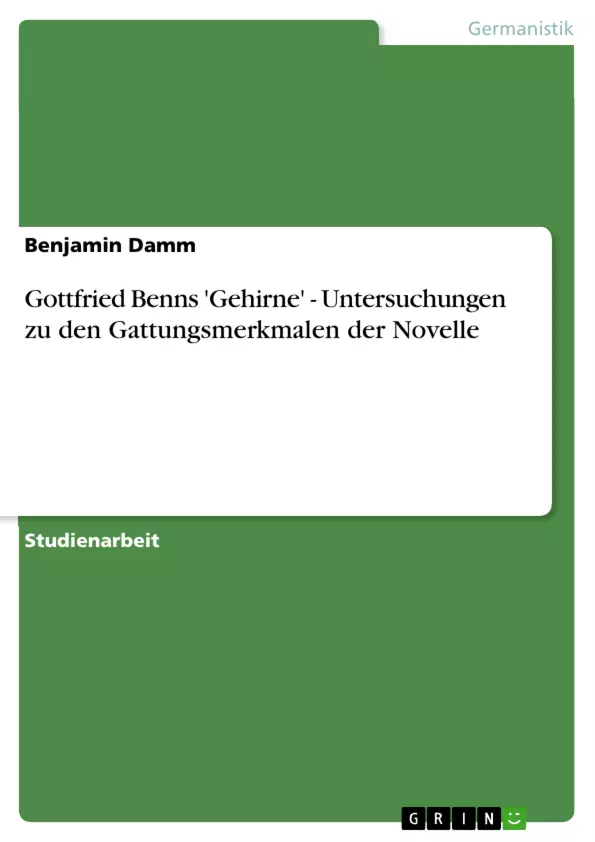Die Stiltendenzen des Expressionismus als literarische Bewegung gestalten sich vielfältig, sie reichen von der Verwendung von Stilen, die aus anderen Strömungen stammen, bis zur absoluten Neugestaltung der Ausdrucksform. Dabei liegt der Darstellungsanspruch des Expressionismus an einer Gattung in der Möglichkeit der Expression und dem Ausdruck von Gefühlen und subjektiven Ansichten. Es entsteht eine strömungsspezifische Ästhetik, die neben der Entwicklung neuer Formen eine Vorliebe für solche entwickelt hat, in denen ein solcher Ausdruck in besonderem Maße verwirklicht werden kann. .
Gottfried Benn steht dabei in der Tradition der modernen Philosophie Friedrich Nietzsches, wie auch anderer moderner Naturwissenschaften, die die Vorstellung einer Weltanschauung, die konsistent und geschlossen schien, durch ihre Entdeckungen fragwürdig machten.
Im Konsens der aufkommenden Skepsis an allgemeinen Wahrheiten ist es umso überraschender, mit welcher Aufmerksamkeit sich der Expressionismus neben neu entdeckten Formen auch den Gattungstheorien der Vergangenheit widmete.
Ein Gattungskonzept, wie das der Novelle besitzt eine lange Tradition und wird damit alles andere als dem Anspruch des Modernismus gerecht, der sich dadurch auszeichnet, dass Normen und Wertvorstellungen älterer Generationen kritisiert und verworfen werden.
Diese Arbeit möchte untersuchen, weshalb die expressionistische Programmatik, die Gottfried Benn darzustellen vermochte, vor allem in der novellistischen Form Niederschlag fand.
Die Leitfrage lautet: Inwiefern kann die expressionistische Erzählung Gehirne von Gottfried Benn als Novelle bezeichnet werden? Welche Kriterien sprechen möglichweise für die Konzeption einer Antinovelle?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Novelle als Gattung
- Probleme der Gattungstheorie der Novelle
- Merkmale einer Novelle
- Die Novelle im Spiegel der Moderne
- Analyse des Textes
- novellistische Formmerkmale in Gehirne
- Der Wendepunkt
- komprimierte und lineare Erzählform
- Objektivität
- Alltäglichkeit
- Dingsymbol
- Die expressionistische Novellistik und Benns Gehirne
- novellistische Formmerkmale in Gehirne
- Gottfried Benns Gehirne als Novelle
- Gehirne als klassische Novelle?
- Gehirne als Antinovelle
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der Novelle "Gehirne" von Gottfried Benn im Kontext der expressionistischen Literatur und der Gattungstheorie der Novelle. Ziel ist es, die expressionistische Programmatik in Benns Werk zu untersuchen und zu beleuchten, inwiefern die Novelle "Gehirne" als Vertreter dieser Strömung betrachtet werden kann. Dabei soll insbesondere die Frage geklärt werden, ob "Gehirne" als klassische Novelle oder als Antinovelle einzuordnen ist.
- Die expressionistische Programmatik in Benns Werk
- Die Gattungstheorie der Novelle und ihre Anwendung auf "Gehirne"
- Die Merkmale der klassischen Novelle und ihre Abweichungen in "Gehirne"
- Die Frage nach der Einordnung von "Gehirne" als Antinovelle
- Die Bedeutung von "Gehirne" im Kontext der expressionistischen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Leitfrage nach der Einordnung von "Gehirne" als Novelle vor. Sie beleuchtet die expressionistische Programmatik und die Bedeutung der Gattungstheorie der Novelle im Kontext der modernen Literatur.
Das zweite Kapitel widmet sich der Gattungstheorie der Novelle und beleuchtet die Probleme, die mit der Definition dieser Gattung verbunden sind. Es werden die wichtigsten Merkmale der Novelle vorgestellt, die in der Literaturforschung diskutiert werden, und es wird deutlich gemacht, dass die Novelle als eine Gattung ohne feste Poetik betrachtet werden kann.
Das dritte Kapitel untersucht die Novelle im Kontext der modernen Lebensumstände und beleuchtet die Bedeutung der Gattung im Spiegel der Moderne. Es werden die Veränderungen in der Gesellschaft und in der Literatur im frühen 20. Jahrhundert betrachtet und die Auswirkungen auf die Gattung der Novelle diskutiert.
Das vierte Kapitel analysiert den Text "Gehirne" von Gottfried Benn und untersucht die novellistischen Formmerkmale, die in diesem Werk zum Ausdruck kommen. Es werden die Merkmale des Wendepunkts, der komprimierten und linearen Erzählform, der Objektivität, der Alltäglichkeit und des Dingsymbols analysiert und in Bezug auf die expressionistische Programmatik gesetzt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Frage, inwiefern "Gehirne" als klassische Novelle oder als Antinovelle bezeichnet werden kann. Es werden die Merkmale der klassischen Novelle und die Abweichungen in "Gehirne" gegenübergestellt und die Einordnung des Textes im Kontext der expressionistischen Literatur diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die expressionistische Literatur, die Gattungstheorie der Novelle, die Novelle "Gehirne" von Gottfried Benn, die Merkmale der klassischen Novelle, die Antinovelle, der Wendepunkt, die komprimierte und lineare Erzählform, die Objektivität, die Alltäglichkeit, das Dingsymbol und die expressionistische Programmatik.
Häufig gestellte Fragen
Kann Gottfried Benns „Gehirne“ als klassische Novelle bezeichnet werden?
Die Arbeit untersucht dies kritisch. Während formale Merkmale wie der Wendepunkt vorhanden sind, spricht die expressionistische Auflösung traditioneller Strukturen eher für eine Antinovelle.
Welche Rolle spielt der Expressionismus in diesem Werk?
Der Expressionismus zeigt sich in der subjektiven Ausdrucksform, der Darstellung von Gefühlen und der Skepsis gegenüber einer geschlossenen, konsistenten Weltanschauung.
Was ist ein Dingsymbol in der Novellentheorie?
Ein Dingsymbol ist ein konkreter Gegenstand, der sich durch die Erzählung zieht und eine tiefere, oft schicksalhafte Bedeutung für die Handlung hat.
Inwiefern beeinflusste Nietzsche Gottfried Benn?
Nietzsches Philosophie der Skepsis an allgemeinen Wahrheiten und die Infragestellung alter Normen prägten Benns modernistische Herangehensweise an Literatur und Gattungen.
Was ist der „Wendepunkt“ in Benns Erzählung?
Die Analyse untersucht, ob und wo in der komprimierten Erzählform von „Gehirne“ eine unerwartete Kehrtwendung der Handlung stattfindet, die typisch für die Novelle ist.
- Quote paper
- Benjamin Damm (Author), 2011, Gottfried Benns 'Gehirne' - Untersuchungen zu den Gattungsmerkmalen der Novelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183868