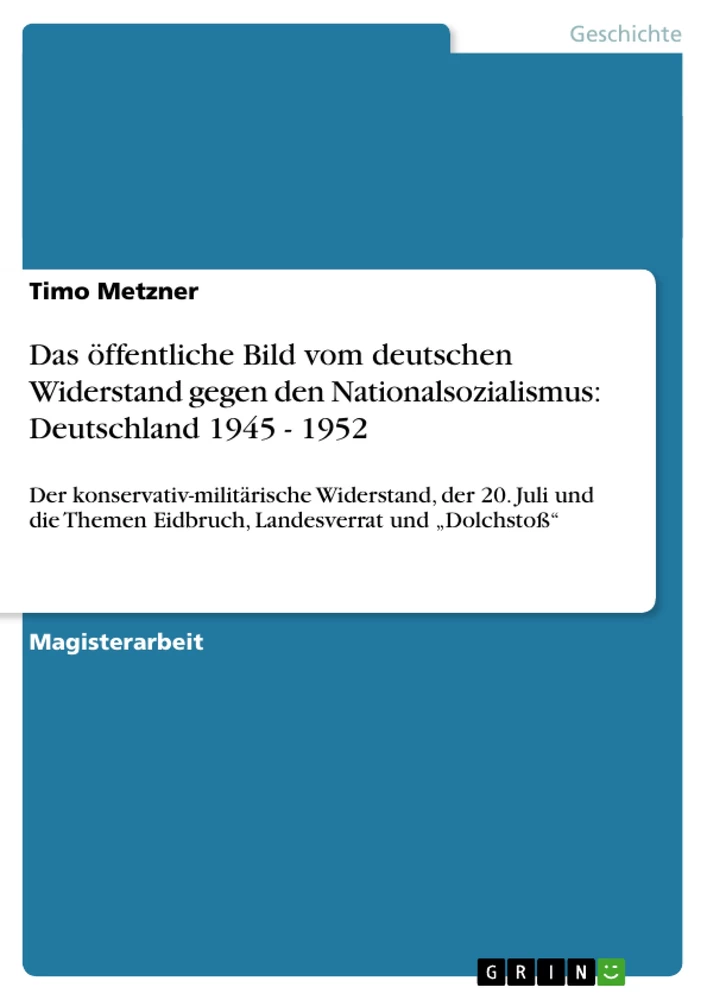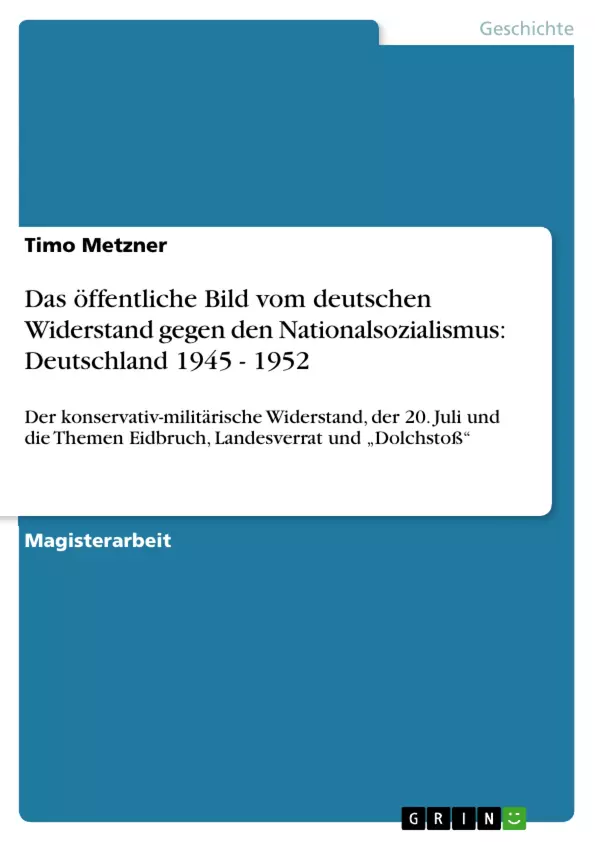Am Mittag des 20. Juli 1944 legte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg seine Aktentasche mit der Bombe unter den massiven Holztisch der Baracke im Führerhauptquartier, in der an diesem Tag die Lagebesprechung stattfand. Er ließ sich mittels eines Telefonanrufes hinausbitten und wartete die Explosion ab. Als die Bombe detoniert war, begab er sich mit seinem Adjutanten Hans Bernd von Haeften auf dem schnellsten Weg nach Berlin, um nach dem Tod des „Führers“ einen Staatsstreich, gelenkt durch die eigens dafür entwickelte Befehlskette des Notfallplanes „Walküre“, durchzuführen.
Kurz nach Mitternacht wandte sich Adolf Hitler an das deutsche Volk, um diesem mitzuteilen, dass er einem Schicksal entgangen sei, „das nicht für mich Schreckliches in sich barg, sondern das den Schrecken für das deutsche Volk gebracht hätte“. Er dankte „der Vorsehung und meinem Schöpfer“, dass er in seiner „Arbeit“ weiter fortfahren könne.
In dieser Arbeit soll das Bild vom konservativ-militärischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus untersucht werden, wie es Autoren verschiedener Couleur in den Jahren 1945-1952 zeichneten. Dabei kommt den Kontroversen, die sich um das Thema rankten, eine besondere Bedeutung zu. Denn in ihnen zeigt sich, welche Aspekte einerseits als besonders legitimationsbedürftig und andererseits als besonders geeignet für dieses Unterfangen eingeschätzt wurden. Das erste Ziel musste sein, überhaupt die Existenz eines deutschen Widerstandes in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen – eine Tatsache, die immer wieder von Autoren beklagt wurde.
Als Symbol für den (umstrittenen) Widerstand kristallisierte sich bereits früh die Verschwörung vom 20. Juli 1944 heraus. Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage: Wie versuchten Autoren für die Verbreitung eines positiven Bildes vom Widerstand in der deutschen Öffentlichkeit zu sorgen und welchen Hindernissen mussten sie dabei entgegentreten? Welches Bild wurde in den frühen Standardwerken entworfen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Forschungsstand und Quellenlage
- 1.2.1 Forschungsstand
- 1.2.2 Quellenlage
- 2. Autobiographische Texte
- 2.1 von Schlabrendorff: „Zehn Gerechte“ für Deutschland
- 2.2 von Hassell: „Das andere Deutschland“
- 2.3 Gisevius: „So... geht... es... nicht!“
- 3. Der 20. Juli in Gesamtdarstellungen und Aufsätzen
- 3.1 Pechel: Die „Vielfalt“ innerhalb des Widerstandes und der 20. Juli
- 3.2 Rothfels: Der 20. Juli in universalgeschichtlicher Perspektive
- 3.3 Zeller: Der Held Stauffenberg
- 3.4 Meinecke: Wider die moralische Katastrophe
- 3.5 Strölin: Gegen eine neue „Dolchstoßlüge“
- 4. Die „Gegenseite“
- 4.1 Otto Ernst Remer: Der „Eidtreue“
- 4.2 Die Zeitschrift „Nation Europa“: Die ewig Gestrigen’
- 4.2.1 Die geschichtliche Hypothek des Eidbruches
- 4.2.2 Verrat und „Dolchstoß“ als Mittel und Zweck
- 5. Der „Remer-Prozess“: Ein Freispruch für den 20. Juli
- 5.1 Bauers Plädoyer: Das „Dritte Reich“ als „Unrechtsstaat“
- 5.2 Die Gutachten: Wissenschaftliche Expertisen über moralisches Verhalten
- 5.2.1 Die Moraltheologen: Widerstand als Recht und moralische Pflicht
- 5.2.2 Der militärische Sachverständige: Die Einmaligkeit des erlaubten Eidbruches
- 5.2.3 Der Sachverständige für die Motive: Das gute Gewissen Deutschlands
- 5.2.4 Der historische Sachverständige: Die militärische Lage und der „Dolchstoß“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des konservativ-militärischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in den Jahren 1945-1952. Im Fokus steht die Analyse der Kontroversen um den Widerstand und die Strategien zur Legitimation bzw. Delegitimation der beteiligten Akteure. Die Arbeit beleuchtet, wie das öffentliche Bild des Widerstandes konstruiert und beeinflusst wurde.
- Das öffentliche Bild des deutschen Widerstandes nach 1945
- Die Kontroversen um den 20. Juli und die Begriffe Eidbruch, Landesverrat und „Dolchstoß“
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Widerstand (Widerstandskämpfer vs. Gegner des Widerstandes)
- Die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung
- Die juristische Aufarbeitung des Widerstandes (am Beispiel des Remer-Prozesses)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des öffentlichen Bildes vom deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den Jahren 1945-1952 ein. Sie beschreibt den historischen Kontext, die Fragestellung der Arbeit und den Forschungsstand. Besonders hervorgehoben wird die Schwierigkeit, die Existenz des Widerstandes in das öffentliche Bewusstsein zu bringen angesichts der weitverbreiteten Zustimmung zum NS-Regime und der Propaganda. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende Analyse der unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungen des Widerstandes.
2. Autobiographische Texte: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte autobiographische Texte von Widerstandskämpfern (Schlabrendorff, Hassell, Gisevius). Es untersucht, wie diese Autoren ihre Erfahrungen und Motive darstellten und welche Aspekte sie betonten, um ein bestimmtes Bild vom Widerstand zu schaffen. Die Analyse beleuchtet die Strategien der Selbstlegitimation und die Herausforderungen, mit denen die Autoren konfrontiert waren. Es wird die jeweilige Perspektive und die individuelle Deutung der Ereignisse betrachtet.
3. Der 20. Juli in Gesamtdarstellungen und Aufsätzen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Darstellungen des 20. Juli aus der Zeit zwischen 1945 und 1952. Es untersucht, wie Historiker und Publizisten das Attentat und den Widerstand interpretierten, welche Aspekte sie hervorhoben und welche sie vernachlässigten. Die Analyse zeigt die Vielfalt der Perspektiven und die unterschiedlichen Deutungsmuster, die sich in Abhängigkeit von den jeweiligen politischen und ideologischen Hintergründen ergaben. Es wird die Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung des 20. Juli beleuchtet.
4. Die „Gegenseite“: Im Gegensatz zu Kapitel 3 wird hier die Perspektive derjenigen betrachtet, die den Widerstand ablehnten. Die Analyse fokussiert auf die Gegenpositionen, insbesondere auf die Darstellung des Widerstandes durch Otto Ernst Remer und die Zeitschrift „Nation Europa“. Das Kapitel zeigt, wie die „Gegenseite“ den Widerstand als Verrat und „Dolchstoß“ darstellte und welche Strategien sie zur Diskreditierung der Widerstandskämpfer einsetzte. Die Analyse der ideologischen Begründungen und der propagandistischen Methoden steht im Vordergrund.
5. Der „Remer-Prozess“: Dieses Kapitel untersucht den Prozess gegen Otto Ernst Remer und dessen Bedeutung für die öffentliche Wahrnehmung des Widerstandes. Es analysiert das Plädoyer des Anwalts und die Gutachten, die im Prozess vorgebracht wurden. Der Fokus liegt auf der juristischen und moralischen Auseinandersetzung mit der Frage des Widerstands und der Legitimität von Eidbruch und Landesverrat. Die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente der Beteiligten werden detailliert dargestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Deutscher Widerstand, Nationalsozialismus, 20. Juli, Eidbruch, Landesverrat, „Dolchstoß“, öffentliches Bild, Nachkriegszeit, Autobiographie, Historiographie, Meinungsforschung, Remer-Prozess, Legitimation, Moral
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das öffentliche Bild des deutschen Widerstandes 1945-1952
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des konservativ-militärischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in der Zeit von 1945 bis 1952. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Kontroversen um den Widerstand und die Strategien zur Legitimation bzw. Delegitimation der beteiligten Akteure. Es wird beleuchtet, wie das öffentliche Bild des Widerstandes konstruiert und beeinflusst wurde.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf verschiedenen Quellen, darunter autobiographische Texte von Widerstandskämpfern (z.B. Schlabrendorff, Hassell, Gisevius), Gesamtdarstellungen und Aufsätze zum 20. Juli, Darstellungen der „Gegenseite“ (z.B. Otto Ernst Remer, „Nation Europa“) und die Dokumente des Remer-Prozesses. Die Arbeit analysiert somit verschiedene Perspektiven auf den Widerstand und die Kontroversen um ihn.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das öffentliche Bild des deutschen Widerstandes nach 1945; die Kontroversen um den 20. Juli und die Begriffe Eidbruch, Landesverrat und „Dolchstoß“; die unterschiedlichen Perspektiven auf den Widerstand (Widerstandskämpfer vs. Gegner des Widerstandes); die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung; und die juristische Aufarbeitung des Widerstandes (am Beispiel des Remer-Prozesses).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Fragestellung, Forschungsstand), Autobiographische Texte von Widerstandskämpfern, Der 20. Juli in Gesamtdarstellungen und Aufsätzen, Die „Gegenseite“ (Gegner des Widerstandes), und Der „Remer-Prozess“. Jedes Kapitel analysiert unterschiedliche Perspektiven und Darstellungen des Widerstandes.
Was wird in den einzelnen Kapiteln analysiert?
Kapitel 1 bietet eine Einleitung und beschreibt den historischen Kontext. Kapitel 2 analysiert autobiographische Texte von Widerstandskämpfern. Kapitel 3 untersucht verschiedene Darstellungen des 20. Juli. Kapitel 4 analysiert die Perspektiven der Gegner des Widerstandes. Kapitel 5 untersucht den Remer-Prozess und dessen Bedeutung für die öffentliche Wahrnehmung des Widerstandes.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, wie das öffentliche Bild des deutschen Widerstandes nach dem Krieg konstruiert und beeinflusst wurde und wie die verschiedenen Akteure den Widerstand legitimierten oder delegitimierten. Die Analyse der unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungen zeigt die Komplexität der Debatte um den Widerstand und seine Bewertung in der Nachkriegszeit. Die Ergebnisse basieren auf der Analyse der unterschiedlichen Quellen und deren Interpretationen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Widerstand, Nationalsozialismus, 20. Juli, Eidbruch, Landesverrat, „Dolchstoß“, öffentliches Bild, Nachkriegszeit, Autobiographie, Historiographie, Meinungsforschung, Remer-Prozess, Legitimation, Moral.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Timo Metzner (Autor:in), 2007, Das öffentliche Bild vom deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Deutschland 1945 - 1952, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183883