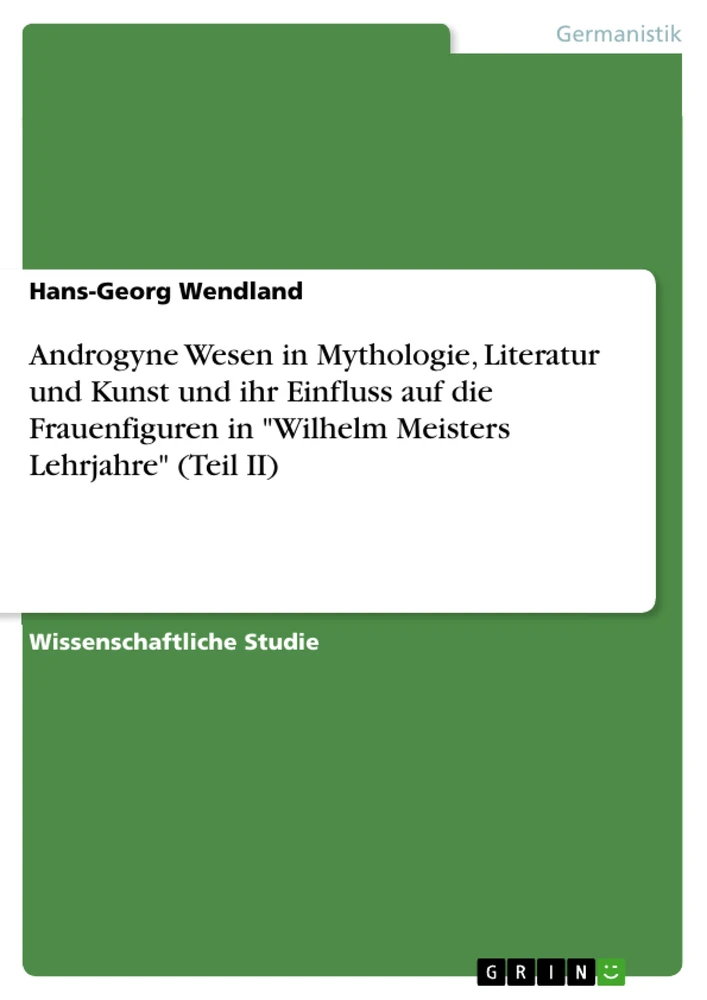Dieses Kapitel knüpft an den ersten Teil der Untersuchung an, in dem bereits die Frauenfiguren der Mariane, der Chlorinde aus Tassos "Das Befreite Jerusalem" und der Stratonike aus dem "Bild vom Kranken Königssohn" behandelt worden sind.
Zunächst werden zwei Kontrastfiguren vorgestellt, auf deren Hintergrund die bereits behandelten und die folgenden Figuren mehr Profil und größere Tiefenschärfe gewinnen. Dabei geht es immer um die Frage, welchen Einfluss sie auf Wilhelm ausüben und inwieweit sie
zu seiner Entwicklung beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Androgyne Frauen und ihre Kontrastfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre (Fortsetzung)
- Philine, die wahre Eva, als Kontrastfigur
- Narciß: Publikumsliebling, Herzensbrecher und gekränkter Egoist
- Mignon, das rätselhafte Mischwesen
- Aurelie: Hypochonder oder Amazone?
- Therese, die wahre Amazone
- Natalie, die schöne Amazone
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Rolle androgyner Figuren in der Mythologie, Literatur und Kunst und analysiert ihren Einfluss auf die Frauenfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre. Insbesondere geht es darum, die Kontrastfiguren und ihre Beziehungen zu Wilhelm Meister zu beleuchten, um so seine Entwicklung als Protagonist zu erforschen.
- Das Konzept der Androgynie und seine Bedeutung in der Literatur
- Die verschiedenen Typen von Frauenfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Der Einfluss von Kontrastfiguren auf Wilhelms Entwicklung
- Die Rolle von Weiblichkeit und Männlichkeit in Wilhelms Beziehungen
- Die Grenzen und Konflikte in den Beziehungen zwischen Mann und Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text behandelt verschiedene weibliche Figuren in Wilhelm Meisters Lehrjahre und analysiert sie als Kontrastfiguren zu anderen Frauenfiguren im Roman. Das Kapitel "Philine, die wahre Eva, als Kontrastfigur" erörtert die Rolle der verführerischen Philine als Gegenbild zu den amazonenhaften Frauenfiguren im Roman. Sie verkörpert die sinnlich-natürliche Weiblichkeit, die Wilhelm entgegentritt. Das Kapitel "Narciß: Publikumsliebling, Herzensbrecher und gekränkter Egoist" widmet sich der Figur des Narciß und seinem weiblichen Pendant Landrinette. Durch die Episode mit dem Seiltänzerpaar wird Wilhelms Empfänglichkeit für die Kunststücke Mignons vorbereitet, die sich ebenfalls im Schwebezustand zwischen weiblicher Sinnlichkeit und undefinierbarer Geschlechtlichkeit befindet.
Schlüsselwörter
Androgynie, Frauenfiguren, Kontrastfiguren, Wilhelm Meister, Lehrjahre, Philine, Narciß, Mignon, Weiblichkeit, Männlichkeit, verführerisch, Amazonen, Seiltänzer, Beziehung, Entwicklung, Konflikt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Androgynie in Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre"?
Androgynie bezieht sich auf Figuren, die Merkmale beider Geschlechter vereinen oder sich in einem Schwebezustand zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit befinden, wie etwa Mignon.
Wer ist Philine und welche Rolle spielt sie als Kontrastfigur?
Philine verkörpert die sinnlich-natürliche Weiblichkeit und dient als Gegenbild zu den eher heroischen oder amazonenhaften Frauenfiguren des Romans.
Was charakterisiert die Figur der Mignon?
Mignon wird als rätselhaftes Mischwesen beschrieben, deren undefinierbare Geschlechtlichkeit und künstlerische Natur Wilhelm Meister stark beeinflussen.
Wer sind die "Amazonen" im Roman?
Therese und Natalie werden als "schöne Amazonen" bezeichnet, die eine starke, unabhängige und oft moralisch überlegene Form der Weiblichkeit darstellen.
Wie beeinflussen diese Frauenfiguren Wilhelms Entwicklung?
Jede Figur fordert Wilhelm in seinen Ansichten über Liebe, Kunst und gesellschaftliche Rollen heraus und trägt so zu seinem Reifeprozess bei.
- Citar trabajo
- Hans-Georg Wendland (Autor), 2011, Androgyne Wesen in Mythologie, Literatur und Kunst und ihr Einfluss auf die Frauenfiguren in "Wilhelm Meisters Lehrjahre" (Teil II), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183951