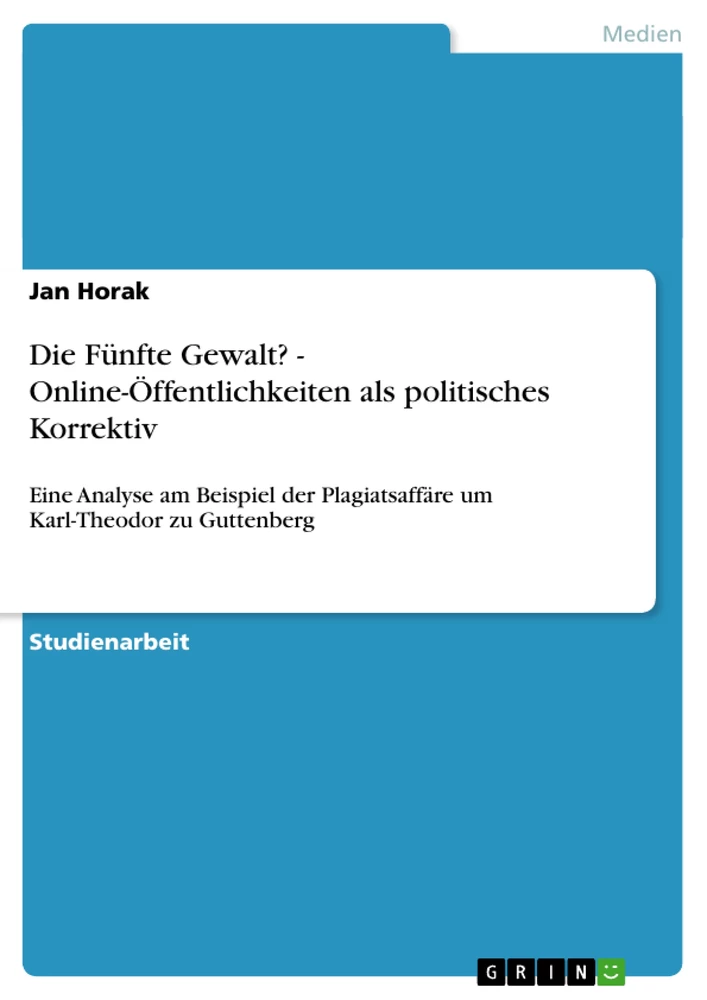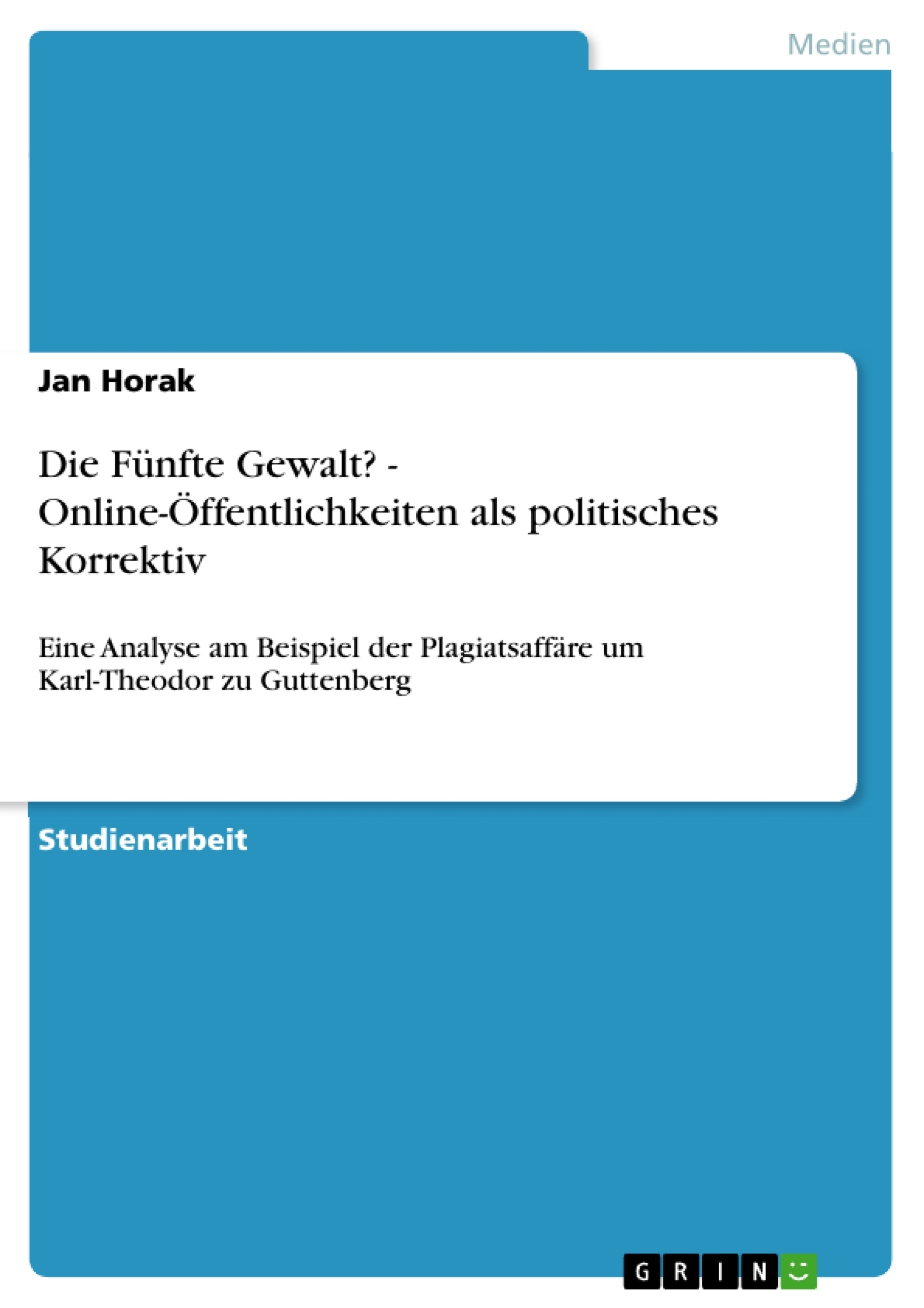Mit der Erschließung neuer Kommunikationsräume im Netz ist in den letzten Jahren ein schier unüberblickbares Feld an Onlinemedien1 unterschiedlichster Strukturen und Erscheinungsformen entstanden. Onlinemedien haben innerhalb gesellschaftlicher und politischer Diskurse rasch an Bedeutung gewonnen, konkurrieren mit den traditionellen journalistischen Akteuren massenmedialer Öffentlichkeit um Inhalte und Aufmerksamkeit und beanspruchen ebenfalls die Rolle eines 'Watchdogs' für sich. Auf diese Weise ist im Netz eine Form von Gegen öffentlichkeit entstanden, deren Akteure sich zwar in Teilen auch der Kommunikationsinstrumente massenmedialer Öffentlichkeit bedienen, die sich bezüglich ihrer Zugänglichkeit, ihrer Funktionsweise und ihres Handlungsrahmens allerdings deutlich von eben jener unterscheidet.
Im Rahmen dieser Arbeit soll dargelegt werden, wie sich das diffuse Konstrukt der 'Online-Öffentlichkeit' theoretisch fassen lässt, inwiefern partizipative Netzöffentlichkeiten von den bekannten Formen massenmedialer Öffentlichkeit differenziert werden können und welche Rolle sie im politischen Prozess einnehmen. Veranschaulichen lässt sich dies sehr gut am Beispiel der Affäre umden ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, welcher
im Frühjahr 2011 aufgrund der Enttarnung seiner Dissertationsarbeit als Plagiat durch die Nutzer der Onlineplattform GuttenPlag von seinem Amt zurücktreten musste. Anhand des 'Falls Guttenberg' lässt sich zum einen das deliberative Potential partizipativer Online-(Teil-)Öffentlichkeiten aufzeigen, zum anderen lassen sich Rückschlüsse auf die Handlungsgrenzen traditioneller Massenmedien
ziehen. Bei der Analyse soll es deshalb primär um die Frage gehen,
ob sich Onlinemedien ebenfalls der 'vierten Gewalt' zuordnen lassen, oder ob sie möglicherweise sogar eine Vorreiterrolle in demokratischen Deliberations-, Entscheidungs- und Kontrollprozessen einnehmen können, die sie qualitativ von den Vertretern der 'vierten Gewalt' unterscheidbar macht - in diesem Fall erschiene es legitim, von Online-Öffentlichkeit als 'fünfter Gewalt' zu sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung und Problemstellung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Medien als „vierte Gewalt“
- 2.2 Online-Öffentlichkeit(en) als Gegenöffentlichkeit
- 3. Der Fall Karl-Theodor zu Guttenberg
- 3.1 Karl-Theodor zu Guttenberg und die Medien
- 3.2 Die Boulevard-Zeitung BILD
- 3.3 Die Internetplattform GuttenPlag
- 3.4 Chronologie des Scheiterns
- 3.5 Zwischenfazit
- 4. Online-Öffentlichkeit(en) als fünfte Gewalt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Online-Öffentlichkeiten im politischen Prozess, insbesondere im Hinblick auf ihre Funktion als mögliches Korrektiv gegenüber traditionellen Machtstrukturen. Sie analysiert, inwieweit Online-Medien die etablierte „vierte Gewalt“ ergänzen oder sogar ersetzen können. Der Fall Guttenberg dient als Fallbeispiel.
- Die Rolle der Medien als „vierte Gewalt“ im demokratischen System
- Die Entstehung und Charakteristika von Online-Öffentlichkeiten
- Der Vergleich zwischen traditionellen und Online-Medien in Bezug auf politische Meinungsbildung und Kontrolle
- Das deliberative Potenzial partizipativer Online-Öffentlichkeiten
- Die Frage nach der „fünften Gewalt“ im Kontext von Online-Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung und Problemstellung: Die Einleitung skizziert die traditionelle Rolle der Presse als „vierte Gewalt“ und deren Bedeutung für demokratische Prozesse. Sie führt den Begriff der Online-Öffentlichkeit ein und betont deren wachsende Bedeutung im politischen Diskurs. Der Fall Guttenberg wird als Fallbeispiel vorgestellt, um die Rolle von Online-Medien in der politischen Kontrolle zu untersuchen und die Frage nach einer potentiellen „fünften Gewalt“ zu beleuchten. Die Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen von Online-Öffentlichkeiten zu erforschen und deren Einfluss auf politische Prozesse zu analysieren.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel untersucht den theoretischen Hintergrund. Es beschreibt die Medien als "vierte Gewalt" und deren Funktion in der demokratischen Gesellschaft. Es analysiert die verschiedenen Funktionen der Massenmedien wie Informationsvermittlung, politische Meinungsbildung, und die Kontrolle politischer Entscheidungen. Des Weiteren werden Online-Öffentlichkeiten als Gegenöffentlichkeiten mit besonderen Eigenschaften im Vergleich zu traditionellen Massenmedien dargestellt. Der Unterschied in der Zugänglichkeit, Funktionsweise und Handlungsrahmen wird herausgearbeitet.
3. Der Fall Karl-Theodor zu Guttenberg: Dieses Kapitel analysiert detailliert den Fall Guttenberg. Es beleuchtet die Rolle der Medien, insbesondere von BILD und der Online-Plattform GuttenPlag, bei der Aufdeckung des Plagiats. Die Chronologie des Ereignisses wird nachgezeichnet und die Bedeutung der Online-Öffentlichkeit für die Enthüllung und die Folgen für Guttenberg werden herausgestellt. Das Zwischenfazit dieses Kapitels zieht eine erste Bilanz über die Rolle von traditionellen und Online-Medien in diesem Fall.
Schlüsselwörter
Online-Öffentlichkeit, vierte Gewalt, fünfte Gewalt, politische Meinungsbildung, Massenmedien, Onlinemedien, partizipative Medien, Gegenöffentlichkeit, Politische Kontrolle, Fall Guttenberg, Deliberation, Demokratie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Falls Guttenberg und die Rolle von Online-Öffentlichkeiten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Online-Öffentlichkeiten im politischen Prozess und analysiert, inwieweit sie als Korrektiv gegenüber traditionellen Machtstrukturen fungieren. Der Fall Guttenberg dient als Fallbeispiel, um den Vergleich zwischen traditionellen und Online-Medien in Bezug auf politische Meinungsbildung und Kontrolle zu beleuchten und die Frage nach einer möglichen „fünften Gewalt“ zu diskutieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Medien als „vierte Gewalt“, die Entstehung und Charakteristika von Online-Öffentlichkeiten, den Vergleich zwischen traditionellen und Online-Medien, das deliberative Potenzial partizipativer Online-Öffentlichkeiten und die Frage nach der „fünften Gewalt“ im Kontext von Online-Medien. Im Detail wird der Fall Guttenberg analysiert, insbesondere die Rolle von BILD und GuttenPlag.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der Medien als „vierte Gewalt“ und analysiert die Funktionen von Massenmedien (Informationsvermittlung, Meinungsbildung, politische Kontrolle). Sie beschreibt Online-Öffentlichkeiten als Gegenöffentlichkeiten mit spezifischen Eigenschaften im Vergleich zu traditionellen Medien, hinsichtlich Zugänglichkeit, Funktionsweise und Handlungsrahmen.
Wie wird der Fall Guttenberg analysiert?
Der Fall Guttenberg wird detailliert untersucht, mit Fokus auf die Rolle der Medien (BILD und GuttenPlag) bei der Aufdeckung des Plagiats. Die Chronologie des Ereignisses wird nachgezeichnet und die Bedeutung der Online-Öffentlichkeit für die Enthüllung und die Folgen für Guttenberg werden herausgestellt. Ein Zwischenfazit bewertet die Rolle traditioneller und Online-Medien in diesem Fall.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Online-Öffentlichkeit, vierte Gewalt, fünfte Gewalt, politische Meinungsbildung, Massenmedien, Onlinemedien, partizipative Medien, Gegenöffentlichkeit, politische Kontrolle, Fall Guttenberg, Deliberation, Demokratie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung mit Problemstellung, einen theoretischen Hintergrund, die detaillierte Analyse des Falls Guttenberg und ein Kapitel, das die Frage nach Online-Öffentlichkeiten als „fünfte Gewalt“ diskutiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen von Online-Öffentlichkeiten zu erforschen und deren Einfluss auf politische Prozesse zu analysieren. Sie untersucht die Rolle von Online-Medien in der politischen Kontrolle und die Frage, ob und wie sie die etablierte „vierte Gewalt“ ergänzen oder ersetzen können.
- Quote paper
- Jan Horak (Author), 2011, Die Fünfte Gewalt? - Online-Öffentlichkeiten als politisches Korrektiv, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183963