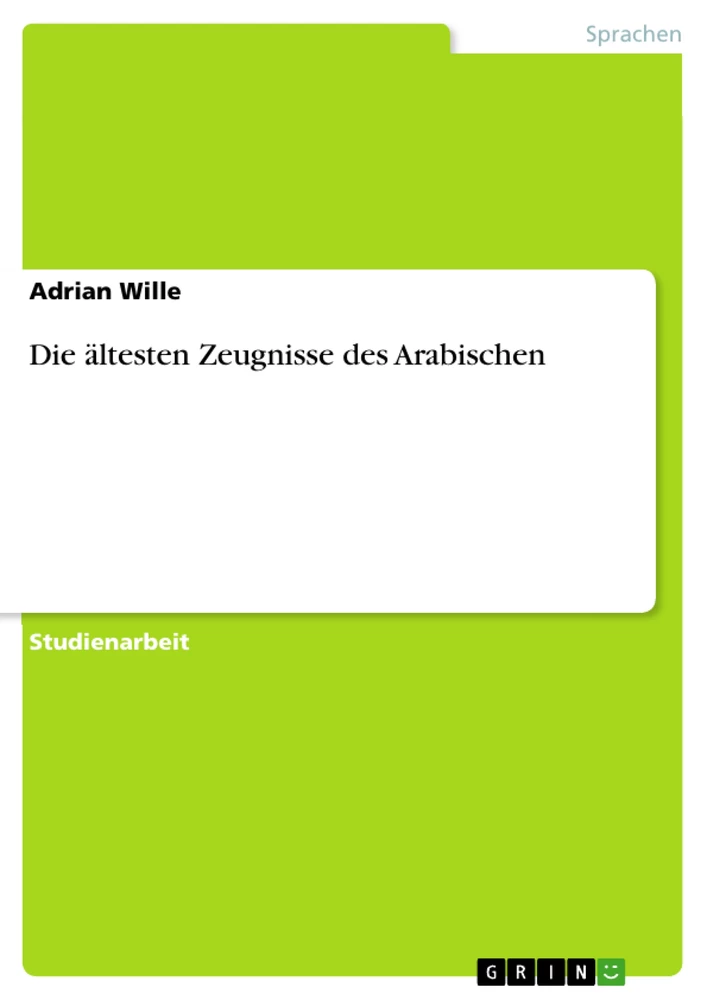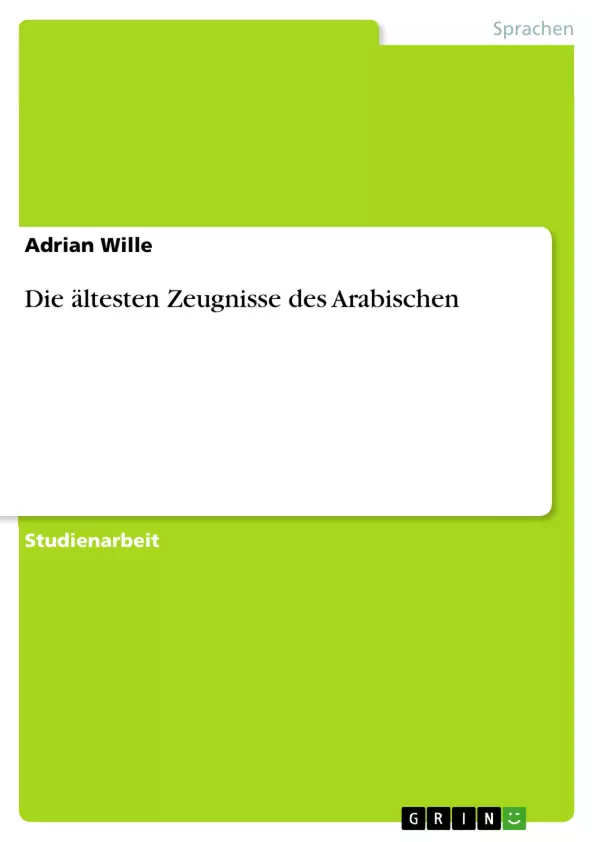Stolz auf die eigene Abstammung war schon immer von großer Bedeutung gewesen. Völker haben seit Menschengedenken ihren Machtanspruch mit deren glorreicher Vergangenheit begründet. Auch heute hat jeder etwas, auf das er vermeintlich stolz sein kann: Die Amerikaner haben ihren „Melting Pot“, das Vereinigte Königreich sein „Commonwealth“ und die Deutschen ihre Dichter und Denker. Ein Äquivalent der arabischen Staaten ist sicherlich der Islam, auf dessen Geschichte selbstbewusst zurückgeblickt wird. Mit dem Koran eng zusammenhängend, agiert die arabische Sprache als identifikationsstiftendes Element. Versucht man jedoch die Wurzel des Arabischen weiter in die vorislamische Zeit zurück zu verfolgen, stößt man auf Schwierigkeiten.
Diese Arbeit nimmt sich daher vor, die frühesten Zeugnisse des Arabischen zu beleuchten. Untersucht wird die Herkunft eines Volkes der Araber und dessen Wirken. Folgend wir die Entstehung der arabischen Sprache anhand von sechs Inschriftengruppen analysiert, die in die „Frühnordarabischen Inschriften“ und die „Aramäischen Inschriften“ unterteilt werden. Nach der Erläuterung der Entstehung der arabischen Schrift werden exemplarisch die Inschriften von „An-Namāra“ und „ʿEn ʿAvdat“ genauer auf arabische Elemente hin untersucht. Ein Fazit fasst die wichtigsten Fakten der „Ältesten Zeugnisse des Arabischen“ zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Die Araber
- III. Die arabische Sprache
- 1. Einführung
- 2. Frühnordarabische Inschriften
- a) Thamūdische Inschriften
- b) Liḥyānische Inschriften
- c) Şafa'itische Inschriften
- d) Ḥasa'itische Inschriften
- 3. Aramäische Inschriften
- a) Palmyrische Inschriften
- b) Nabatäische Inschriften
- IV. Die Arabische Schrift
- V. Bedeutende Inschriften
- 1. Die Inschrift von An-Namāra
- 2. Die Inschrift von 'En 'Avdat
- VI. Fazit
- - Abbildungsverzeichnis
- - Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den frühesten Zeugnissen der arabischen Sprache und Kultur. Sie untersucht die Herkunft des arabischen Volkes und die Entstehung der arabischen Sprache anhand von Inschriften aus der vorislamischen Zeit. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Inschriftengruppen, die Entwicklung der arabischen Schrift und beleuchtet exemplarisch zwei bedeutende Inschriften. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der frühen arabischen Kultur und Sprache zu vermitteln.
- Herkunft und Entwicklung des arabischen Volkes
- Entstehung und Entwicklung der arabischen Sprache
- Analyse von Inschriften aus der vorislamischen Zeit
- Die arabische Schrift
- Bedeutung und Einfluss der arabischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der eigenen Abstammung für verschiedene Völker. Es wird die Schwierigkeit aufgezeigt, die Wurzeln des Arabischen in der vorislamischen Zeit zu erforschen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Besiedlung der arabischen Halbinsel und der Entstehung des Begriffs "Araber". Es werden verschiedene Quellen und historische Ereignisse beleuchtet, die Aufschluss über die frühen Araber geben.
Das dritte Kapitel analysiert die Entstehung der arabischen Sprache anhand von sechs Inschriftengruppen. Es werden die "Frühnordarabischen Inschriften" und die "Aramäischen Inschriften" genauer betrachtet.
Das vierte Kapitel widmet sich der Entwicklung der arabischen Schrift.
Das fünfte Kapitel untersucht exemplarisch die Inschriften von "An-Namāra" und "En 'Avdat" auf arabische Elemente.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die frühesten Zeugnisse des Arabischen, die Herkunft der Araber, die Entstehung der arabischen Sprache, die Analyse von Inschriften, die arabische Schrift, die Inschriften von An-Namāra und 'En 'Avdat sowie die Bedeutung der arabischen Kultur in der vorislamischen Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die ältesten Zeugnisse der arabischen Sprache?
Dazu zählen vorislamische Inschriften, wie die von An-Namāra und ʿEn ʿAvdat, sowie frühnordarabische und aramäische Inschriftengruppen.
Wie entwickelte sich die arabische Schrift?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung aus aramäischen Vorläufern, insbesondere der nabatäischen Schrift, hin zur heutigen arabischen Kursive.
Was versteht man unter frühnordarabischen Inschriften?
Hierzu gehören thamūdische, liḥyānische, şafa'itische und ḥasa'itische Inschriften, die Aufschluss über die frühen Dialekte der Halbinsel geben.
Warum ist die Inschrift von An-Namāra so bedeutend?
Sie gilt als eines der wichtigsten Dokumente des frühen Arabischen und wird oft als Grabinschrift eines „Königs aller Araber“ interpretiert.
Welche Rolle spielten die Nabatäer für das Arabische?
Die Nabatäer nutzten eine aramäische Schriftform, in die zunehmend arabische Sprachelemente einflossen, was den Übergang zur arabischen Schrift markiert.
- Arbeit zitieren
- Adrian Wille (Autor:in), 2010, Die ältesten Zeugnisse des Arabischen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184046