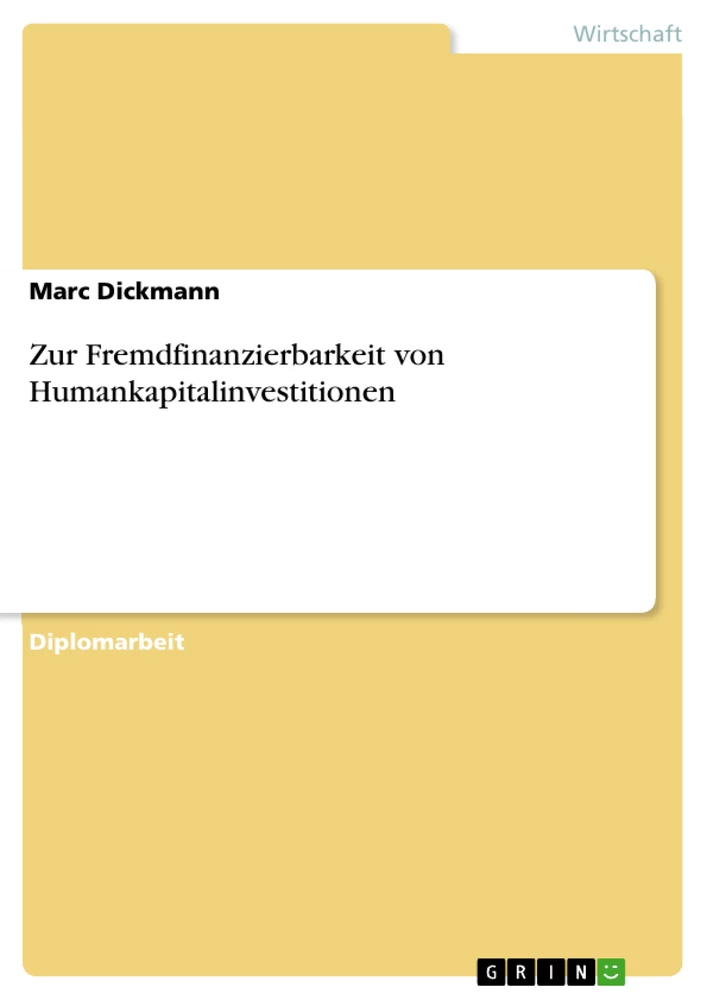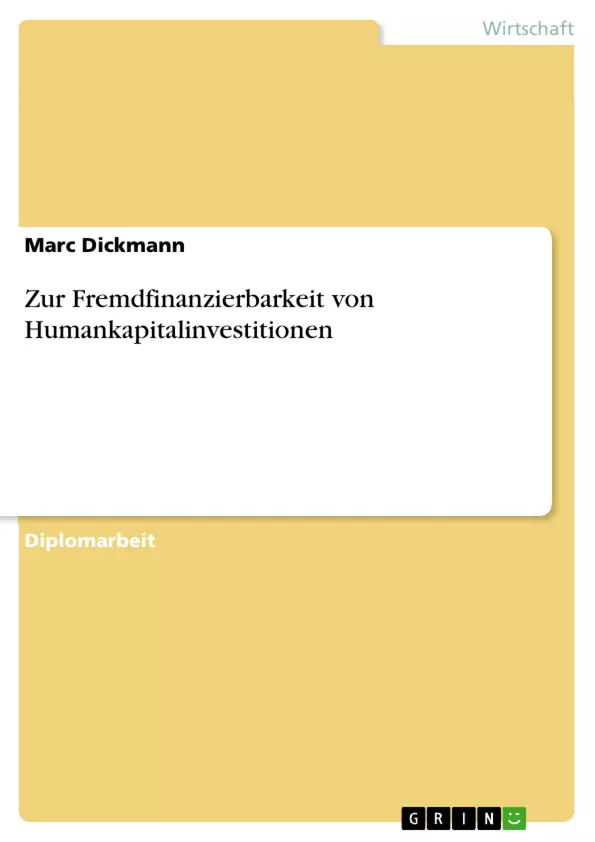Seit der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10.12.1948 in Paris ist das Recht auf Bildung für jedes Individuum in Artikel 26 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert. Ein Kernpunkt des Artikels ist die kostenlose Verfügbarkeit von elementarer Schul- bzw. Grundbildung. Seit der 55. Generalversammlung der Vereinten Nationen, vom 06.-08.09.2000 in New York, existieren die sogenannten Millennium Goals. Millennium Goal Nr.2 besagt, dass bis ins Jahr 2015 für alle Kinder weltweit und geschlechterunabhängig, eine universelle, primäre Schulbildung verfügbar sein muss. Die gesellschaftliche Bedeutung vom Zugang und der Möglichkeit zur Aneignung grundlegender Bildung respektive grundlegenden Humankapitals, sowie die Attraktivität von entsprechenden Investitionen und deren gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Profitabilität, wurden damit und durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt. So sind vor allem im Bereich primärer und sekundärer Bildung für Investoren die höchsten Renditen zu erzielen. Bildung und demnach Humankapital hat nicht nur einen starken positiven Einfluss auf die Entwicklung einzelner Individuen, sondern ist die Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung. Mit anderen Worten muss die Entwicklung einer Gesellschaft den Weg über die Entwicklung jedes einzelnen Mitglieds gehen, insbesondere über die Entwicklung von Kindern und damit über die zukünftiger Generationen, speziell in den ärmsten Regionen der Welt. Nur so kann sich ein wirtschaftlich und sozial kohäsives Gefüge erwachsen. Die Realität zeigt aber, dass aktuell etwa 72 Millionen Kinder weltweit keinen Zugang zu Schulbildung haben. Zwar ist diese Zahl im Vergleich zum Jahr 2000 um ca. 33 Millionen gesunken, Fortschritte werden jedoch nur langsam erreicht. Denn der Prozess steht oft vor großen ökonomischen Hindernissen, die es zunächst zur Annäherung an das Ziel zu überwinden gilt. Um kostenlose Bildung gewährleisten zu können, muss ein Zustand bzw. ein System geschaffen werden, in dem die Finanzierung derart gesichert werden kann, dass eine Beteiligung derer, die die Bildung erfahren, nicht nötig ist.
Wie kann also diese Finanzierung gewährleistet werden, wenn den Familien die entsprechenden Mittel fehlen, und auch der Staat nicht in der Lage ist universelle Bildung bereitzustellen? Inwieweit und ob eine solche, kommerziell ausgerichtete Art der Bildungsfinanzierung überhaupt möglich ist, soll daher in dieser Arbeit untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Die Humankapitaltheorie
- 2.2 Die Principal Agent Theorie
- 2.3 Die Finanzierung von Bildungsangebot und -nachfrage
- 3. Finanzierungsmodelle für Humankapitalinvestition
- 3.1 Annuitätendarlehen
- 3.2 Einkommensabhängige Darlehen
- 3.3 Graduate Tax
- 3.4 Human Capital Contract
- 4. Modelle zur Finanzierung primärer und sekundärer Bildung
- 4.1 Conditional Cash Transfer - Opportunidades
- 4.2 State Human Capital Contract
- 4.3 Education Contract
- 5. Schlussbemerkung
- II. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage der Fremdfinanzierbarkeit von Humankapitalinvestitionen, insbesondere im Bereich der (Grund-)Schulbildung. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Finanzierung von Bildung durch private Investoren zu untersuchen und dabei den Fokus auf die Finanzierung von Bildung für Minderjährige und Kinder zu legen.
- Die Humankapitaltheorie und die Principal Agent Theorie als theoretische Grundlagen für die Analyse der Finanzierung von Bildung.
- Verschiedene Finanzierungsmodelle für Humankapitalinvestitionen, insbesondere im Bereich der Hochschulbildung, wie Annuitätendarlehen, einkommensabhängige Darlehen, Graduate Tax und Human Capital Contract.
- Modelle zur Finanzierung primärer und sekundärer Bildung, wie Conditional Cash Transfer, State Human Capital Contract und Education Contract.
- Die Herausforderungen und Chancen der Fremdfinanzierung von Bildung für Minderjährige und Kinder.
- Die Bedeutung von Bildung für die Entwicklung von Individuen und Gesellschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen der Humankapitaltheorie und der Principal Agent Theorie dar. Es werden die wichtigsten Annahmen und Erkenntnisse dieser Theorien erläutert, die für die Analyse der Finanzierung von Bildung relevant sind.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über verschiedene Finanzierungsmodelle für Humankapitalinvestitionen, die insbesondere im Bereich der Hochschulbildung Anwendung finden. Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle diskutiert und ihre Eignung für die Finanzierung von Bildung für Minderjährige und Kinder untersucht.
Kapitel 4 befasst sich mit Modellen zur Finanzierung primärer und sekundärer Bildung. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die darauf abzielen, die Finanzierung von Bildung für Minderjährige und Kinder zu gewährleisten. Die Kapitel analysieren die Bedingungen für den Einsatz dieser Modelle, die auftretenden Probleme und die Perspektiven für weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fremdfinanzierung von Humankapitalinvestitionen, die Finanzierung von Bildung, die Humankapitaltheorie, die Principal Agent Theorie, Conditional Cash Transfer, State Human Capital Contract, Education Contract, Bildung für Minderjährige, Bildung für Kinder, Bildungsinvestitionen, Bildungsgerechtigkeit, Bildung und Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Können private Investoren die Grundbildung finanzieren?
Die Arbeit untersucht, ob kommerzielle Finanzierungsmodelle für Humankapital (Bildung) auch im Bereich der Primär- und Sekundärbildung möglich sind.
Was ist ein "Human Capital Contract"?
Ein Finanzierungsmodell, bei dem Investoren die Ausbildungskosten übernehmen und im Gegenzug einen prozentualen Anteil am späteren Einkommen des Absolventen erhalten.
Was sind "Millennium Goals" im Bildungskontext?
Das Ziel Nr. 2 besagt, dass weltweit eine universelle, primäre Schulbildung für alle Kinder verfügbar sein muss.
Warum ist Bildung für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit so wichtig?
Humankapital ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklung jedes einzelnen Mitglieds einer Gesellschaft und damit für das gesamte wirtschaftliche Gefüge.
Was ist ein "Conditional Cash Transfer"?
Ein Modell (wie 'Oportunidades'), bei dem Familien finanzielle Unterstützung erhalten, sofern sie Bedingungen wie den regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder erfüllen.
- Quote paper
- Marc Dickmann (Author), 2010, Zur Fremdfinanzierbarkeit von Humankapitalinvestitionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184080