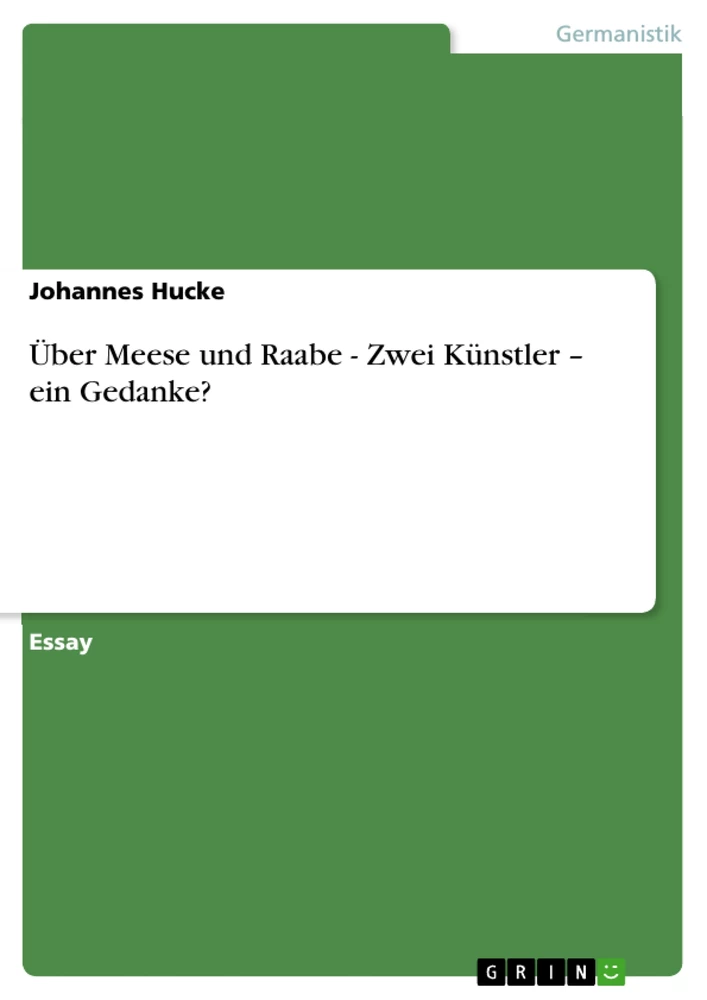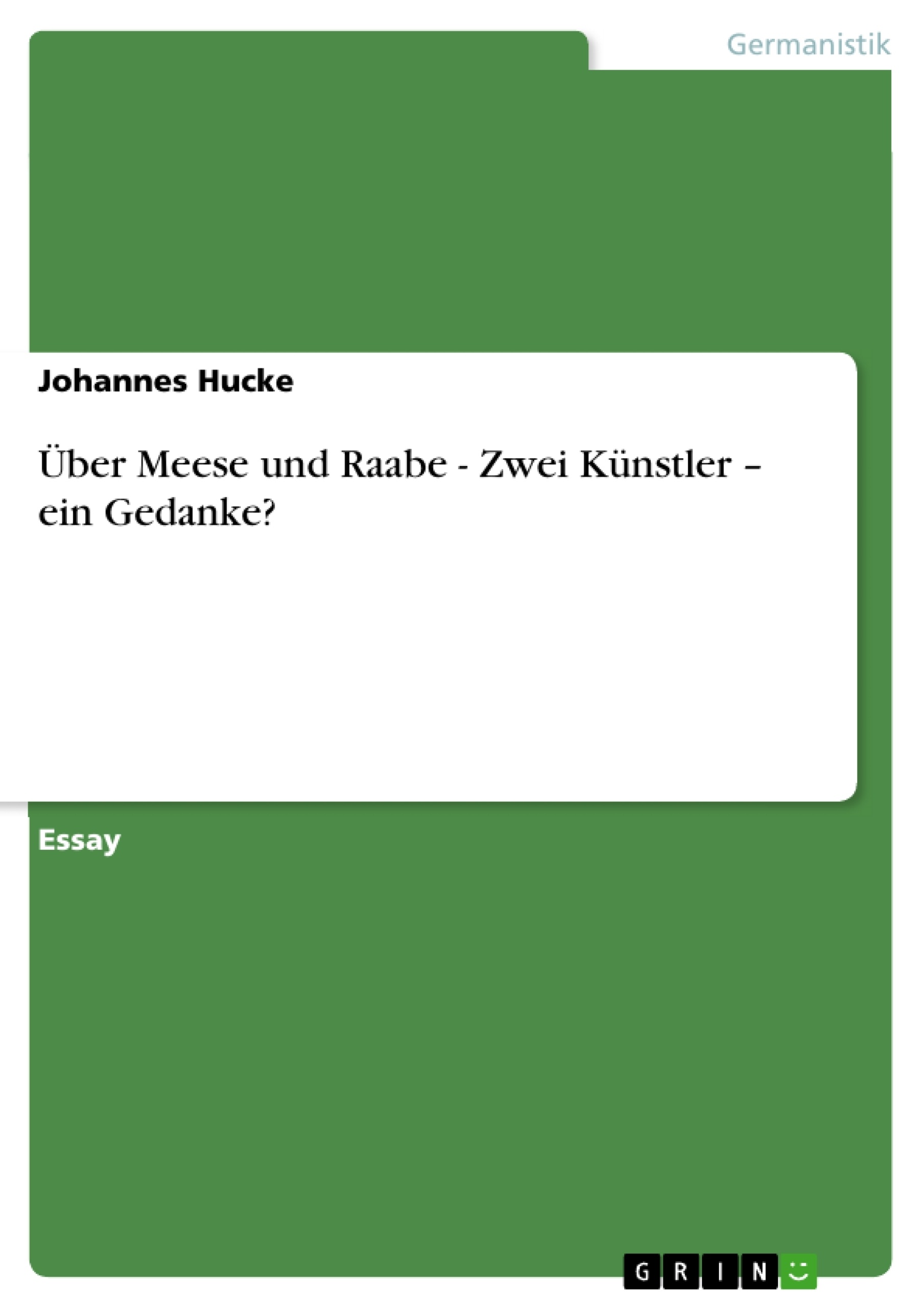In diesem Kurzessay begegnen sich zwei Künstler mit scheinbar unvereinbaren Gegensätzen. Johannes Hucke bringt Licht ins Dunkle und zeigt erstaunliche Gemeinsamkeiten auf!
Inhaltsverzeichnis
- Meese und Raabe: Die Liste der sich einander gegenläufig verhaltenden Merkmale ist lang.
- Zwei Epochen, auf den ersten Blick zu diferenzierende Auffassungen künstlerischen Schaffens.
- Zudem der eine (Meese) Künstler,der andere (Raabe) hauptsächlich Schriftsteller.
- In diesem Essay soll es nicht um – scheinbar offensichtliche Unterschiede sondern um Gemeinsamkeiten im Werk der offenbar nur mit Mühe zu dechiffrierenden Künstler, vor allem aber deren Werke gehen.
- Wesentliche Grundlage dieses Essays ist einerseits ein im Rahmen der ARD-Reihe „Deutschland Deine Künstler“ entstandenes Potrait Meeses¹ (es zeigt Meeses Kunst und wie sie funktioniert) und andererseits Raabes Werke, aus denen exemplarische Querverweise hergestellt und der ambivalente Charakter beider im Umgang mit dem Topos der,,Funktionsweise von Geschichte“ zu Tage gefördert werden soll.
- Raabes Werk für sich eint in vielfacher Hinsicht der Aspekt des Mit- oder Nebeneinanders der Geschichte: Bereits im Anfangskapitel des historischen Romans „Das Odfeld2“ (ent-)wirft Raabe gewissermaßen im doppelten Wortsinn das Schlachtfeld der Geschichte, indem er durch verschiedene Erzählinstanzen und mit Formen der Raffung, einen „Clash“ ebendieser provoziert.
- Beinahe unmerklich treffen Szenen aus ~1800 Jahren Historie aufeinander³, eine ,,Kette von Gedächtnisräumen“ entsteht.
- Auf die Beschreibung eines römischen Schlachtfeldes, dem Odfeld, folgt die Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Kloster Amelungsborn und eine Beschreibung der Lokalität (1802) in einem Brief Schillers an Goethe, abgeschlossen von einer Bibelmetapher (Noah):
- Wie ein Mosaik ist dieser hochartifizielle Text aus einer Fülle von wörtlichen und verdeckten Zitaten, literarischen Reminiszenzen, Bibelreferenzen und historischen Quellenfragmenten zusammengesetzt.
- Collageartig entwickelt Raabe dabei eine enge Verflechtung durch die Epochen, die dem Leser aus der Jetzt-Perspektive nicht nur als das gewohnte Hintereinander, sondern gerade auch als Nebeneinander (vgl. auch bestimmte Repräsentationsformen der Kindheitserinnerung in Raabes (Werk) Die Akten des Vogelsangs) und Durcheinander der Geschichte erscheint.
- Das „woher“ und „warum“ des „Apokalypsen“-Entwurfs in „Das Odfeld“ prägt den (literarischen) Diskurs hier im Speziellen – es wimmelt schier von Verweisen, der Text ist ein Gewebe im eigentlichen Wortsinn.
- Der Literaturwissenschaftler Hellmuth Mojem sieht gar eine strukturelle Parallelität in Form einer „Idyllenumschrift“ von Ovids Metamorphosen; Rosemarie Haas verweist auf eine Intertextualitätsbeziehung als Hommage an E.A. Poes „,The Raven".
- Mit Blick auf sein Gesamtwerk man denke beispielsweise an die „Chronik der Sperlingsgasse - nimmt hier Raabe als Schriftsteller eine Mittlerfunktion ein, „Diskursfäden laufen in den Text hinein und kommen „gefärbt aus ihm heraus“. Der literarische Text wird als Knotenpunkt der Diskurse gelesen, er ist kein geschlossenes Werk.
- Er ist vielmehr Teil der kulturellen Praktiken“ (Basler 2001) 10 und verhandelt so das Prinzip von Wissen und Geschichte von kulturellem Gedächtnis", hier in Form enzyklopädisch musealer und doch getrübter Wissensaufnahme, durch aufeinandertreffende Konfliktlinien verkörpert¹². Diese „getrübte Wissensaufnahme“ könnte übrigens auch als Unschärfe¹³ in der Frage nach einer Ordnung in Zeit und Raum verstanden werden.
- Zwei für den weiteren Vergleich mit Jonathan Meese entscheidende Prämissen führt Jacob in seiner Konklusion auf: Erstens das Postulat zur „Teilhabe an (...) Kultur und (...) Geschichte (...) von innen heraus“14, zweitens den besonderen Charakter der Erzählung im Sinne von ,,Experimentalliteratur"15, die den Prozess des Erinnerns selbst ausstellt.
- Der „Bestsellerprofessor“ ECO könnte er ist ebenfalls Verfasser historischer Romane - mit seinem 2009 erschienenen Werk „Die unendliche Liste“ einen weiteren Mosaikstein zur Erklärung des bei Raabe angewandten Verfahrens beisteuern: „Die Liste (ist eine) Möglichkeit unser Wissen zu erweitern, wenn Definitionen nach Substanz nicht mehr zufriedenstellend sind "16.
- ECO sieht Listen in Analogie zu „Katalogen, (...) Sammlungen in Museen, Enzyklopädien und Wörterbüchern“17, sie sind also Ordnungssysteme die uns die Orientierung im „Schlachtfeld“ der Geschichte ermöglicht.
- Ganz ähnlich, wohl aber in gesteigerter Radikalität, Intensität und Härte wie Raabe den Geschichtsdiskurs versinnbildlicht auf einem Schlachtfeld austrägt, tut dies Meese in Puls und Unmittelbarkeit der Postmoderne.
- Auf großen Leinwand-Schlachtfeldnern, durch Bronzestatuen, Installationen und Theaterbühnen.
- Meese wirkt wie im Wahn, wenn er von der „Diktatur der Kunst“ spricht, die er mit Ausstellungen wie „Erzstaat Atlantis “18 oder der im Film begleiteten New Yorker Vernissage verkörpert.
- Sein Werk greift Motive wie das Eiserne Kreuz¹, den vielfach in seinen Installationen ausgestellten Hitlergruß20 und das omnipräsente Phallussymbol auf.
- Mythos, Heldensagen, Mutterkult wie Leitmotive ziehen sich diese Themen durch Meeses Werk.
- Einiges²¹ deutet darauf hin, Meese als einen „Kunst-Chaot(en) mit Geheimsprache “22, einzuordnen, wie es das Magazin Spiegel tut.
- Ist der Künstler eine geduldete Ausnahmeerscheinung, ein großes Kind, das mit Kunst spielt oder ist da weit mehr; eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit hochaktuellen Fragestellungen des 21. Jahrhunderts wie der Frage nach der Funktionsweise von Geschichte.
- Meese gilt der Filmausschnitt bestärkt diesen Eindruck - (...) als einer der „Partisanen der Utopie“³; wird in einem Atemzug mit Künstlern wie Joseph Beuys und Daniel Richter genannt.
- Letzterer vermag es, als Wegbegleiter und Kollege (beide arbeiten miteinander an verschiedenen Werken) den tieferen Gehalt, die entscheidenden Grundlagen von Meeses Werk in der Außenansicht aufzugreifen, das Utopische vom Existenziellen abzustreifen²4:
- „Der Mensch lebt in der Gegenwart und sollte sich viel weniger aus Traditionen und Sentimentalitäten ableiten, sondern aus den Notwendigkeiten dessen was er vorfindet.
- Vielleicht noch mit einer gewissen Zukunftsorientierung.
- Er sollte also seine eigene Vergangenheit bereits mitdenken, und nicht immer am bereits Vergangenen rumklumpen.
- Das war so die ungefähre Idee von "Die Peitsche der Erinnerung". "25 (Daniel Richter)
- Laut Richter ist Meese in diesem Zusammenhang für seine „katalysierende(n) Fähigkeiten“26 bekannt, mit denen er sich die Beurteilung der Bedeutung von Geschichte zu seinem elementaren Betrachtungsgegenstand macht.
- Der bei Raabe angesprochene „Clash“ der Geschichte findet hier nicht literarisch, sondern ganz bildlich statt: Der Film illustriert diese Verfahrensweise, „die Frage nach Geschichte und ihrer Wirkungsmacht, nach Traditionslinien und dem ganzen Kitsch und Pathos“27 exemplarisch.
- Scheinbar wahllos fügt sich ein künstlerisches Mosaiksteinchen nach dem anderen einander, sukzessive entsteht ein fassbares Bild.
- ECO hat entdeckt, dass es auch in der Malerei bzw. in Kunstwerken „Listen“ gibt, die uns genauso wie auf dem Gebiet der Literatur den Weg durch die Wirren der Geschichte weisen.28
- Überträgt man die Raabe von Jacob attestierte „Teilhabe an (...) Kultur und (...)Geschichte (...) von innen heraus“ lebensnah in die Jetzt-Zeit, erschließen sich in gewisser Weise Übereinstimmungen mit Meese im Sinne von Geschichte als Vorwärtsbewegung:
- „Fünf Euro für die Vergangenheit und 20 für die Gegenwart!"⁹
- Ob man diese Ähnlichkeit als Postulat für einen verantwortungsvollen, vorwärtsgewandten (aber nicht geschichtsblinden) Umgang mit Geschichte interpretieren sollte erscheint zunächst uneindeutig, wird aber durch Sätze wie,,Der Mensch sollte also seine eigene Vergangenheit bereits mitdenken, und nicht immer am bereits Vergangenen rumklumpen“ klarer: Geschichte als Teil der Gegenwart, ohne im „Gefängnis des Vergangenen“ steckenzubleiben.
- Jonathan Meese würde es so ausdrücken:
- „Die Diktatur der Kunst wird entstehen durch diese Bewegung nach vorne.
- Ja.
- Man tut vielleicht so, dass man was von hinten nimmt.
- Aber man ist sofort wider drüberhinaus über
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit den Gemeinsamkeiten im Werk von Jonathan Meese und Wilhelm Raabe, zwei Künstlern aus unterschiedlichen Epochen, die sich auf den ersten Blick stark unterscheiden. Ziel ist es, die scheinbar gegensätzlichen Ansätze beider Künstler in Bezug auf die Funktionsweise von Geschichte zu untersuchen und Gemeinsamkeiten aufzudecken.
- Die Rolle von Geschichte als Schlachtfeld und das Nebeneinander von Epochen
- Die Verwendung von Zitaten, Reminiszenzen und Quellenfragmenten als Mittel der Verflechtung von Geschichte
- Die Bedeutung von „kulturellem Gedächtnis“ und die Frage nach der Ordnung in Zeit und Raum
- Die „Teilhabe an Kultur und Geschichte von innen heraus“ als Prämisse für eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
- Die „Diktatur der Kunst“ als Ausdruck einer vorwärtsgerichteten Bewegung, die die Vergangenheit mitdenkt, aber nicht im „Gefängnis des Vergangenen“ gefangen bleibt
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit der Feststellung, dass Meese und Raabe auf den ersten Blick unterschiedliche Künstler sind, die in verschiedenen Epochen und mit unterschiedlichen Medien arbeiten. Dennoch werden Gemeinsamkeiten in ihrem Werk aufgezeigt, die sich insbesondere im Umgang mit dem Topos der „Funktionsweise von Geschichte“ zeigen.
Im ersten Kapitel wird Raabes Werk „Das Odfeld“ als Beispiel für eine „Kette von Gedächtnisräumen“ analysiert, die durch die Verflechtung von verschiedenen Epochen entsteht. Raabe verwendet Zitate, Reminiszenzen und Quellenfragmente, um eine Collage aus verschiedenen historischen Momenten zu schaffen, die dem Leser aus der Jetzt-Perspektive als Nebeneinander erscheint.
Im zweiten Kapitel wird Meeses Werk als eine „Diktatur der Kunst“ vorgestellt, die sich durch eine radikale und unmittelbare Auseinandersetzung mit der Geschichte auszeichnet. Meese verwendet Motive wie das Eiserne Kreuz, den Hitlergruß und das Phallussymbol, um die „Wirkungsmacht“ von Geschichte und die „Traditionslinien“ der Vergangenheit zu hinterfragen.
Im dritten Kapitel werden die Gemeinsamkeiten von Raabe und Meese im Umgang mit Geschichte herausgestellt. Beide Künstler zeigen, dass Geschichte nicht nur als eine lineare Abfolge von Ereignissen verstanden werden kann, sondern auch als ein „Schlachtfeld“ von Ideen und Interpretationen, das in der Gegenwart weiterwirkt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Funktionsweise von Geschichte, die Verflechtung von Epochen, die „Kette von Gedächtnisräumen“, die „Diktatur der Kunst“, die „Teilhabe an Kultur und Geschichte von innen heraus“, die „Wirkungsmacht“ von Geschichte und die „Traditionslinien“ der Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen
Was verbindet den Künstler Jonathan Meese mit dem Schriftsteller Wilhelm Raabe?
Trotz unterschiedlicher Epochen teilen beide eine tiefe Auseinandersetzung mit der „Funktionsweise von Geschichte“. Beide nutzen collagenartige Verfahren, um Geschichte als ein Nebeneinander und Durcheinander darzustellen.
Was thematisiert Wilhelm Raabe in seinem Werk „Das Odfeld“?
Raabe entwirft das Schlachtfeld der Geschichte als Mosaik aus Zitaten und Reminiszenzen. Er provoziert einen „Clash“ der Epochen, in dem Szenen aus 1800 Jahren Historie aufeinandertreffen.
Was meint Jonathan Meese mit der „Diktatur der Kunst“?
Meese fordert eine radikale Vorwärtsbewegung der Kunst, die sich von Traditionen und Sentimentalitäten befreit, dabei aber die eigene Vergangenheit mitdenkt, ohne in ihr gefangen zu bleiben.
Welche Rolle spielen Listen und Kataloge in der Kunst von Meese und Raabe?
Unter Bezugnahme auf Umberto Eco werden Listen als Ordnungssysteme verstanden, die Orientierung im „Schlachtfeld der Geschichte“ ermöglichen, wenn Substanzdefinitionen nicht mehr ausreichen.
Wie gehen beide Künstler mit dem kulturellen Gedächtnis um?
Beide verhandeln Geschichte als Teil der Gegenwart. Sie fordern eine Teilhabe an Kultur „von innen heraus“ und betrachten ihre Werke als Knotenpunkte verschiedener Diskurse.
- Quote paper
- Johannes Hucke (Author), 2010, Über Meese und Raabe - Zwei Künstler – ein Gedanke?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184082