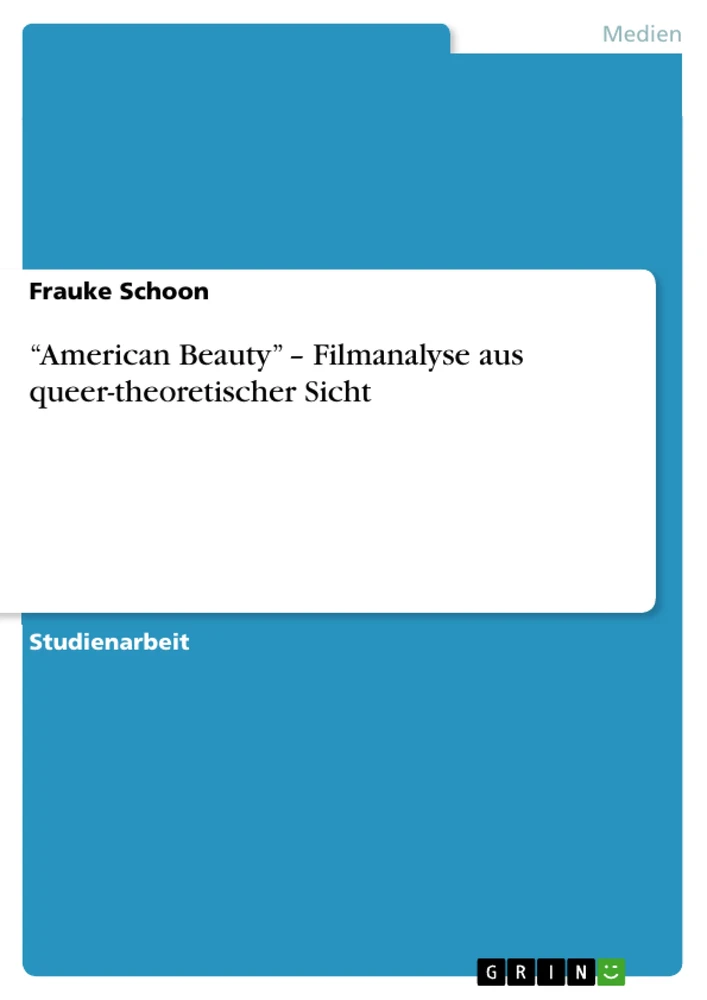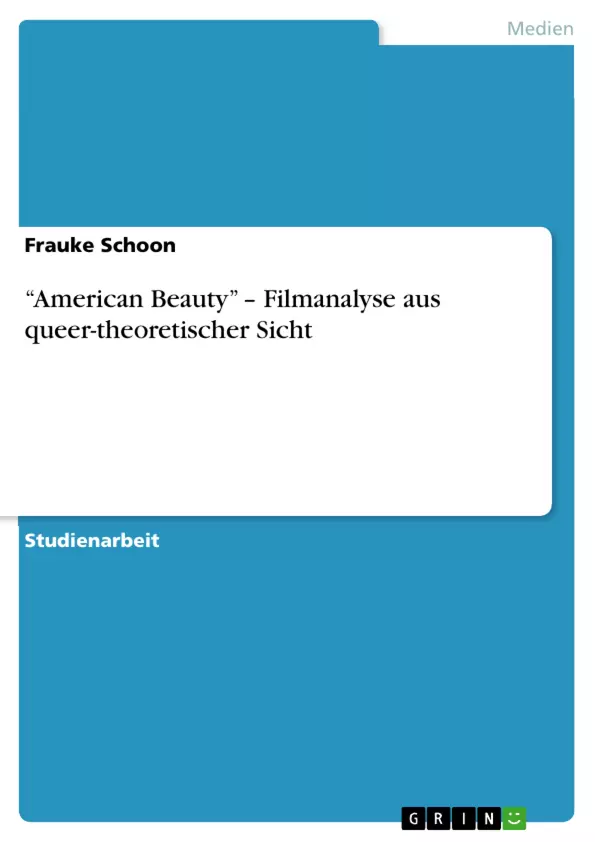Toleranz gegenüber Homosexualität war und ist ein häufig diskutiertes Thema in den Medien. Auch in dem Spielfilm ‚American Beauty„ spielt sie eine große Rolle. In der folgenden Arbeit wird der Film daher aus einem queer-theoretischen Blickwinkel betrachtet und analysiert. Dazu wird der Film zunächst in seinen gesellschaftlichen Kontext eingeordnet und in Form einer ausführlichen Analyse auf seine homosexuellen Aspekte untersucht. Die Arbeit kommt so zu dem Ergebnis, dass es sich um ein gesellschaftskritisches Werk handelt, das demaskiert und sich gegen die Verleugnung von Gefühlen einsetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. American Beauty und die Queer-Theorie
- 2.1. Queer
- 2.1.1. Homosexualität
- 2.1.1.1. US-amerikanische Geschichte der Homosexualität
- 2.1.1.2. Homosexualität und Militär
- 2.1.2. Die Queer-Theorie
- 2.3. American Beauty
- 2.3.1. Queeres im Film
- 2.3.1.1. Jim und Jim
- 2.3.1.2. Colonel Frank Fitts
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse des Films „American Beauty“ aus einer queer-theoretischen Perspektive. Ziel ist es, die im Film dargestellten homosexuellen Aspekte zu untersuchen und ihren gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten.
- Verleugnung und Unterdrückung von Homosexualität
- Das Scheitern eines Homosexuellen, der seine Neigungen verdrängt
- Die Vorteile einer offen gelebten gleichgeschlechtlichen Beziehung
- Die gesellschaftlichen Verhältnisse bezüglich der Homosexualität in den USA
- Die Queer-Theorie als Analysekategorie für Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Film „American Beauty“ und sein Drehbuchautor Alan Ball vor, der selbst homosexuell ist. Es werden die zentralen Themen des Films aufgezeigt, die in der Hausarbeit näher untersucht werden, wie die Verleugnung von Homosexualität und die Darstellung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen.
Das zweite Kapitel widmet sich der Queer-Theorie und dem Begriff der Homosexualität. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zur Definition von Homosexualität beleuchtet, wie Essentialismus und Konstruktivismus, sowie der Einfluss von Michel Foucault und dessen Konzept der modernen homosexuellen Identität.
Der dritte Teil der Hausarbeit fokussiert auf die homosexuellen Aspekte des Films. Die Beziehung zwischen Jim und Jim zeigt die positiven Seiten einer offen ausgelebten gleichgeschlechtlichen Beziehung. Die Analyse des Colonel Frank Fitts hingegen beleuchtet die tragischen Folgen der Unterdrückung von Homosexualität.
Schlüsselwörter
Die Analyse von "American Beauty" aus einer queer-theoretischen Sicht beleuchtet die zentralen Begriffe Homosexualität, Verleugnung, Unterdrückung, Queer-Theorie, Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse, sowie die gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA und die Darstellung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen im Film.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer queer-theoretischen Analyse von "American Beauty"?
Die Arbeit untersucht homosexuelle Aspekte im Film und zeigt auf, wie Verleugnung von Gefühlen und gesellschaftliche Unterdrückung zu tragischen Entwicklungen führen.
Wie wird die Figur Colonel Frank Fitts analysiert?
Colonel Fitts dient als Beispiel für die zerstörerischen Folgen unterdrückter Homosexualität und die Unfähigkeit, die eigene Identität in einem starren militärischen Umfeld zu akzeptieren.
Welche Rolle spielen "Jim und Jim" im Film?
Das Paar Jim und Jim repräsentiert die positiven Seiten einer offen gelebten gleichgeschlechtlichen Beziehung und bildet einen Kontrast zur verlogenen bürgerlichen Vorstadtwelt.
Was bedeutet "Queer-Theorie" in diesem Kontext?
Die Queer-Theorie hinterfragt feste Kategorien von Geschlecht und Sexualität und demaskiert gesellschaftliche Normen, die Abweichungen von der Heteronormativität stigmatisieren.
Warum gilt der Film als gesellschaftskritisch?
Er demaskiert die Fassade der perfekten amerikanischen Vorstadtidylle und kritisiert die Verdrängung wahrer Emotionen zugunsten gesellschaftlicher Erwartungen.
Welchen Einfluss hat die US-amerikanische Geschichte der Homosexualität?
Die Arbeit ordnet den Film in den Kontext der US-Geschichte ein, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Homosexualität und Militär.
- Quote paper
- Frauke Schoon (Author), 2010, “American Beauty” – Filmanalyse aus queer-theoretischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184163