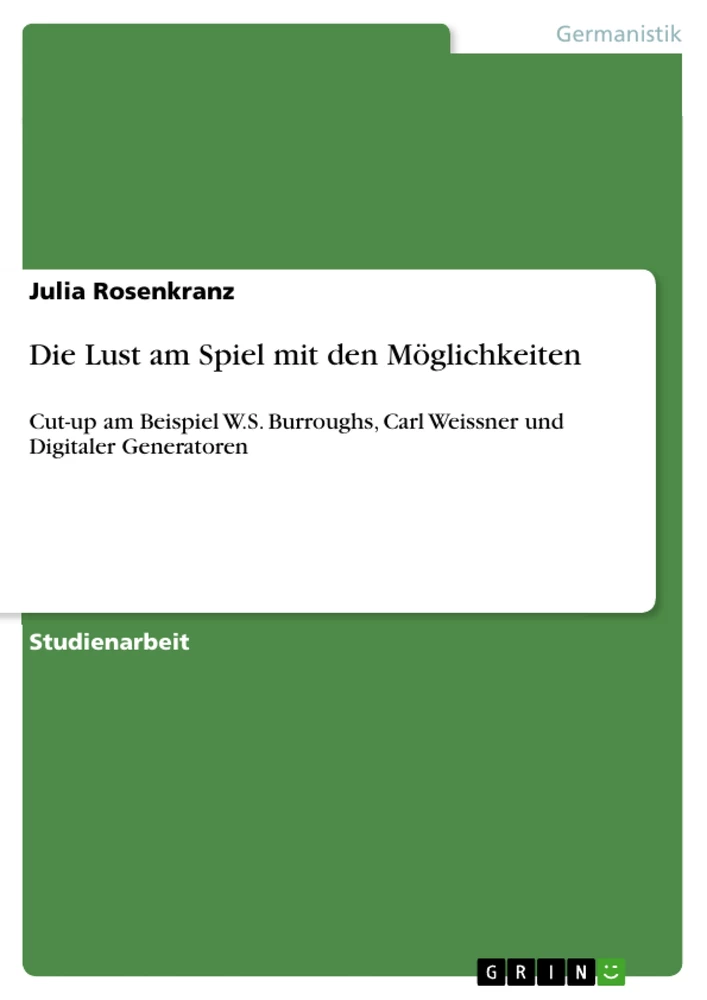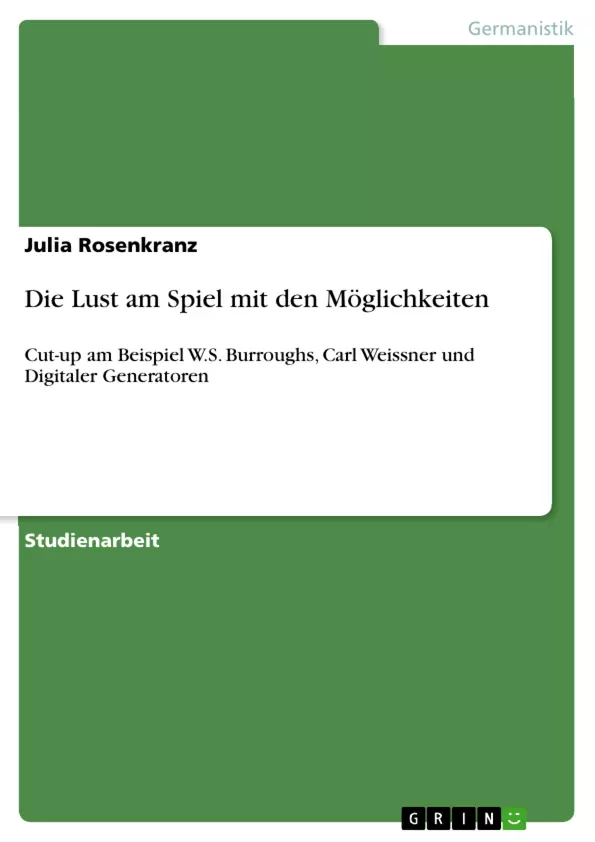Das Spiel mit den Möglichkeiten hat in vielerlei Hinsicht seinen Reiz: es bietet Aussicht auf unterschiedlichste Varianten, auf uneingeschränktes Ausprobieren und Ungebundenheit. Im Leben haben wir meist nicht die Chance aus unendlichen Versuchen zu schöpfen, in der Literatur hingegen schon. Sie bietet uns unterschiedlichste Methoden zum Experimentieren, zum Spielen mit erörtern.
Ausschlaggebend ist hier der Begriff des Spiels, der die Vorgehensweise vorschreibt und den es zunächst zu erläutern gilt. Besonders zwei literarische Spielformen gelten als besonders beachtenswert: der experimentelle Roman und die Postmoderne. Beide Phänomene müssen zunächst untersucht und entschlüsselt werden, um schließlich auf die literarische Form des Cut-up näher eingehen zu können.
Die Technik umfasst in erster Linie das Zerschneiden von Text, der dann entweder zufällig oder gesteuert wieder zusammengesetzt wird, und so ein völlig neues Endprodukt liefert. Die Tradition des Cut-up geht relativ weit zurück, schon Tristan Tzara hat Wortschnitzel aus einem Hut gezogen und wieder neu zusammengefügt. Es waren jedoch William S. Burroughs und Brion Gysin, die die Methode revolutioniert und ausgefeilt haben. Vor allem Burroughs hat mit seinen Werken wie „Naked Lunch“ und der Nova Trilogy eine neue Tradition des Cut-up geschaffen.
Genauso interessant ist der deutschsprachige Raum mit seinen Künstlern der Beat-Generation. Besonders erwähnenswert ist hier Carl Weissner. Der Autor wurde zunächst als Übersetzer von Charles Bukowski bekannt, nun hat er nach langer Schaffenspause drei neue Werke in kürzester Zeit herausgebracht. Sein Werk „Manhatten Muffdiver“ erschien 2010 im Milena Verlag und wurde in der Reihe „exquisite corpse“ von Thomas Ballhausen herausgegeben.
Das Computerzeitalter hat auch vor Literatur keinen Halt gemacht, und sich seinen Weg in die unterschiedlichsten lyrischen Formen gebahnt. Digitale Generatoren schaffen für Cut-up das, was sonst die Schere übernehmen würden: sie zerteilen Text und setzen ihn neu zusammen. Die Möglichkeiten sind auch hier wieder zahlreich, und Varianten zur Befriedigung der Spiellust sind scheinbar grenzenlos. Vor allem im Bereich der digitalen Literatur ist das Spielprinzip nicht zu verleugnen, allein die Nähe zu Computerspielen spricht dafür, und ebenso die gebotenen Gelegenheiten zur Interaktivität. Ab diesem Zeitpunkt entspricht die folgende Handlung der Auslegung eines Spiels und erzeugt im besten Fall Lustgewinn.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Literatur als Spiel
- Begriffsbestimmung
- Formen des experimentellen Romans
- Literarische Postmoderne
- Cut-up
- Ursprung und Entwicklung
- Das Verfahren
- William S. Burroughs
- The Soft Machine
- Cut-ups und mögliche Lesarten
- Carl Weissner
- Manhatten Muffdiver
- Permutationen im Werk
- Cut-up im österreichischem Raum
- Digitale Cut-ups und permutative Generatoren
- Einige Beispiele
- Language is a virus
- 23 degrees
- Jim Andrews: stir fry texts
- The Lazarus Corporation
- Einige Beispiele
- Nachwort
- Quellenverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Elektronische Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der literarischen Technik des Cut-up, die in den 1960er Jahren durch William S. Burroughs und Brion Gysin populär wurde. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Cut-up zu beleuchten, seine Anwendung in der Literatur zu analysieren und die Möglichkeiten digitaler Generatoren für diese Technik zu untersuchen.
- Die Bedeutung des Spiels in der Literatur
- Der experimentelle Roman und die literarische Postmoderne
- Die Technik des Cut-up und seine Anwendung bei William S. Burroughs und Carl Weissner
- Digitale Cut-ups und permutative Generatoren
- Die Rolle des Lesers in der Interpretation von Cut-up-Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Spiels in der Literatur. Es werden die beiden literarischen Spielformen, der experimentelle Roman und die Postmoderne, als Grundlage für die Untersuchung des Cut-up vorgestellt.
Das Kapitel „Literatur als Spiel“ definiert den Begriff des Spiels nach Johan Huizinga und stellt die verschiedenen Formen des experimentellen Romans nach Ulrich Ernst vor. Es wird auch die literarische Postmoderne als eine weitere Spielform in der Literatur behandelt.
Das Kapitel „Cut-up“ beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Technik, die auf das Zerschneiden und Neuzusammensetzen von Texten basiert. Es werden die wichtigsten Vertreter des Cut-up, William S. Burroughs und Brion Gysin, vorgestellt.
Das Kapitel „William S. Burroughs“ analysiert den Roman „The Soft Machine“ aus der Nova Trilogy und untersucht die verschiedenen Lesarten, die durch die Cut-up-Technik entstehen.
Das Kapitel „Carl Weissner“ stellt den deutschsprachigen Autor Carl Weissner vor, der sich ebenfalls mit der Cut-up-Technik auseinandersetzt. Sein Werk „Manhatten Muffdiver“ wird analysiert und die Bedeutung des Cut-up im österreichischen Raum wird beleuchtet.
Das Kapitel „Digitale Cut-ups und permutative Generatoren“ untersucht die Möglichkeiten, die sich durch digitale Generatoren für die Cut-up-Technik ergeben. Es werden verschiedene Beispiele für digitale Cut-ups vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den experimentellen Roman, die literarische Postmoderne, Cut-up, William S. Burroughs, Carl Weissner, digitale Generatoren, Sprachexperimente, Leserrezeption und Interaktivität. Der Text beleuchtet die Bedeutung des Spiels in der Literatur und die Möglichkeiten, die sich durch die Cut-up-Technik für die Gestaltung von Texten ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die literarische Cut-up-Technik?
Das Cut-up-Verfahren umfasst das Zerschneiden von Texten, die anschließend zufällig oder gesteuert neu zusammengesetzt werden, um völlig neue Aussagen und ästhetische Wirkungen zu erzielen.
Wer sind die bekanntesten Vertreter des Cut-up?
Die Technik wurde maßgeblich von William S. Burroughs und Brion Gysin revolutioniert. In der deutschsprachigen Literatur ist Carl Weissner ein bedeutender Vertreter dieser Form.
Wie wird Cut-up im digitalen Zeitalter angewendet?
Digitale Generatoren übernehmen heute die Funktion der Schere. Sie zerteilen Texte algorithmisch und ermöglichen interaktive, permutative Literaturformen im Internet.
Welche Rolle spielt der Leser bei Cut-up-Texten?
Da Cut-up-Texte oft nicht linear sind, ist der Leser aktiv gefordert, eigene Lesarten und Bedeutungen aus den collagenartigen Strukturen zu konstruieren.
Was hat das Spielprinzip mit experimenteller Literatur zu tun?
Das „Spiel mit den Möglichkeiten“ bietet in der Literatur – im Gegensatz zum realen Leben – die Chance auf unendliche Versuche und Experimente, was besonders in der Postmoderne als Lustgewinn verstanden wird.
- Citation du texte
- BA Julia Rosenkranz (Auteur), 2011, Die Lust am Spiel mit den Möglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184170