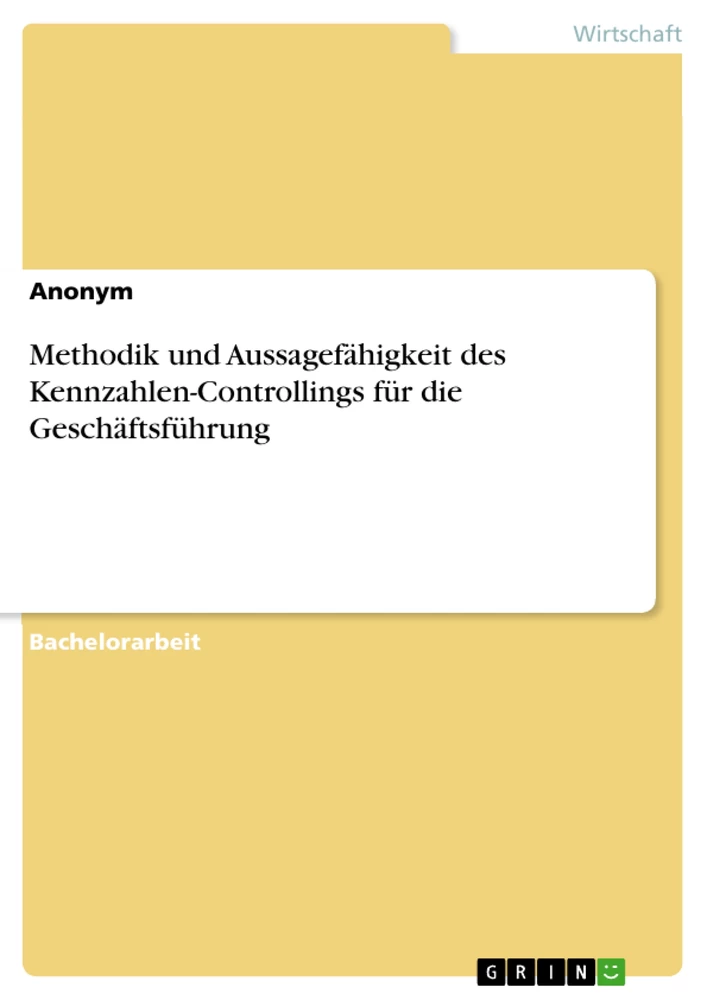Die Geschäftsführer sind aufgrund von sich verschärfenden Wettbewerbssituationen
einem stetig wachsenden Druck ausgesetzt. Nicht zu Letzt hat auch die
Globalisierung dazu geführt, dass Unternehmen weltweit mit einander
konkurrieren. Um interne-, wie auch externe Ressourcen optimal einsetzen zu
können, findet das Kennzahlencontrolling eine immer größere Gewichtung bei der
Strategiefindung und der Absicherung von Entscheidungen in Unternehmen.
Mithilfe von Kennzahlen ist eine komprimierte und aussagefähige Informationsübermittlung
möglich. Der Einsatz von Informationstechnologie ist dabei zu einer
unabdingbaren Voraussetzung geworden. Durch den Einsatz geeigneter Software
ist die Datenerfassung und auch deren Präsentation um ein vielfaches vereinfacht
und auch beschleunigt. Um eine größere Aussagefähigkeit zu erreichen wurden
ganze Kennzahlensysteme wie z.B. das DU PONT-Kennzahlensystem oder das
ZVEI-Kennzahlensystem entwickelt (hierzu mehr unter dem Gliederungspunkt 3
Kennzahlensysteme auf Seite 29.) Die Schwierigkeit mit dem Einsatz der
Kennzahlen liegt u.a. in der enormen Datenmenge und deren Filterung für das
Wesentliche. Außerdem führen einzelne Kennzahlen zu subjektiven
Beurteilungen, was eine falsche Interpretation zur Folge haben kann. Kaum
Berücksichtigung finden hingegen die sogenannten „weichen Faktoren“ wie
Servicequalität oder Mitarbeiterzufriedenheit.
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, ein Verständnis für die gängigsten
Kennzahlen der Wirtschaft zu entwickeln und die Aussagefähigkeit einzelner
Kennzahlen und Kennzahlensysteme für die Geschäftsführung darzulegen.
Außerdem wird auf die Methodik der multiplen Diskriminanzanalyse eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Kennzahlen und ihre Unterteilungen
- Investitionskennzahlen
- Finanzierungskennzahlen
- Liquiditätskennzahlen
- Rentabilitätskennzahlen
- Erfolgskennzahlen
- Quicktest
- Kennzahlensysteme
- Das ZVEI-Kennzahlensystem
- Das DU PONT-Kennzahlensystem
- Das RL-Kennzahlensystem
- Das PIMS-Kennzahlensystem
- Multiple Diskriminanzanalyse
- Multiple Diskriminanzanalyse, vereinfachte Methode
- Multiple Diskriminanzanalyse, nach Beermann
- Multiple Diskriminanzanalyse, nach Bleier
- Die Faktorenanalyse von Weinrich
- Das RISK-Früherkennungssystem
- Zusammenfassung und Entwicklungstendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Methodik und Aussagefähigkeit von Kennzahlen-Controllings für die Geschäftsführung. Ziel ist es, verschiedene Kennzahlensysteme und deren Anwendung zu analysieren und deren Aussagekraft für die unternehmerische Entscheidungsfindung zu bewerten.
- Analyse verschiedener Kennzahlen und ihrer Unterteilung nach Kategorien (Investition, Finanzierung, Liquidität, Rentabilität, Erfolg).
- Vergleich und Bewertung verschiedener Kennzahlensysteme (ZVEI, Du Pont, RL, PIMS).
- Anwendung multivariater Analysemethoden (Multiple Diskriminanzanalyse, Faktorenanalyse) im Kontext des Kennzahlen-Controllings.
- Bewertung der Aussagekraft von Kennzahlen für die unternehmerische Praxis.
- Diskussion von Entwicklungstendenzen im Kennzahlen-Controlling.
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Problemstellung, die die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der Methodik und Aussagefähigkeit des Kennzahlen-Controllings für die Geschäftsführung begründet. Es wird die Relevanz eines effektiven Controllings für fundierte Entscheidungen hervorgehoben und der Forschungsfokus auf die kritische Beurteilung der angewandten Methoden und die Interpretation der Ergebnisse gelegt. Die Einleitung liefert den Kontext für die anschließende detaillierte Auseinandersetzung mit Kennzahlen und deren Analysemethoden.
Kennzahlen und ihre Unterteilungen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Kennzahlen, kategorisiert nach Investitions-, Finanzierungs-, Liquiditäts-, Rentabilitäts- und Erfolgskennzahlen. Für jede Kategorie werden spezifische Kennzahlen detailliert erläutert, ihre Berechnung beschrieben und ihre Bedeutung für die Unternehmensanalyse herausgestellt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der einzelnen Kennzahlen und ihrer individuellen Aussagekraft, um eine fundierte Grundlage für die spätere Analyse von Kennzahlensystemen zu schaffen. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Kennzahlen werden ebenfalls beleuchtet, um ein ganzheitliches Bild der Unternehmenssituation zu ermöglichen. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Kennzahlen bildet eine essentielle Basis für die folgenden Kapitel.
Kennzahlensysteme: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen etablierten Kennzahlensystemen wie dem ZVEI-, Du Pont-, RL- und PIMS-System. Jedes System wird im Detail vorgestellt, seine Struktur und Methodik erläutert und seine Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Aussagefähigkeit für die Geschäftsführung analysiert. Die Kapitel vergleicht die Systeme miteinander und beleuchtet die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ansätze. Der Vergleich ermöglicht es, die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationsspielräume verschiedener Kennzahlensysteme zu verstehen und die Auswahl eines geeigneten Systems für spezifische Unternehmenskontexte zu bewerten. Die Diskussion der jeweiligen Systeme ist essentiell, um die vielschichtigen Aspekte des Kennzahlen-Controllings zu erfassen.
Multiple Diskriminanzanalyse: In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden der multiplen Diskriminanzanalyse im Kontext des Kennzahlen-Controllings vorgestellt und erläutert. Die vereinfachte Methode, die Ansätze von Beermann und Bleier sowie die Faktorenanalyse von Weinrich und das RISK-Früherkennungssystem werden detailliert beschrieben und kritisch bewertet. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung dieser statistischen Methoden zur Analyse von Kennzahlen und der Interpretation der Ergebnisse. Die Kapitel verdeutlicht, wie diese Methoden zur Identifizierung von Schlüsselfaktoren und zur Verbesserung der Entscheidungsfindung beitragen können. Die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Ansätze ermöglicht ein tiefes Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen der multivariaten Datenanalyse im Bereich des Controllings.
Schlüsselwörter
Kennzahlencontrolling, Geschäftsführung, Investitionskennzahlen, Finanzierungskennzahlen, Liquiditätskennzahlen, Rentabilitätskennzahlen, Erfolgskennzahlen, Kennzahlensysteme, ZVEI, Du Pont, RL, PIMS, Multiple Diskriminanzanalyse, Faktorenanalyse, Unternehmensanalyse, Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Kennzahlencontrolling für die Geschäftsführung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Methodik und Aussagefähigkeit von Kennzahlen-Controllings für die Geschäftsführung. Sie analysiert verschiedene Kennzahlensysteme und deren Anwendung und bewertet deren Aussagekraft für unternehmerische Entscheidungen.
Welche Kennzahlen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Kennzahlen, kategorisiert nach Investitions-, Finanzierungs-, Liquiditäts-, Rentabilitäts- und Erfolgskennzahlen. Spezifische Kennzahlen werden detailliert erläutert, ihre Berechnung beschrieben und ihre Bedeutung für die Unternehmensanalyse herausgestellt.
Welche Kennzahlensysteme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht und bewertet verschiedene etablierte Kennzahlensysteme: das ZVEI-Kennzahlensystem, das Du Pont-Kennzahlensystem, das RL-Kennzahlensystem und das PIMS-Kennzahlensystem. Die Stärken und Schwächen jedes Systems hinsichtlich der Aussagefähigkeit für die Geschäftsführung werden analysiert.
Welche multivariaten Analysemethoden werden angewendet?
Die Arbeit wendet verschiedene Methoden der multiplen Diskriminanzanalyse an, darunter eine vereinfachte Methode, die Ansätze von Beermann und Bleier, die Faktorenanalyse von Weinrich und das RISK-Früherkennungssystem. Diese Methoden werden zur Analyse von Kennzahlen und zur Interpretation der Ergebnisse eingesetzt.
Was ist das Ziel der multivariaten Analysen?
Die multivariaten Analysen zielen darauf ab, Schlüsselfaktoren zu identifizieren und die Entscheidungsfindung durch eine verbesserte Analyse von Kennzahlen zu unterstützen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Problemstellung, Kennzahlen und deren Unterteilungen, Kennzahlensysteme, multipler Diskriminanzanalyse und eine Zusammenfassung mit Entwicklungstendenzen. Jedes Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die jeweiligen Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kennzahlencontrolling, Geschäftsführung, Investitionskennzahlen, Finanzierungskennzahlen, Liquiditätskennzahlen, Rentabilitätskennzahlen, Erfolgskennzahlen, Kennzahlensysteme, ZVEI, Du Pont, RL, PIMS, Multiple Diskriminanzanalyse, Faktorenanalyse, Unternehmensanalyse, Entscheidungsfindung.
Welche Erkenntnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert Erkenntnisse über die Methodik und Aussagefähigkeit verschiedener Kennzahlen und Kennzahlensysteme im Kontext des Controllings. Sie bewertet die Anwendung multivariater Analysemethoden und diskutiert Entwicklungstendenzen im Kennzahlen-Controlling.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Methodik und Aussagefähigkeit des Kennzahlen-Controllings für die Geschäftsführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184232