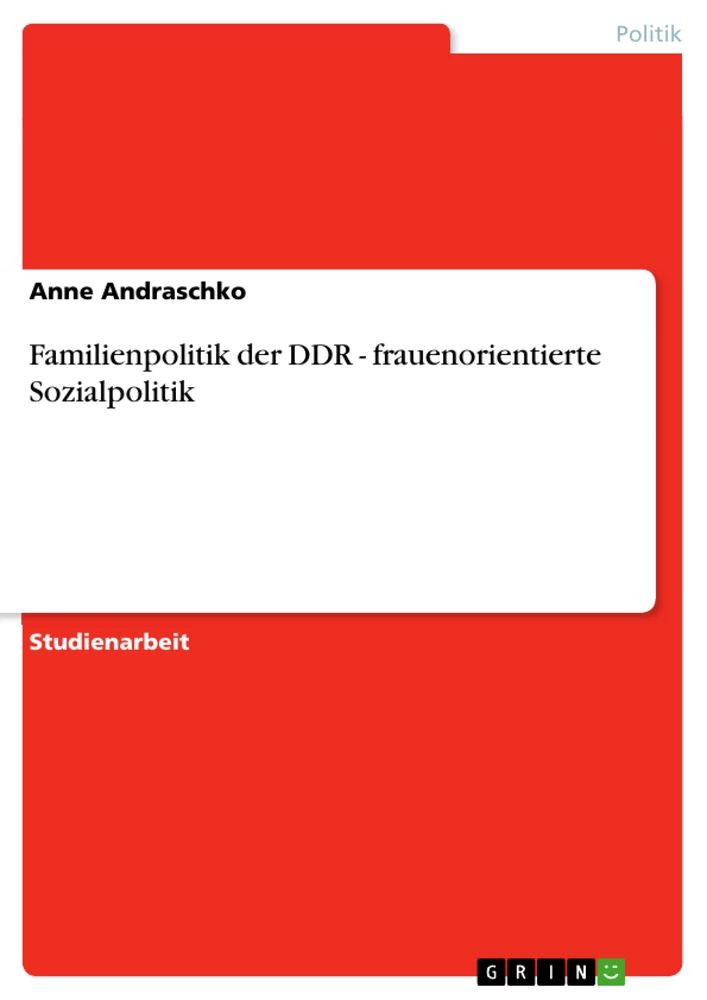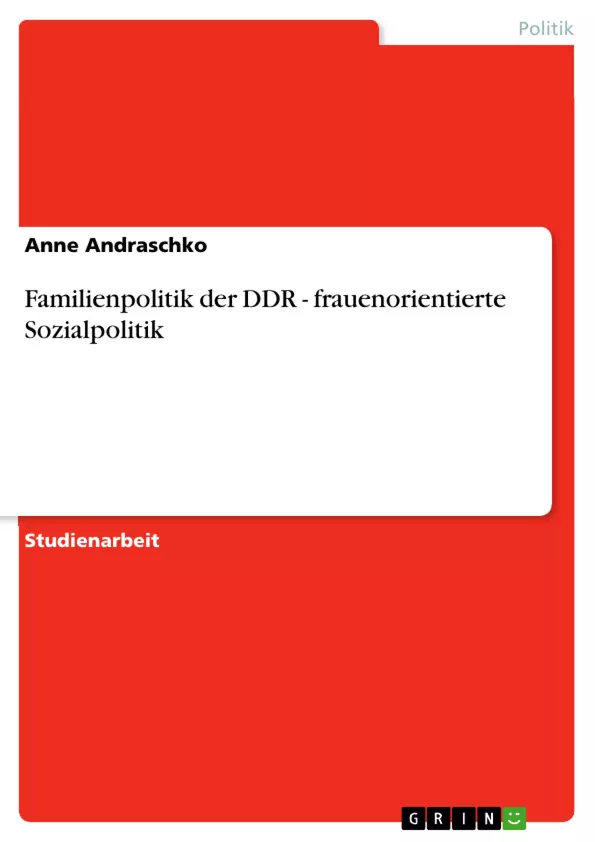Die Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) richtete sich aufgrund
der enormen Fachkräfteabwanderung und der Republikflucht rasch an die Frau und orientierte
sich zunehmend an ihnen. Die Frau in der DDR wurde nicht als Individuum sondern eher als
Arbeitskraft gesehen und sollte aus diesem Grund der Gesellschaft, im Bezug auf ihr
Arbeitskraftpotential nützen, aber gleichzeitig auch für die Nachwuchsreproduktion sorgen,
damit die sozialistische Gesellschaft weiter Bestand hat. Die Hinwendung zur Familienpolitik
erfolgte in der wechselseitigen Verbindung mit der Frauenpolitik. Die Frauen sollten zur
Arbeit gebracht werden, aber dabei kein schlechtes Gewissen bekommen, dass sie ihre
Familie vernachlässigen. Um die Arbeit lukrativer zu machen, unterstützt der Staat die
Familie indem er bestimmte finanzielle Leistungen erbringt und pädagogische Einrichtungen
schafft. Im Folgenden sollen zuerst die geschichtlichen Hintergründe zur Entstehung der DDR
erläutert werden, sowie die offizielle und inoffizielle politische Kultur. Bevor die einzelnen
Entwicklungsperioden der Sozialpolitik in der DDR, die frauenorientierte Sozialpolitik,
welche sich durch das Frauenleitbild und die Frauenerwerbsarbeit untergliedern lässt, und die
Ziele, Maßnahmen und Probleme der Familienpolitik erläutert werden, erfolgen zuerst die
Begriffsbestimmungen zur Sozialpolitik in der DDR, Familienpolitik in der DDR und BRD
und ebenso die Definition der Familie in der DDR. Abschließend wird die Deutsche
Demokratische Republik mit der Bundesrepublik Deutschland verglichen und die
Auswirkungen der Wiedervereinigung im Bezug auf die Familienpolitik veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- geschichtliche Hintergründe
- Gründung der DDR
- die politische Kultur der DDR
- die offizielle politische Kultur
- die inoffizielle politische Kultur
- Definitionen
- Sozialpolitik in der DDR
- Familienpolitik
- DDR
- BRD
- Familie in der DDR
- Entwicklungsperioden der Sozialpolitik der DDR
- frauenorientierte Sozialpolitik
- Frauenleitbild
- Frauenerwerbsarbeit
- Familienpolitik in der DDR
- Ziele und Leitbild
- Maßnahmen
- Probleme der Familienpolitik
- frauenorientierte Sozialpolitik
- DDR und BRD im Vergleich - Auswirkungen der Wiedervereinigung im Bezug auf die Familienpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sozialpolitik der DDR, insbesondere mit der Familienpolitik. Ziel ist es, die Entwicklung der Familienpolitik in der DDR im Kontext der geschichtlichen Hintergründe und der politischen Kultur zu analysieren. Dabei werden die Ziele, Maßnahmen und Probleme der Familienpolitik sowie die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Familienpolitik in Deutschland beleuchtet.
- Die Entstehung der DDR und die politische Kultur
- Die Entwicklung der Sozialpolitik in der DDR
- Die Rolle der Frau in der DDR und die Frauenpolitik
- Die Ziele und Maßnahmen der Familienpolitik in der DDR
- Der Vergleich der Familienpolitik in der DDR und der BRD
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sozialpolitik in der DDR ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Gliederung der Arbeit vor. Das Kapitel "geschichtliche Hintergründe" beleuchtet die Entstehung der DDR im Kontext des Kalten Krieges und der politischen Kultur. Es werden die offizielle und inoffizielle politische Kultur der DDR sowie die wichtigsten Zäsuren in der politischen Geschichte der DDR dargestellt. Das Kapitel "Definitionen" erläutert die Begriffe Sozialpolitik, Familienpolitik und Familie im Kontext der DDR. Es werden die Unterschiede zwischen der Familienpolitik in der DDR und der BRD aufgezeigt. Das Kapitel "Entwicklungsperioden der Sozialpolitik der DDR" analysiert die Entwicklung der Sozialpolitik in der DDR, insbesondere die frauenorientierte Sozialpolitik und die Familienpolitik. Es werden die Ziele, Maßnahmen und Probleme der Familienpolitik in der DDR dargestellt. Das Kapitel "DDR und BRD im Vergleich - Auswirkungen der Wiedervereinigung im Bezug auf die Familienpolitik" vergleicht die Familienpolitik in der DDR und der BRD und analysiert die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Familienpolitik in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sozialpolitik der DDR, die Familienpolitik, die Frauenpolitik, die politische Kultur der DDR, die Wiedervereinigung und die Auswirkungen auf die Familienpolitik in Deutschland. Der Text beleuchtet die Entwicklung der Familienpolitik in der DDR, die Ziele und Maßnahmen der Familienpolitik sowie die Rolle der Frau in der DDR. Der Vergleich der Familienpolitik in der DDR und der BRD sowie die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Familienpolitik in Deutschland runden den Text ab.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenleitbild herrschte in der DDR vor?
Die Frau wurde primär als Arbeitskraft gesehen, die gleichzeitig für die Nachwuchsreproduktion und die Erziehung im sozialistischen Sinne verantwortlich war.
Warum war die Sozialpolitik in der DDR frauenorientiert?
Aufgrund der massiven Abwanderung von Fachkräften war der Staat auf das Arbeitspotenzial der Frauen angewiesen und schuf Anreize wie Kinderbetreuung und finanzielle Leistungen, um Beruf und Familie zu vereinbaren.
Was waren die Hauptziele der Familienpolitik in der DDR?
Ziele waren die Erhöhung der Geburtenrate, die Förderung der Frauenerwerbstätigkeit und die Erziehung der Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten in staatlichen Einrichtungen.
Wie unterschied sich die Familienpolitik der DDR von der der BRD?
Während die DDR auf staatliche Kollektivbetreuung und Erwerbstätigkeit beider Eltern setzte, war die BRD lange Zeit eher am traditionellen Ein-Verdiener-Modell (Hausfrauenehe) orientiert.
Welche Auswirkungen hatte die Wiedervereinigung auf die Familienpolitik?
Die Wiedervereinigung führte zu einem Systemwechsel für die Bürger der ehemaligen DDR, wobei viele staatliche Infrastrukturen (wie flächendeckende Kita-Plätze) zunächst abgebaut oder an westdeutsche Standards angepasst wurden.
- Quote paper
- Anne Andraschko (Author), 2011, Familienpolitik der DDR - frauenorientierte Sozialpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184302