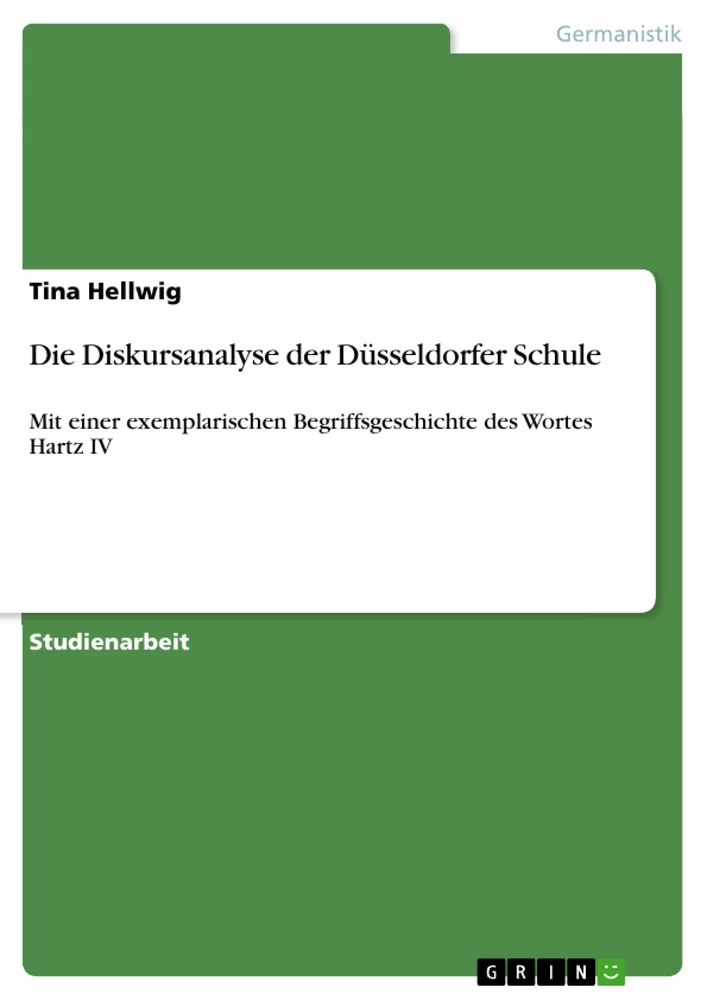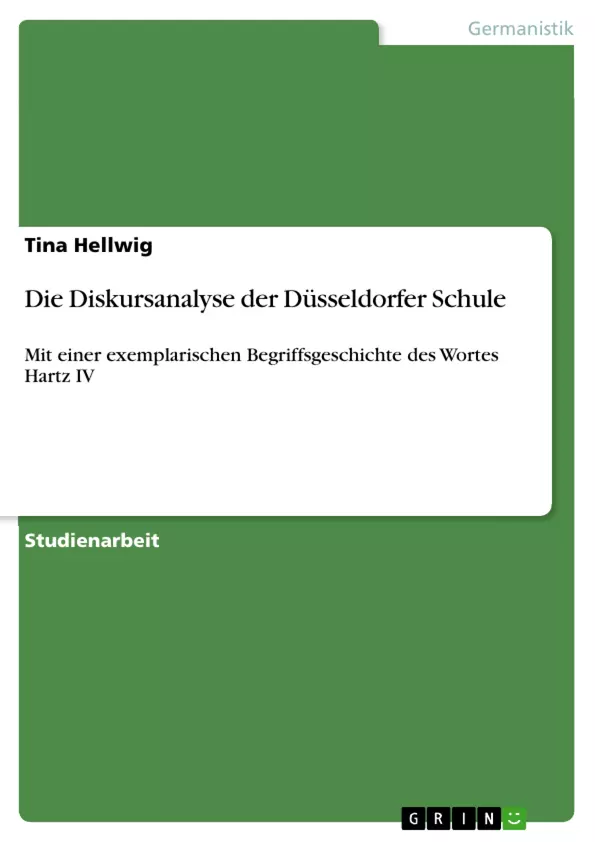Gliederung:
Einleitung
Teil A: Die Düsseldorfer Schule
1. Geschichte der Düsseldorfer Schule
2. Ziele der „Düsseldorfer Schule“
3. Themen der Diskurse
4. Arbeit mit Textkorpora
5. Arbeitsmethoden
5.1 Schlüsselwörter
5.2 Metaphernanalyse
5.3 International vergleichende Diskurs- und Argumentationsanalyse
Teil B: Eine Begriffsgeschichte am Beispiel des Wortes "Hartz-IV"
1. Die Entstehung des Begriffes Hartz-IV
2. Etablierung des Begriffes in der Gesellschaft
2.1 Hartz-IV-Komposita
2.1.1 Geschichte der Hartz-IV-Komposita
2.1.2 Neutrale Komposita
2.1.3 Komposita mit negativer Bedeutung des Begriffes
2.2 Hartz-IV als Wort des Jahres
3. Hartz-IV-Umbenennung
Fazit
Literaturverzeichnis
Teil A
Teil B
Gesamtlänge: 31 Seiten
Textauszug:
2.1.1 Geschichte der Hartz-IV-Komposita
Die Verbindung zweier Wörter zu einem Begriff ist besonders im Zusammenhang mit dem Wort Hartz-IV weit verbreitet. Eine solche Wortneuschöpfung erlaubt es dem Redner spezifische Inhalte zu vermitteln und sein Ziel der möglichst genauen Wiedergabe seiner Gedanken möglichst schnell zu erreichen. Die Verwendung der Komposita ist also eine Frage der Sprachökonomie.
Solche Komposita wurden von der Presse bereits zum Beginn des Diskurses um die Reform des Arbeitslosengeldes im Jahr 2002 eingeführt. Dabei waren Komposita wie Hartz-Gesetze oder Hartz-Plan noch wertfrei und bezeichneten objektiv einen Themengegenstand.
Nachdem ab dem 01.01.2005 die finanzielle Unterstützung von Nicht-Erwerbstätigen in Form des Arbeitslosengeldes II anlief, häuften sich die Kritiken zu der Reform und es kam zu einem breit angelegten Diskurs in der Öffentlichkeit. Zu geringe Regelsätze für die Betroffenen, zu große Belastungen für den Bundeshaushalt und zu aggresive Eingriffe des Staates in die Privatsphäre der Bevölkerung, wenn es etwa um die Berechnung des individuellen Regelsatzes ging, führten zu zahlreichen Protesten. Natürlich beeinflussten die Medien dieses öffentliche Streitthema mit ihren Berichterstattungen. Zum ersten Mal kritisiert der Spiegel im Oktober das Hartz-Debakel (auch: Hartz-Desaster) und das kaum überschaubare Geflecht der Hartz-IV-Töpfe unter der Überschrift „Das Spiel mit den Armen - Wie der Sozialstaat zur Selbstbedienung einlädt."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A: Die Düsseldorfer Schule
- Geschichte der Düsseldorfer Schule
- Ziele der „Düsseldorfer Schule“
- Themen der Diskurse
- Arbeit mit Textkorpora
- Arbeitsmethoden
- Schlüsselwörter
- Metaphernanalyse
- International vergleichende Diskurs- und Argumentationsanalyse
- Teil B: Eine Begriffsgeschichte am Beispiel des Wortes „Hartz-IV“
- Die Entstehung des Begriffes Hartz-IV
- Etablierung des Begriffes in der Gesellschaft
- Hartz-IV-Komposita
- Geschichte der Hartz-IV-Komposita
- Neutrale Komposita
- Komposita mit negativer Bedeutung des Begriffes
- Hartz-IV als Wort des Jahres
- Hartz-IV-Komposita
- Hartz-IV-Umbenennung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Teil A
- Teil B
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Diskursanalyse der „Düsseldorfer Schule“ und untersucht deren Ziele, Arbeitsmethoden und Forschungsgegenstand. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über diesen Forschungszweig zu geben, der Sprachgeschichte als Zeitgeschichte versteht. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die grundlegenden Prinzipien der „Düsseldorfer Schule“ und verzichtet auf die detaillierte Analyse spezifischer Forschungsergebnisse einzelner Mitglieder.
- Die „Düsseldorfer Schule“ als Forschungszweig der Sprachgeschichte
- Die Bedeutung von Diskursen für die Analyse von Sprachwandel und gesellschaftlichen Entwicklungen
- Die Arbeitsmethoden der „Düsseldorfer Schule“, insbesondere die Analyse von Schlüsselwörtern und Metaphern
- Die Anwendung der Diskursanalyse am Beispiel des Wortes „Hartz-IV“
- Die Etablierung und Entwicklung des Begriffs „Hartz-IV“ in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „Düsseldorfer Schule“ als Forschungszweig der Sprachgeschichte vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung der Diskursanalyse für das Verständnis von Sprachwandel und gesellschaftlichen Entwicklungen hervor.
Das erste Kapitel beleuchtet die Geschichte der „Düsseldorfer Schule“, die von Georg Stötzel in den 1970er Jahren begründet wurde. Es wird erläutert, wie Stötzel die Linguistik um eine sozialhistorische Komponente erweiterte und damit einen neuen Forschungszweig etablierte, der Sprachgeschichte als Zeitgeschichte versteht.
Das zweite Kapitel beschreibt die Ziele der „Düsseldorfer Schule“. Es wird deutlich, dass die „Düsseldorfer Schule“ die Heterogenität von Sprache in einer Demokratie durch die Analyse von relevanten Diskursen reflektieren möchte.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Themen der Diskurse, die von der „Düsseldorfer Schule“ untersucht werden. Es wird erläutert, wie die „Düsseldorfer Schule“ die Analyse von Diskursen nutzt, um Sprachwandel und gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen.
Das vierte Kapitel behandelt die Arbeit mit Textkorpora, die von der „Düsseldorfer Schule“ verwendet werden. Es wird erläutert, wie die „Düsseldorfer Schule“ Textkorpora nutzt, um Diskursanalysen durchzuführen.
Das fünfte Kapitel beschreibt die Arbeitsmethoden der „Düsseldorfer Schule“. Es werden die wichtigsten Methoden wie die Analyse von Schlüsselwörtern, die Metaphernanalyse und die international vergleichende Diskurs- und Argumentationsanalyse vorgestellt.
Das sechste Kapitel widmet sich der Begriffsgeschichte des Wortes „Hartz-IV“. Es wird die Entstehung des Begriffes, seine Etablierung in der Gesellschaft und die negative Konnotation, die er im Laufe der Jahre erhalten hat, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Diskursanalyse, die „Düsseldorfer Schule“, Sprachgeschichte, Zeitgeschichte, Schlüsselwörter, Metaphernanalyse, Hartz-IV, Begriffsgeschichte, Sprachwandel, gesellschaftliche Entwicklungen und Diskursforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Düsseldorfer Schule“ der Diskursanalyse?
Es handelt sich um einen Forschungszweig der Sprachgeschichte, der von Georg Stötzel begründet wurde. Er versteht Sprachgeschichte als Zeitgeschichte und analysiert gesellschaftliche Diskurse linguistisch.
Wie wird der Begriff „Hartz-IV“ diskursanalytisch untersucht?
Die Analyse betrachtet die Entstehung, Etablierung und die Bildung von Komposita (Wortzusammensetzungen), die oft eine negative oder wertende Konnotation in der öffentlichen Debatte transportieren.
Welche Arbeitsmethoden nutzt die Düsseldorfer Schule?
Zentrale Methoden sind die Analyse von Schlüsselwörtern, die Metaphernanalyse sowie der internationale Vergleich von Diskurs- und Argumentationsstrukturen in Textkorpora.
Warum sind „Schlüsselwörter“ in der Diskursanalyse wichtig?
Schlüsselwörter bündeln gesellschaftliche Themen und Konflikte. Ihre Verwendung und Veränderung im Laufe der Zeit geben Aufschluss über den sozialen und politischen Wandel.
Was sind Hartz-IV-Komposita?
Das sind Wortneuschöpfungen wie „Hartz-IV-Empfänger“ oder „Hartz-IV-Debakel“. Sie dienen der Sprachökonomie, können aber auch gezielt zur Abwertung oder Stigmatisierung eingesetzt werden.
- Arbeit zitieren
- Tina Hellwig (Autor:in), 2011, Die Diskursanalyse der Düsseldorfer Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184334