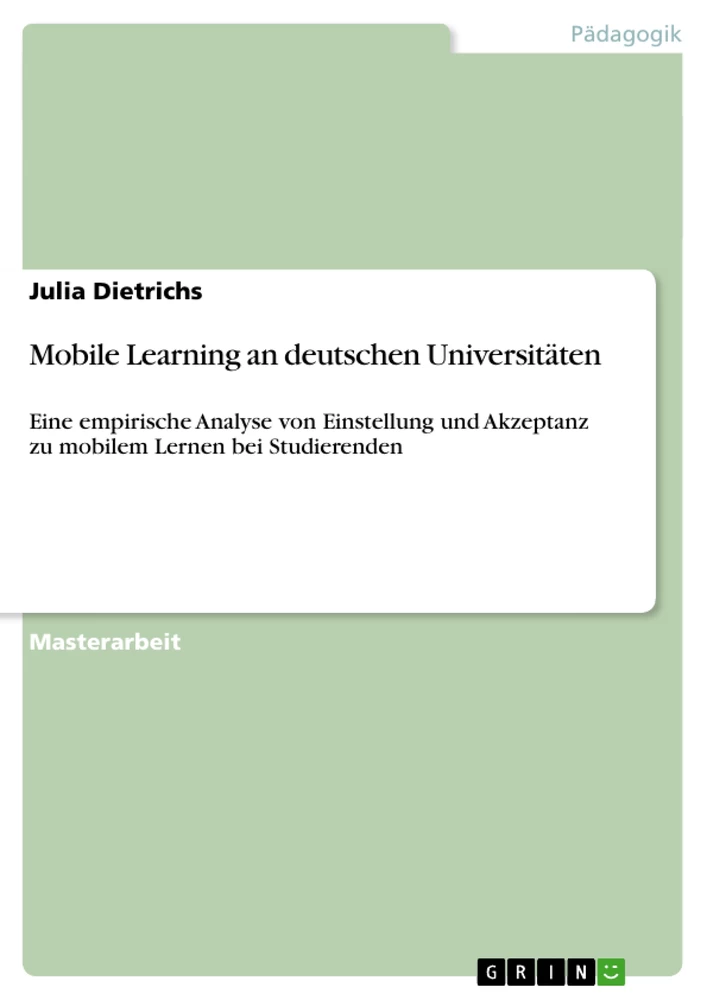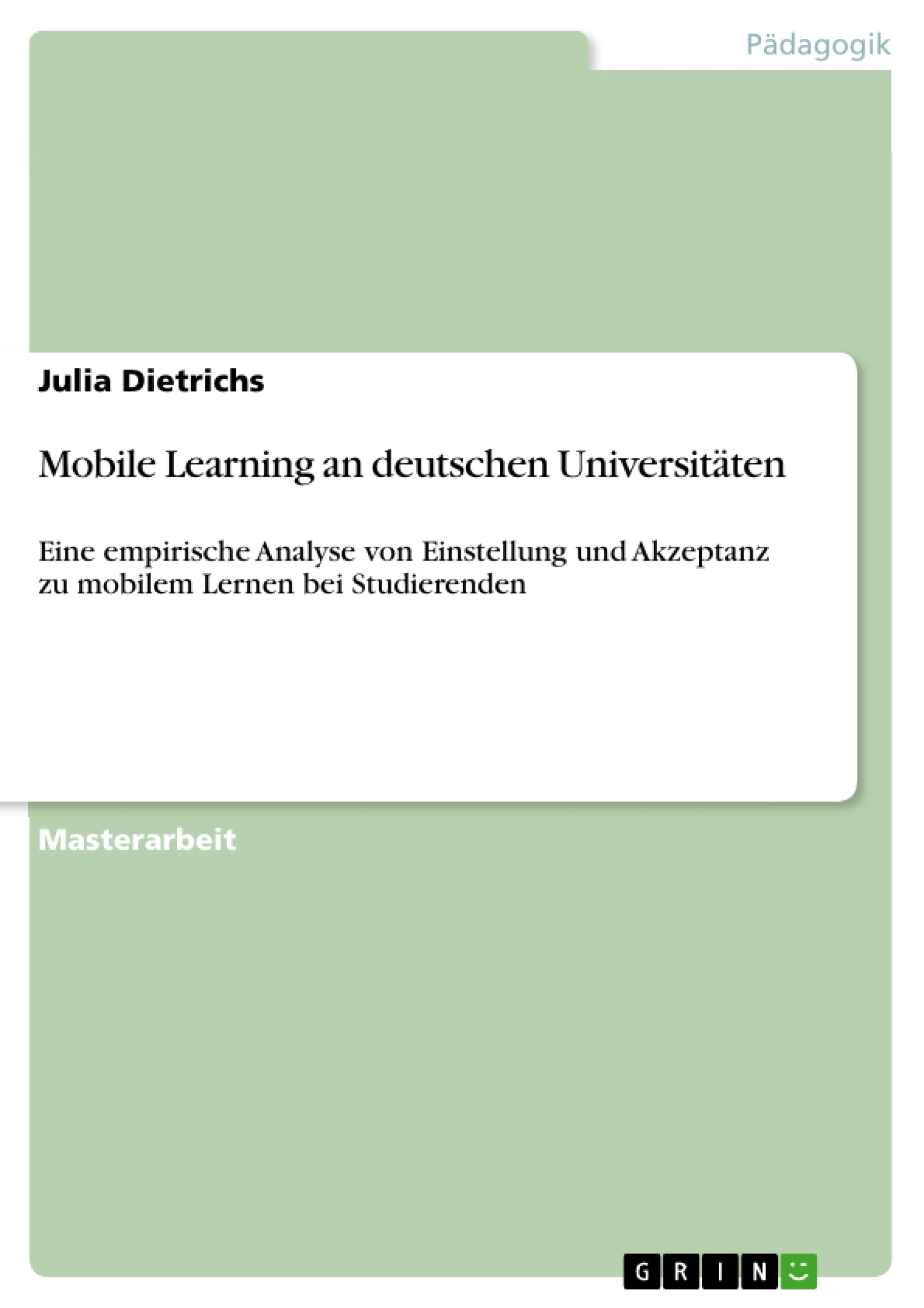Mobiltelefone, Smartphones, PDAs und andere mobile Endgeräte wie beispielweise Netbooks oder Smartpads sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Durch die steigende Verbreitung sowie den gesellschaftlichen Wandel ändert sich auch das Nutzungs- und Anspruchsverhalten der Individuen. [...]
Einen großen Einfluss auf diesen Wandel hat neben den technologischen Entwicklungen bei den Endgeräten auch die steigende Internetnutzung. [...] Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Veränderungen des studentischen Lernens wider. So verwundert es niemanden mehr, dass sowohl in Literatur als auch in Praxis immer häufiger über Mobile Learning und seine Anwendungsmöglichkeiten an Universitäten und in Unternehmen diskutiert wird. Besonders seit der Markteinführung des iPads von Apple wird Mobile Learning verstärkt in der Fachpresse erwähnt.
Der Ansatz des Mobile Learnings fokussiert sich dabei auf die Mobilität des Lernortes. Mobile Learning soll nicht die klassischen Lernmedien oder Electronic Learning-Plattformen ersetzen, sondern als eine Erweiterung gesehen werden, als Möglichkeit zwischendurch und spontan kurze Lernphasen zu nutzen.
Da mobile Endgeräte über ein immer größer werdendes Leistungsspektrum verfügen, ergeben sich neue Potentiale, die es zu ergründen gilt. Inwieweit Mobilfunkgeräte zum mobilen Lernen geeignet sind, ist derzeit noch nicht in vollem Maße geklärt und soll in dieser Arbeit genauso untersucht werden wie die Bereitschaft von Studierenden, die jeweiligen Medien zum mobilen Lernen zu nutzen.
Demzufolge soll im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, wie Studenten zurzeit lernen und wie ihre Einstellung bezüglich mobiler Medien und dem Mobile Learning ist. Dies geschieht anhand einer empirischen Untersuchung an deutschen Universitäten. Aufgrund der Ergebnisse sowie einer ausführlichen Literaturrecherche soll die aktuelle Lernsituation dargestellt werden, um abschließend eine Handlungsempfehlung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen in der Lernübermittlung an deutschen Hochschulen zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Aufgabenstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Definitorische Grundlagen
- Einstellung
- Lernen
- Mobilität
- Technischen Grundlagen
- Mobile Endgeräte
- Funktionen mobiler Endgeräte
- Datenübertragungsmöglichkeiten
- Mobile Learning
- Electronic Learning
- Mobile Learning
- Vor- und Nachteile des Mobile Learning
- Praxisbeispiele zum Mobile Learning
- Empirische Untersuchung
- Marktforschung
- Prozess der Befragung
- Problemstellung
- Auswahl der Erhebungsmethode
- Fragebogendesign
- Untersuchungserhebung
- Analyse und Dokumentation
- Interpretation der Ergebnisse
- Handlungsempfehlung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Papierbasierte Quellen
- Online-Quellen
- Anhang A: Der Fragebogen
- Anhang B: Die Auswertung
- Anhang C: Kodierbogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Mobile Learning an deutschen Universitäten und analysiert die Einstellung und Akzeptanz von Studierenden gegenüber dieser Lernform. Die Arbeit zielt darauf ab, die Nutzung von mobilen Endgeräten im Lernprozess zu untersuchen und die Faktoren zu identifizieren, die die Akzeptanz von Mobile Learning beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung von Mobile Learning
- Analyse der technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten von Mobile Learning
- Untersuchung der Einstellungen und Akzeptanz von Studierenden gegenüber Mobile Learning
- Identifizierung von Faktoren, die die Akzeptanz von Mobile Learning beeinflussen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Implementierung von Mobile Learning an Universitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mobile Learning an deutschen Universitäten ein und erläutert die Aufgabenstellung und Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt den Aufbau der Arbeit dar und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den definitorischen Grundlagen des Mobile Learning. Es werden die Begriffe Einstellung, Lernen, Mobilität und technische Grundlagen definiert und erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Mobile Learning als Lernform. Es werden die Entwicklung und die Vor- und Nachteile des Mobile Learning im Vergleich zu traditionellen Lernformen dargestellt. Außerdem werden Praxisbeispiele für die Anwendung von Mobile Learning an Universitäten vorgestellt.
Das vierte Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die im Rahmen der Arbeit durchgeführt wurde. Es werden die Methodik der Untersuchung, die Auswahl der Stichprobe und die Durchführung der Befragung erläutert.
Das fünfte Kapitel interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Einstellungen und Akzeptanz von Studierenden gegenüber Mobile Learning analysiert und die Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von Mobile Learning identifiziert.
Das sechste Kapitel enthält Handlungsempfehlungen für die Implementierung von Mobile Learning an Universitäten. Es werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um die Akzeptanz von Mobile Learning bei Studierenden zu erhöhen und die Nutzung von Mobile Learning im Lernprozess zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Mobile Learning, Einstellung, Akzeptanz, Studierende, Universität, technische Grundlagen, mobile Endgeräte, E-Learning, Lernformen, empirische Untersuchung, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Mobile Learning?
Mobile Learning nutzt mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, um ortsunabhängiges, spontanes und oft kurzes Lernen in den Alltag zu integrieren.
Soll Mobile Learning das E-Learning ersetzen?
Nein, es wird als sinnvolle Erweiterung zu klassischen Lernmedien und stationären E-Learning-Plattformen gesehen, nicht als Ersatz.
Welche Vorteile bietet Mobile Learning für Studierende?
Die Hauptvorteile sind die Mobilität des Lernortes, die Möglichkeit, Wartezeiten sinnvoll zu nutzen, und der schnelle Zugriff auf Informationen.
Wie ist die Akzeptanz von Mobile Learning an deutschen Unis?
Die Akzeptanz hängt stark von der technischen Ausstattung und der didaktischen Aufbereitung der Inhalte ab, wie empirische Untersuchungen zeigen.
Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?
Notwendig sind leistungsfähige mobile Endgeräte, stabile Datenübertragungsmöglichkeiten und für Mobilgeräte optimierte Lernplattformen.
- Citation du texte
- Dipl.-Oec, M.A. Julia Dietrichs (Auteur), 2011, Mobile Learning an deutschen Universitäten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184402