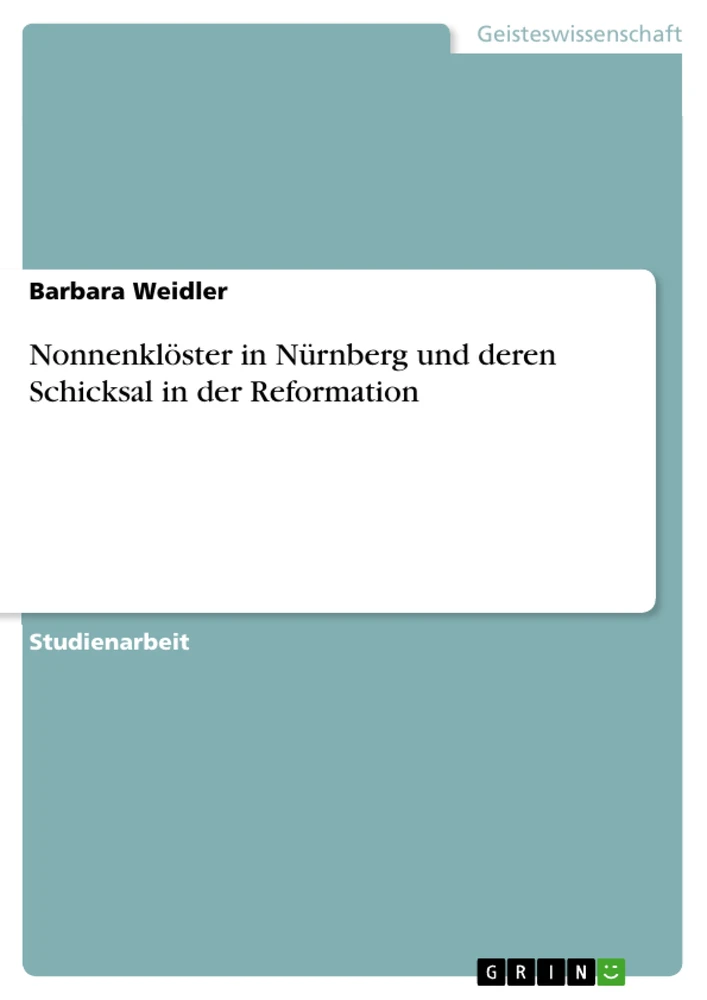Ende 2007 eröffnete St. Klara nach langem Umbau als „offene Kirche St. Klara“ ihre Pforten. Nicht viele wissen, dass St. Klara früher Teil des Klarissinenklosters war und damit alles andere als offen war. Wenn man durch Nürnberg geht, findet man viele Gebäude, die einmal Kloster waren – das bekannteste ist hier wohl die Katharinenruine. Doch auch das Lokal „Der Barfüßer“, die Egidienkirche, das germanische Nationalmuseum und der Augustinerhof waren Teile von Klöstern. Um zu verstehen, warum es heute in Nürnberg keine Klöster mehr gibt, muss man sich mit der Zeit der Reformation und dem Geschehen in Nürnberg zu dieser Zeit auseinandersetzen. In dieser Arbeit wird das Schicksal der beiden Nonnenklöster betrachtet, weil deren Auflösung im Zuge der Reformation am konfliktreichsten war.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geschichte der Klöster und Klosterleben bis zur Reformation
- 2.1 Das Klarissinenkloster
- 2.1.1 Klosterreformen vor 1500
- 2.1.2 Alltagsleben
- 2.1.2.1 Spirituelles
- 2.1.2.2 Handwerkliche Arbeit
- 2.1.2.3 Finanzielle Situation
- 2.1.3 Die Äbtissin Caritas Pirckheimer
- 2.2 Das Katharinenkloster
- 3 Die Reformation in Nürnberg
- 3.1 Kritik der Reformation an den Klöstern
- 3.2 Die Nürnberger Religionsgespräche
- 4 Reaktion der Klöster auf die Reformation und deren Folgen für die Klöster
- 4.1 Klarissinenkloster
- 4.1.1 Entzug der bisherigen Prediger
- 4.1.2 Unfreiwillige Austritte
- 4.1.3 Überredungsversuche der Reformationsanhänger
- 4.1.4 Gespräch mit Melanchthon
- 4.1.5 Aussterben des Klosters
- 4.2 Katharinenkloster
- 4.2.1 Klosteraustritte
- 4.2.2 Aktiver und passiver Widerstand
- 4.2.2.1 Heimliches Einschleusen von Schwestern
- 4.2.2.2 Bittschreiben an den Kaiser
- 4.2.3 Finanzieller Ruin
- 4.2.3.1 Finanzielle Abhängigkeit vom Rat
- 4.2.3.2 Wegfall der Einnahmen und Steigerung der Ausgaben
- 4.2.4 Übernahme der Verwaltung und das Ende des Klosters
- 4.3 Weitere Klöster
- 5 Verkehrung der reformatorischen Ideale bei der Schließung der Klöster
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Schicksal der beiden Nonnenklöster in Nürnberg, dem Klarissinenkloster und dem Katharinenkloster, im Kontext der Reformation. Sie beleuchtet die Geschichte der Klöster und ihre Entwicklung bis zur Reformation, analysiert die Kritik der Reformation an den Klöstern und die darauf folgenden Reaktionen der Klöster.
- Das Klosterleben vor der Reformation und seine Herausforderungen
- Die Kritik der Reformation an den Klöstern und deren Auswirkungen
- Der Widerstand der Klöster gegen die Reformation und ihre Folgen
- Die Rolle der Äbtissin Caritas Pirckheimer im Klarissinenkloster
- Die Verkehrung reformatorischer Ideale bei der Schließung der Klöster
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel widmet sich der Geschichte der beiden Klöster und ihren Lebensweisen bis zur Reformation. Hierbei wird insbesondere die Entwicklung des Klarissinenklosters unter dem Einfluss der Observanzbewegung beleuchtet, die zu einer Reform des Klosterlebens führte. Im dritten Kapitel werden die Kritik der Reformation an den Klöstern und die Nürnberger Religionsgespräche thematisiert. Das vierte Kapitel beschreibt die Reaktion der Klöster auf die Reformation, insbesondere den Widerstand des Katharinenklosters durch heimliches Einschleusen von Schwestern und Bittschreiben an den Kaiser.
Schlüsselwörter
Klarissinenkloster, Katharinenkloster, Nürnberg, Reformation, Klosterleben, Observanz, Caritas Pirckheimer, Widerstand, Religionsgespräche, finanzielle Situation, Klosterreformen.
- Citar trabajo
- Barbara Weidler (Autor), 2009, Nonnenklöster in Nürnberg und deren Schicksal in der Reformation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184563