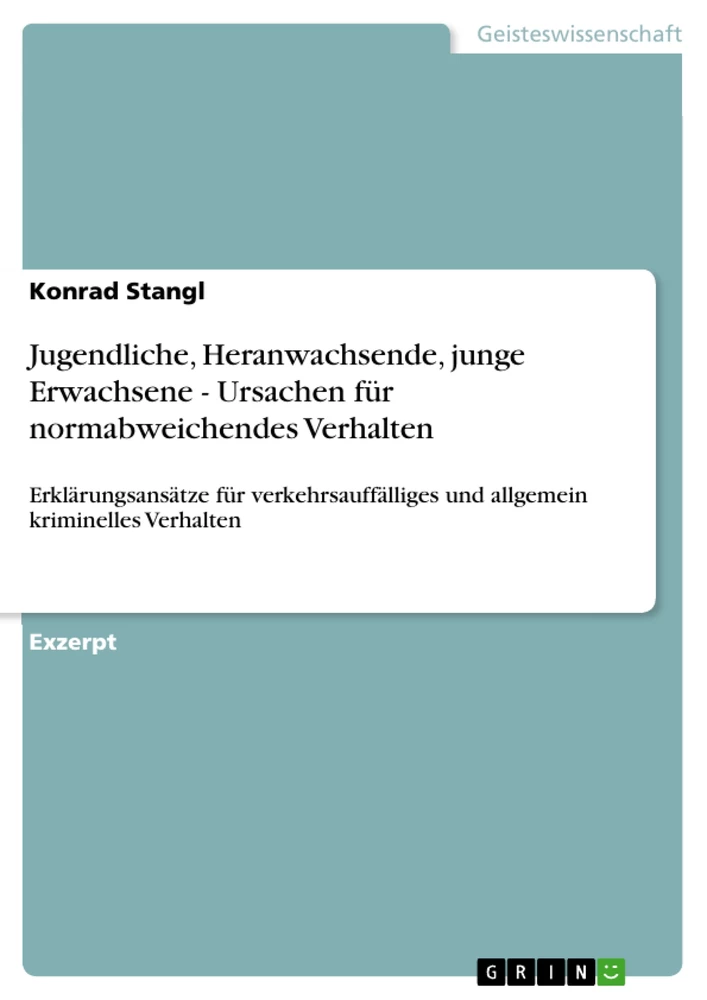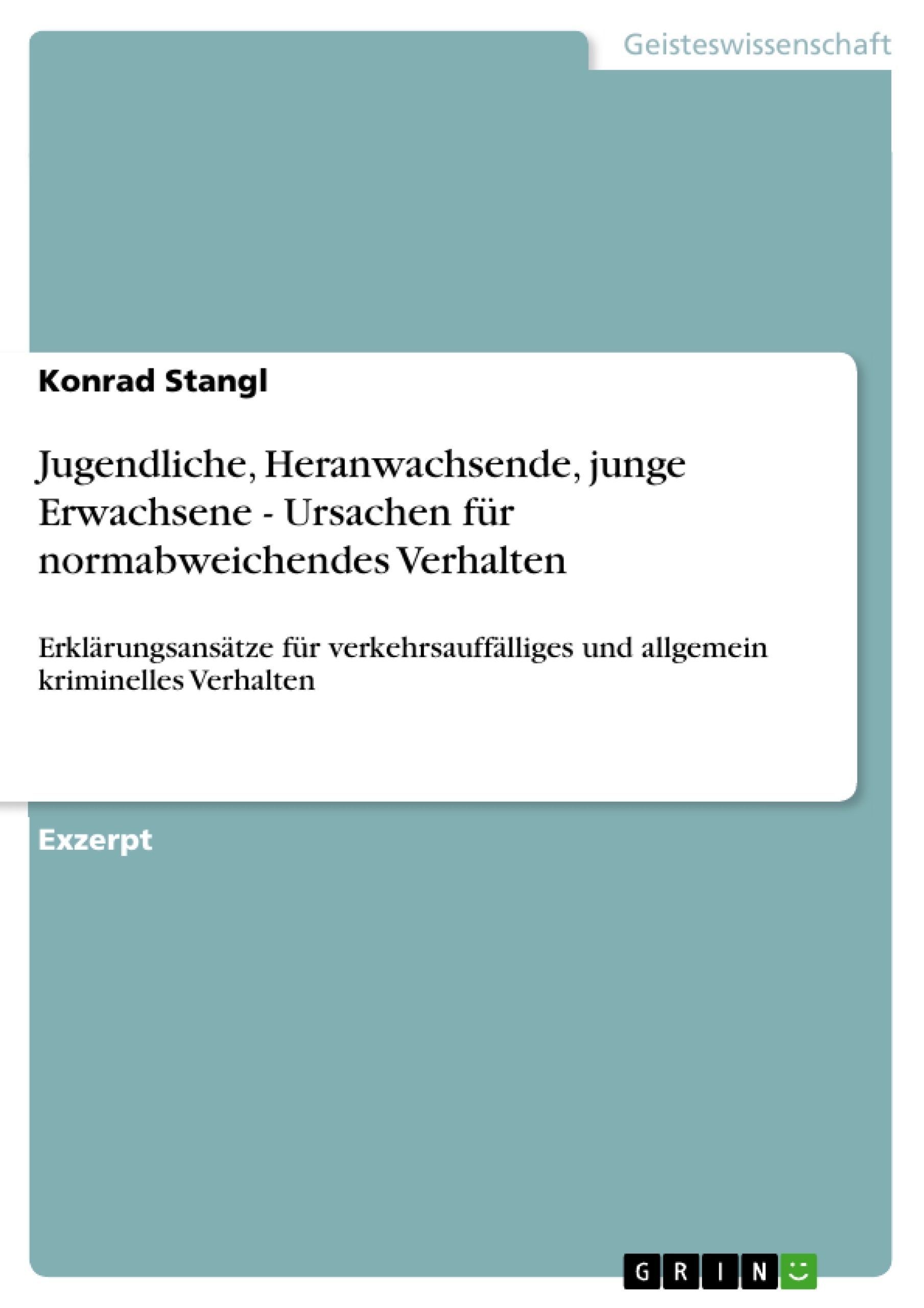Kriminalitätskontrolle ist ohne fundiertes Wissen über das Verbrechen nicht denkbar. Die Kriminologie als wissenschaftliche Disziplin hat dabei die Aufgabe, „das Wissen über Kriminalität (und ihre Kontrolle) zu vermehren, zu vertiefen und über die Lehre zu vermitteln.“
Hauptanliegen der Kriminologie ist die Erklärung des Verbrechens, denn insbesondere die Prävention ist ohne Kenntnisse der Entstehungsbedingungen nicht vorstellbar. Jede Einflussgröße in der Entstehung der Straftat (des Rechtsbruchs) ist zugleich ein Ansatzpunkt für Maßnahmen der Prävention. „Die Faktoren sollten dort blockiert werden, wo sie ihren Ursprung haben.“
Die nachfolgende Darstellung stellt nur eine Auswahl aktueller bzw. herausragender Theorien dar; um einen Überblick zu anwendungsbezogenen Ansätzen zu geben, werden klassische Kriminalitätstheorien aus den Bereichen Psychologie, Soziologie und Sozialpsychologie sowie der Mehrfaktorenansatz und das Integrationsmodell gewählt.
Inhaltsverzeichnis
- Jugendliche, Heranwachsende, „junge Erwachsene“ – Begriffsdefinitionen
- Phänomenologie
- Erklärungsansätze für kriminelles Verhalten junger Menschen
- Psychologische und sozialpsychologische Erklärungsansätze
- Kontrolltheorie
- Lerntheoretische Ansätze
- Die Aggressionstheorien
- Die soziologisch orientierte Anomietheorie
- Der additive Mehrfaktorenansatz
- Das Integrationsmodell
- Sozialisation junger Menschen
- Psychologische und sozialpsychologische Erklärungsansätze
- Erklärungsversuche für Verkehrsdelinquenz junger Menschen
- Lebensstil und Verkehrsverhalten junger Fahrer und Fahrerinnen
- Der Einfluss der Peer-Group – informelle soziale Kontrolle („Peer-Sozialisation“)
- Die Charakteristik des Alkoholfahrers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen normabweichenden Verhaltens bei Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen zu untersuchen, mit besonderem Fokus auf verkehrsauffälliges und kriminelles Verhalten. Sie analysiert verschiedene Erklärungsansätze aus psychologischer, sozialpsychologischer und soziologischer Perspektive.
- Begriffsdefinitionen von Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen
- Phänomenologie kriminellen und verkehrsauffälligen Verhaltens junger Menschen
- Psychologische und sozialpsychologische Erklärungsansätze für kriminelles Verhalten
- Soziologische Erklärungsansätze für kriminelles Verhalten
- Erklärungsansätze für Verkehrsdelinquenz junger Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Jugendliche, Heranwachsende, „junge Erwachsene“ – Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt die verwendeten Begriffe und definiert die Altersgruppen, die im Fokus der Untersuchung stehen. Es betont die Schwierigkeit, den Begriff „junger Erwachsener“ präzise zu definieren und verwendet in Anlehnung an statistische Daten die Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen als Zielgruppe. Die rechtliche Definition von Jugendlichen und Heranwachsenden nach dem Jugendgerichtsgesetz wird ebenfalls erläutert. Die sich verändernde demografische Struktur und die Ausdifferenzierung der Lebensphasen werden als Hintergrundinformationen einbezogen.
Phänomenologie: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten, die belegen, dass die Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen überproportional im Bereich der Kriminalität und Verkehrsdelikte auftritt. Es hebt die ungleiche Delinquenzbelastung zwischen Männern und Frauen hervor und benennt die 18- bis 24-Jährigen als besonders gefährdete Gruppe im Straßenverkehr, insbesondere im Zusammenhang mit Alkoholkonsum am Steuer. Die statistische Evidenz unterstreicht die Relevanz der Thematik.
Erklärungsansätze für kriminelles Verhalten junger Menschen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Theorien zur Erklärung kriminellen Verhaltens junger Menschen. Es werden psychologische, sozialpsychologische und soziologische Ansätze vorgestellt, wobei die unterschiedlichen Grade der Einbeziehung gesellschaftlicher Prozesse hervorgehoben werden. Das Kapitel betont die Bedeutung der Prävention und die Notwendigkeit, die Entstehungsbedingungen von Kriminalität zu verstehen, um effektive Maßnahmen entwickeln zu können. Die Auswahl an Theorien soll einen anwendungsbezogenen Überblick bieten.
Erklärungsversuche für Verkehrsdelinquenz junger Menschen: Dieses Kapitel widmet sich spezifisch der Verkehrsdelinquenz junger Menschen. Es untersucht den Einfluss des Lebensstils und des Verkehrsverhaltens, die Rolle der Peergroup und die Charakteristik von Alkoholkonsum im Zusammenhang mit Fahren. Der Fokus liegt auf der Analyse der Faktoren, die zu riskantem Fahrverhalten bei jungen Menschen beitragen, wobei die soziale Kontrolle und die Beeinflussung durch Gleichaltrige besonders relevant erscheinen.
Schlüsselwörter
Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene, normabweichendes Verhalten, Kriminalität, Verkehrsdelinquenz, Kontrolltheorien, Lerntheorien, Aggressionstheorien, Anomietheorie, Mehrfaktorenansatz, Integrationsmodell, Sozialisation, Peer-Group, Alkoholkonsum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ursachen normabweichenden Verhaltens bei Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen
Was sind die zentralen Themen des Textes?
Der Text untersucht die Ursachen normabweichenden Verhaltens bei Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen, mit besonderem Fokus auf kriminelles und verkehrsauffälliges Verhalten. Er analysiert verschiedene Erklärungsansätze aus psychologischer, sozialpsychologischer und soziologischer Perspektive und beleuchtet die Bedeutung von Prävention.
Welche Altersgruppen werden im Text betrachtet?
Der Text konzentriert sich auf die Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen, wobei die begrifflichen Unterschiede zwischen Jugendlichen, Heranwachsenden und „jungen Erwachsenen“ geklärt und die jeweiligen rechtlichen Definitionen erläutert werden. Die demografische Entwicklung und die Ausdifferenzierung der Lebensphasen werden als Hintergrundinformationen berücksichtigt.
Welche Erklärungsansätze für kriminelles Verhalten werden vorgestellt?
Der Text präsentiert eine Auswahl an psychologischen, sozialpsychologischen und soziologischen Erklärungsansätzen für kriminelles Verhalten. Dazu gehören Kontrolltheorien, Lerntheorien, Aggressionstheorien, die Anomietheorie, der additive Mehrfaktorenansatz, das Integrationsmodell und Überlegungen zur Sozialisation. Die unterschiedlichen Grade der Einbeziehung gesellschaftlicher Prozesse werden hervorgehoben.
Wie wird Verkehrsdelinquenz junger Menschen erklärt?
Der Text analysiert die Verkehrsdelinquenz junger Menschen unter Berücksichtigung des Lebensstils, des Verkehrsverhaltens, des Einflusses der Peergroup (informelle soziale Kontrolle), und des Alkoholkonsums am Steuer. Der Fokus liegt auf Faktoren, die zu riskantem Fahrverhalten beitragen.
Welche Phänomenologie kriminellen und verkehrsauffälligen Verhaltens wird beschrieben?
Der Text präsentiert statistische Daten, die die überproportionale Beteiligung der 14- bis 24-Jährigen an Kriminalität und Verkehrsdelikten belegen. Die ungleiche Delinquenzbelastung zwischen Männern und Frauen wird hervorgehoben, ebenso die besondere Gefährdung der 18- bis 24-Jährigen im Straßenverkehr, insbesondere im Zusammenhang mit Alkoholkonsum.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene, normabweichendes Verhalten, Kriminalität, Verkehrsdelinquenz, Kontrolltheorien, Lerntheorien, Aggressionstheorien, Anomietheorie, Mehrfaktorenansatz, Integrationsmodell, Sozialisation, Peer-Group, Alkoholkonsum.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die Ursachen normabweichenden Verhaltens bei Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen zu untersuchen und verschiedene Erklärungsansätze aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren. Der Text betont die Bedeutung des Verständnisses der Entstehungsbedingungen von Kriminalität für die Entwicklung effektiver Präventionsmaßnahmen.
- Quote paper
- Konrad Stangl (Author), 2012, Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene - Ursachen für normabweichendes Verhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184740