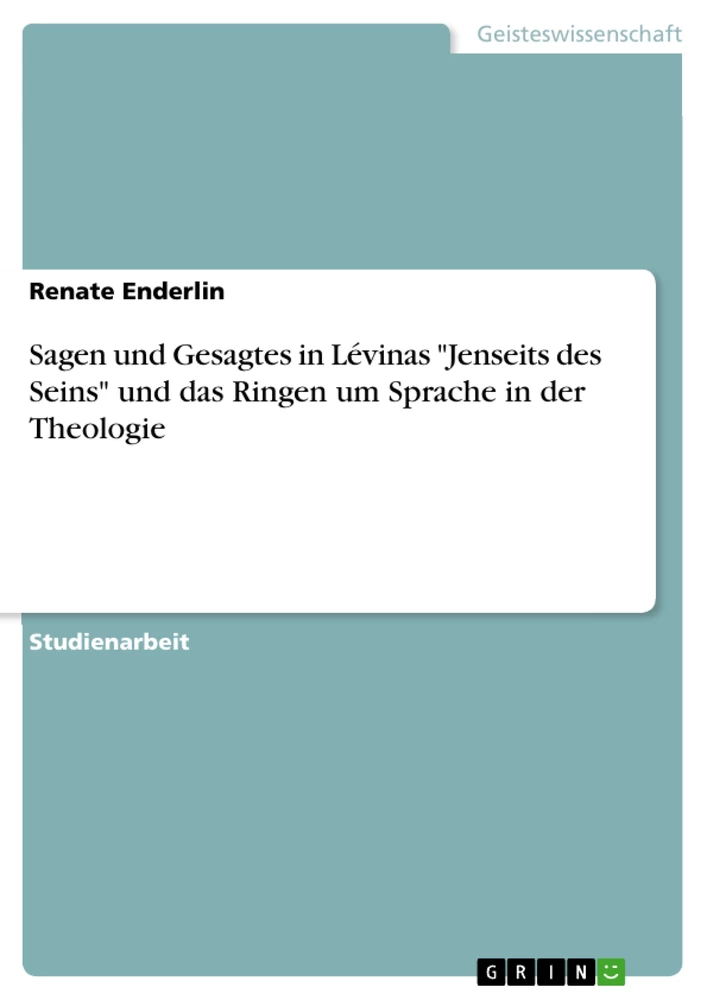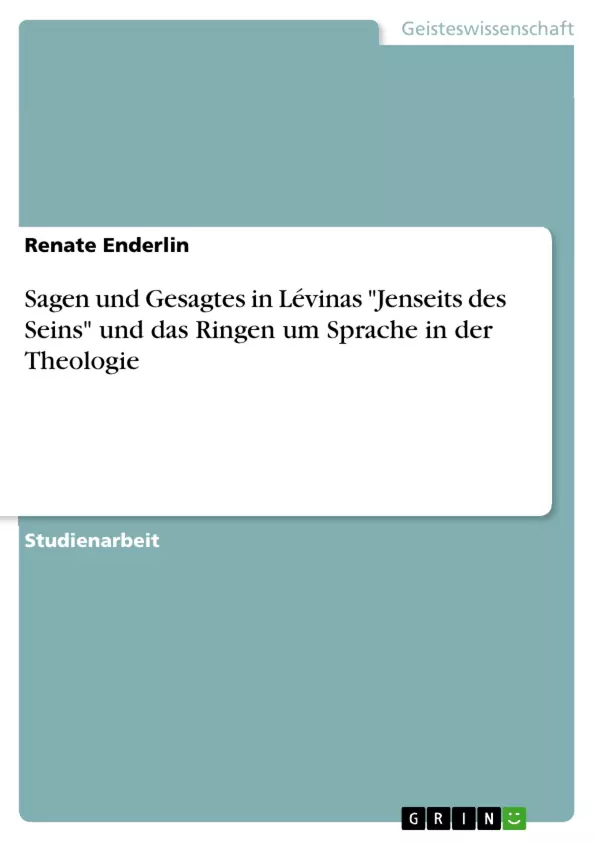Wie kann in der Theologie eine Sprache gefunden werden, die, mit Levinas gesprochen, nicht im Gesagten hängen bleibt, sondern darüber hinaus in ein Sagen mündet? Ziel dieser Seminararbeit wird es im ersten Teil sein, diese Frage, das heißt, die Begriffe Sagen und Gesagtes mit Lévinas anhand der Primärliteratur zu erläutern. Im zweiten Teil versuche ich mit Blick in die Sekundärliteratur einige Konsequenzen für theologisches Sprechen zu formulieren. Es wird sich hoffentlich zeigen, dass Aufgabe und Bedeutung theologischen Sprechens nicht in erster Linie in einem Sprechen über einen Gegenstand liegen kann und Theologie bemüht sein muss, Zeugnis zu geben, wenn sie ihrem christlichen Anspruch gerecht werden will. Es geht aber nicht darum, die Eigenheiten der Sprache in der Theologie herauszuarbeiten, sondern den der Sprache eigenen rätselhaften, ambivalenten Charakter in seiner Bedeutung für theologisches Sprechen mit Lévinas anzudeuten. Denn auch bei Lévinas geht es nicht darum, die Ambivalenz der Sprache oder theologisches und religiöses Sprechen als nur eine Form eines Sprachspiels zu erklären. Die Ambivalenz, das Ineinander von Sagen und Gesagten lässt sich nicht auf bestimmte Bereiche, Sprachspiele oder Lebensformen beschränken.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Ausblick
- 1. Die Bedeutsamkeit der Bedeutung
- 1.1 Sagen und Gesagtes
- 1.2 Die Betroffenheit durch und für den Anderen
- 2. Theologische Relevanz
- 2.1 Bedeutungsverlust und Sprachkrise
- 2.2 Bedeutungsgewinn und Zeugnis
- 3. Rückblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Lévinas' Konzept von „Sagen“ und „Gesagtem“ und dessen Relevanz für theologisches Sprechen. Sie beleuchtet, wie Sprache in der Theologie über das bloße „Gesagte“ hinausgehen und zu einem authentischen „Sagen“ gelangen kann, das Zeugnis ablegt und ethische Verantwortung impliziert. Die Arbeit analysiert die Ambivalenz der Sprache und ihre Bedeutung für theologisches Denken.
- Lévinas' Unterscheidung von „Sagen“ und „Gesagtem“
- Die ethische Dimension von Sprache bei Lévinas
- Die Ambivalenz und das Rätsel der Sprache in theologischem Kontext
- Die Rolle des Zeugnisses im theologischen Sprechen
- Die Unmöglichkeit, das Ethische vollständig sprachlich zu erfassen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Ausblick: Diese Einleitung skizziert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Wie kann theologisches Sprechen über das immanente „Gesagte“ hinaus zu einem authentischen „Sagen“ gelangen? Sie deutet die Schwierigkeiten und Ambivalenzen an, die mit diesem Unterfangen verbunden sind, und betont die Bedeutung des Zeugnisses im christlichen Anspruch theologischen Sprechens. Der Fokus liegt nicht auf der Beschreibung sprachlicher Eigenheiten in der Theologie, sondern auf der Auseinandersetzung mit dem ambivalenten Charakter der Sprache im Werk Lévinas und dessen Konsequenzen für theologisches Sprechen. Die Ambivalenz von „Sagen“ und „Gesagtem“ wird als grundlegend für die menschliche Existenz dargestellt und kann nicht auf bestimmte Bereiche beschränkt werden.
1. Die Bedeutsamkeit der Bedeutung: Dieses Kapitel erörtert Lévinas' Konzept der sprachlichen Ambivalenz, die er in „Jenseits des Seins“ entfaltet. Die Ambivalenz von „Sagen“ und „Gesagtem“ ist kein zu lösendes Problem, sondern der Ausgangspunkt für eine Reflexion über Sprache als Rätsel und die Möglichkeit des Zeugnisses von Unsagbarem. Lévinas versucht, mit der Sprache über die Sprache hinauszugehen, indem er die Funktion der Manifestation des Seins in Frage stellt und nach einer Bedeutung jenseits des Seins sucht. Die ethische Dimension der Sprache wird als ein „sagendes in Beziehung setzen“, als Verantwortung und Stellvertretung herausgestellt. Die Ontologie wird nicht als Grundlage des sprechenden Subjekts gesehen, sondern als Ergebnis der Bedeutsamkeit des Sagens, das über das Gesagte hinausgeht.
1.1 Sagen und Gesagtes: Dieses Unterkapitel analysiert die Unterscheidung zwischen „Sagen“ und „Gesagtem“ bei Lévinas. Das „Sagen“ ist vor-ursprünglich und erschließt sich nicht aus dem „Gesagten“. Die Differenzierung zwischen beiden bleibt jedoch selbst im „Gesagten“ verhaftet. Der Versuch, das „Gesagte“ auf das „Sagen“ zurückzuführen, scheitert, da jede Aussage im „Gesagten“ stattfindet. Das „Sagen“ des Unendlichen manifestiert sich als „Gesagtes“ und impliziert somit eine Bestreitung des Unendlichen, was die Ambivalenz verdeutlicht. Das „Sagen“ zeigt sich in einer Beunruhigung, einer Störung, die die bestehende Ordnung herausfordert, aber nicht völlig zerstört. Durch den Einspruch des „Gesagten“ gegen den Verlust des „Sagens“ wird die Diachronie des „Sagens“ aufrechterhalten. Das ethische Moment ist mit dieser Störung verbunden, und in der Unentscheidbarkeit dieser Beunruhigung liegt die Möglichkeit verantwortungsvollen Handelns.
2. Theologische Relevanz: Dieses Kapitel untersucht die Konsequenzen von Lévinas' Sprachphilosophie für theologisches Sprechen. Es wird der Zusammenhang zwischen der Ambivalenz von Sagen und Gesagtem und ethischer Verantwortung beleuchtet. Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten theologischen Sprechens im Angesicht der sprachlichen Ambivalenz. Die Unmöglichkeit, das Ethische vollständig sprachlich zu erfassen, wird als ethische Notwendigkeit interpretiert. Der "doppelte Verrat" der Reduktion – am Sagen durch das Gesagte und an der Ethik – wird als notwendig für die Offenbarung des Ethischen betrachtet. Das "Sagen" offenbart sich im Verschwinden, in seiner Abwesenheit. Die "Aufrichtigkeit des Zeugnisses" wird als eine Umkehr beschrieben, in der das Außerhalb mich betrifft, ohne eingeholt werden zu können. Meine Betroffenheit liegt in dieser Unmöglichkeit. Das Unendliche bleibt vom Endlichen getrennt, obwohl es nahe ist (Anderes im Selben).
Schlüsselwörter
Lévinas, Sagen, Gesagtem, Ambivalenz, Sprache, Theologie, Ethik, Verantwortung, Zeugnis, Unendlich, Reduktion, Unentscheidbarkeit, Anderer, Selbes.
Häufig gestellte Fragen zu: Seminararbeit über Lévinas' Sprachphilosophie und ihre theologische Relevanz
Was ist das zentrale Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Emmanuel Lévinas' Konzept von „Sagen“ und „Gesagtem“ und dessen Relevanz für theologisches Sprechen. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der Sprache und ihrer Bedeutung für theologisches Denken, insbesondere der Frage, wie theologisches Sprechen über das bloße „Gesagte“ hinaus zu einem authentischen „Sagen“ gelangen kann, das Zeugnis ablegt und ethische Verantwortung impliziert.
Welche Schlüsselkonzepte von Lévinas werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentral Lévinas' Unterscheidung zwischen „Sagen“ und „Gesagtem“. „Sagen“ wird als vor-ursprünglich und nicht aus dem „Gesagten“ ableitbar beschrieben. Die Ambivalenz dieser beiden Pole, die Unmöglichkeit, das „Sagen“ vollständig im „Gesagten“ zu erfassen, bildet den Kern der Argumentation. Weiterhin werden die ethische Dimension von Sprache, die Rolle des Zeugnisses und die Unmöglichkeit, das Ethische vollständig sprachlich zu erfassen, analysiert.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen Ausblick, ein Kapitel über die Bedeutsamkeit der Bedeutung (mit Unterkapitel zu „Sagen“ und „Gesagtem“), ein Kapitel zur theologischen Relevanz und einen Rückblick. Der Ausblick skizziert die Forschungsfrage, die Kapitel behandeln Lévinas' Konzept und dessen Konsequenzen für theologisches Sprechen, und der Rückblick fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist die Kernaussage des Kapitels „Die Bedeutsamkeit der Bedeutung“?
Dieses Kapitel erörtert Lévinas' Konzept der sprachlichen Ambivalenz. Die Ambivalenz von „Sagen“ und „Gesagtem“ wird nicht als Problem dargestellt, das gelöst werden muss, sondern als Ausgangspunkt für eine Reflexion über Sprache als Rätsel und die Möglichkeit des Zeugnisses von Unsagbarem. Die ethische Dimension der Sprache wird als „sagendes in Beziehung setzen“, als Verantwortung und Stellvertretung, herausgestellt.
Was wird im Unterkapitel „Sagen und Gesagtes“ untersucht?
Dieses Unterkapitel analysiert die Unterscheidung zwischen „Sagen“ und „Gesagtem“ im Detail. Es wird gezeigt, dass der Versuch, das „Gesagte“ auf das „Sagen“ zurückzuführen, scheitert. Das „Sagen“ manifestiert sich als „Gesagtes“ und impliziert somit eine Bestreitung des Unendlichen. Das ethische Moment ist mit der Störung verbunden, die durch das „Sagen“ entsteht.
Welche theologische Relevanz hat Lévinas' Sprachphilosophie laut der Seminararbeit?
Das Kapitel zur theologischen Relevanz untersucht die Konsequenzen von Lévinas' Sprachphilosophie für theologisches Sprechen. Es wird der Zusammenhang zwischen der Ambivalenz von „Sagen“ und „Gesagtem“ und ethischer Verantwortung beleuchtet. Die Unmöglichkeit, das Ethische vollständig sprachlich zu erfassen, wird als ethische Notwendigkeit interpretiert. Der „doppelte Verrat“ der Reduktion wird als notwendig für die Offenbarung des Ethischen betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Lévinas, Sagen, Gesagtem, Ambivalenz, Sprache, Theologie, Ethik, Verantwortung, Zeugnis, Unendlich, Reduktion, Unentscheidbarkeit, Anderer, Selbes.
- Citar trabajo
- MMag. phil. MMag. theol Renate Enderlin (Autor), 2008, Sagen und Gesagtes in Lévinas "Jenseits des Seins" und das Ringen um Sprache in der Theologie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184794