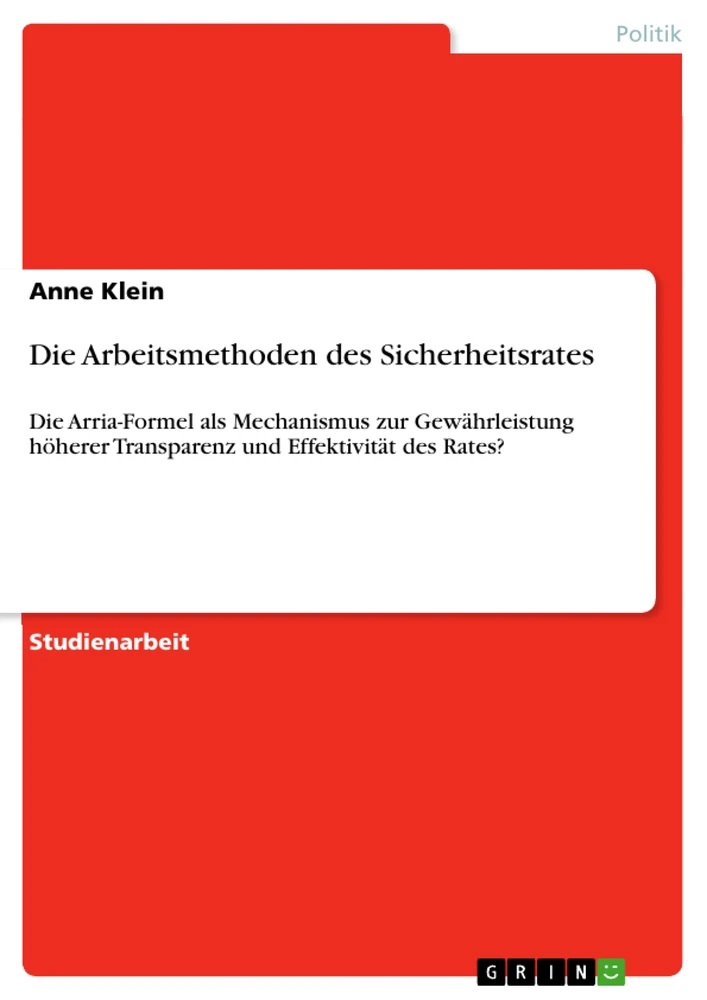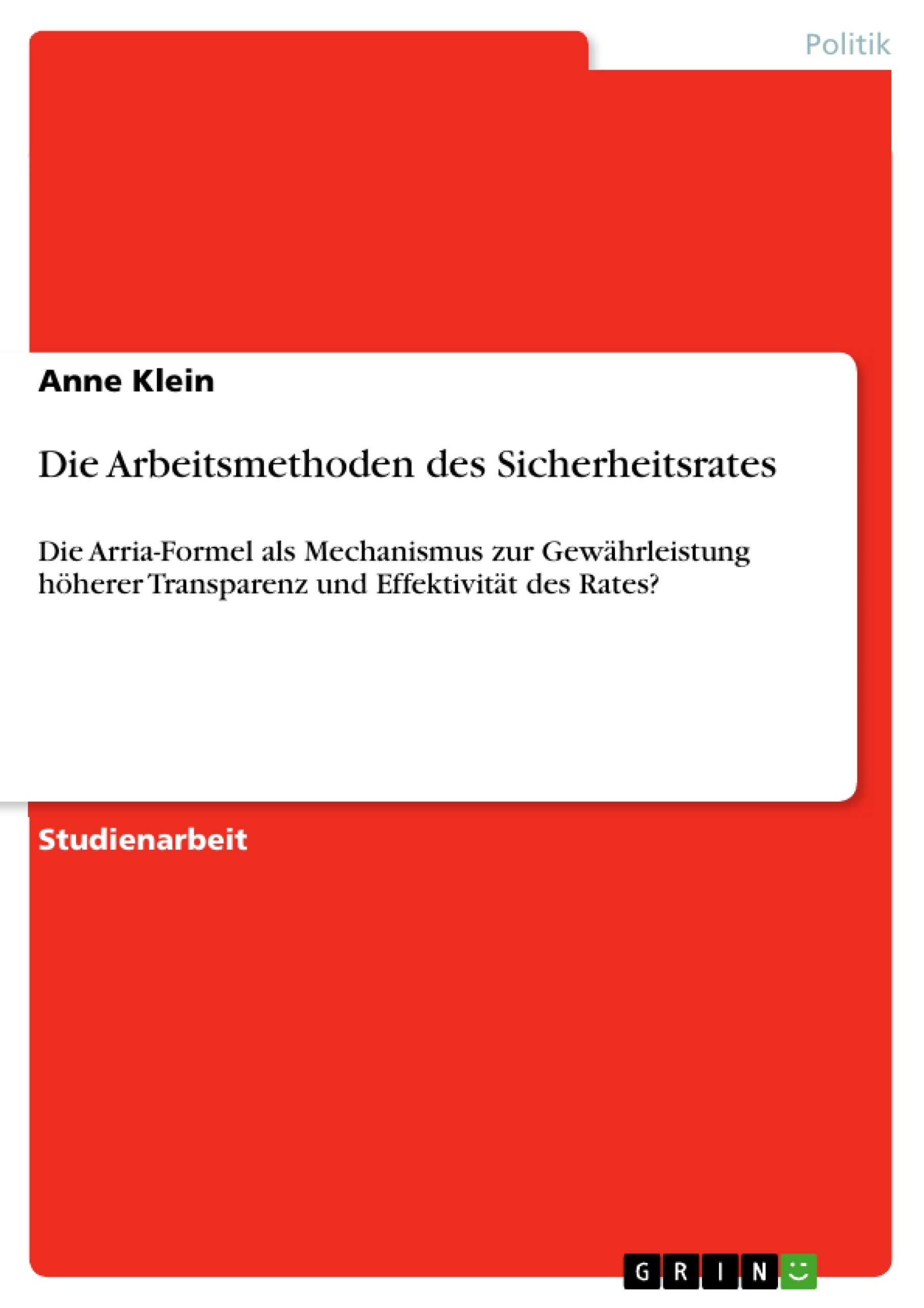1. Einleitung
„Bisher verhandelten die Vereinten Nationen nur mit Regierungen. Heute wis-sen wir, dass Friede und Wohlstand ohne Partnerschaft zwischen Regierungen, den internationalen Organisationen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschafft nicht möglich sind. In der heutigen Welt sind wir alle voneinander abhängig“
Kofi Annan, 31.12.98
Die Vereinen Nationen, gegründet 1945, sind eine intergouvernementale Orga-nisation, d.h. sie thematisieren die Beziehung zwischen Staaten und den Kon-flikten, die daraus resultieren können. Seit der Gründung dieser internationalen Gemeinschaft sind über 60 Jahre vergangen, die eine Reihe von Veränderun-gen bedeutete. Das Zitat des ehemaligen Generalsekretärs der Vereinten Nati-on, Kofi Annan, zeigt, in welchem Wandel sich die multilaterale Organisation befindet.
In ihren Anfängen galten die Vereinten Nationen als eine zwischenstaatliche Organisation, deren Zusammenarbeit sich allein auf Staaten bezog. In der heu-tigen Zeit reicht eine solche Vorgehensweise zur Lösung von Weltproblemen wie dem Umweltschutz nicht mehr aus. Die Kompetenzen der Staaten sind heu-te unzureichend und helfen nur bis zu einem bestimmten Punkt bei der Konflikt-lösung. Um diese Lücken zu füllen, ist die Hilfe von anderen Gruppen nötig. Eine Bezugsgröße stellen nichtstaatliche Organisationen, sogenannte Nichtre-gierungsorganisationen (NGOs) dar. NGOs sind Vertreter aus der Zivilgesellschaft, die andere Möglichkeiten als staatliche Institutionen besitzen. Sie agie-ren ohne Profitorientierung und spezialisieren sich häufig auf ein bestimmtes globales, aber auch regional bedeutsames Thema. Die Zusammenarbeit zwi-schen NGOs und den Vereinten Nationen, speziell dem Sicherheitsrat, stellt sich allerdings problematisch dar, da es keine Gesetzesgrundlage oder Richtlinien für eine Kooperation gibt....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Einführung zum Sicherheitsrat
- Funktionen und Arbeitsweise des Sicherheitsrates
- Erhöhter Bedarf an Partizipation und Kooperation seit Ende des Ost-West-Konfliktes
- Informelle Treffen zwischen dem Sicherheitsrat & Nichtregierungsorganisationen am Beispiel der Arria-Formel
- Initiativen zur Reformierung der Arbeitsmethoden im Rat
- NGOs als Informationsbeschaffer
- Der Mechanismus der Arria-Formel
- Beispiele für eine NGO-Beteiligung nach der Arria-Formel
- Kritik an der Arria-Formel
- Hürden bei der Umsetzung der Arria-Formel
- Fazit: Möglichkeiten und Grenzen des Arria-Mechanismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, insbesondere die Arria-Formel als Mechanismus zur Steigerung der Transparenz und Effektivität des Rates. Der Fokus liegt auf dem Zeitraum von Beginn der 1990er Jahre bis in das frühe 21. Jahrhundert. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie effektiv und institutionalisiert die Arria-Formel ist und welche Hindernisse bei der Reformierung der Arbeitsmethoden bzw. der Institutionalisierung der Arria-Formel im Sicherheitsrat bestehen.
- Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
- Die Arria-Formel als informeller Mechanismus zur Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsrat und NGOs
- Die Effektivität und die Grenzen der Arria-Formel
- Die Herausforderungen bei der Institutionalisierung der Arria-Formel
- Die Auswirkungen der Arria-Formel auf die Transparenz und Effektivität des Sicherheitsrates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die wachsende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Staaten, internationalen Organisationen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft für Frieden und Wohlstand. Sie stellt die Herausforderungen für die Vereinten Nationen in der heutigen Zeit dar und betont die Rolle von NGOs als Vertreter der Zivilgesellschaft. Das erste Kapitel bietet eine kurze Einführung zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, seinen Funktionen und seiner Arbeitsweise. Es betont die besondere Stellung des Sicherheitsrates als einziges Organ der Vereinten Nationen, das rechtsverbindliche Beschlüsse für alle Mitgliedsstaaten fassen kann. Das zweite Kapitel befasst sich mit den informellen Treffen zwischen dem Sicherheitsrat und NGOs, insbesondere mit der Arria-Formel. Es beleuchtet die Initiativen zur Reformierung der Arbeitsmethoden im Rat, die Rolle von NGOs als Informationsbeschaffer und die Funktionsweise der Arria-Formel als Mechanismus der Einflussnahme. Darüber hinaus werden Beispiele für eine NGO-Beteiligung nach der Arria-Formel sowie Kritik an diesem Mechanismus vorgestellt. Das dritte Kapitel analysiert die Hürden bei der Umsetzung der Arria-Formel.
Schlüsselwörter
Die Forschungsarbeit befasst sich mit zentralen Themen wie den Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates, der Arria-Formel, der Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im Sicherheitsrat, der Transparenz und Effektivität des Sicherheitsrates, der Reformierung der Arbeitsmethoden im Sicherheitsrat, der Institutionalisierung der Arria-Formel und den Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsrat und NGOs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Arria-Formel?
Die Arria-Formel ist ein informeller Mechanismus, der es Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates ermöglicht, in einem vertraulichen Rahmen mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und anderen Akteuren in Kontakt zu treten.
Warum sind NGOs für den Sicherheitsrat wichtig?
NGOs fungieren oft als wichtige Informationsbeschaffer aus Krisengebieten und vertreten Perspektiven der Zivilgesellschaft, die staatliche Institutionen allein nicht abdecken können.
Welche Hürden gibt es bei der Institutionalisierung der Arria-Formel?
Es mangelt an festen Gesetzesgrundlagen und Richtlinien für die Kooperation, zudem gibt es innerhalb des Rates oft politischen Widerstand gegen eine stärkere Einbindung nichtstaatlicher Akteure.
Wie trägt die Arria-Formel zur Transparenz bei?
Sie öffnet den ansonsten oft verschlossenen Sicherheitsrat für externe Expertise und ermöglicht einen Dialog über Themen, die sonst nicht auf der offiziellen Agenda stünden.
Wer war der Namensgeber der Arria-Formel?
Die Formel wurde nach dem venezolanischen Diplomaten Diego Arria benannt, der diesen informellen Austausch im Jahr 1992 initiierte.
- Citar trabajo
- Anne Klein (Autor), 2011, Die Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184869