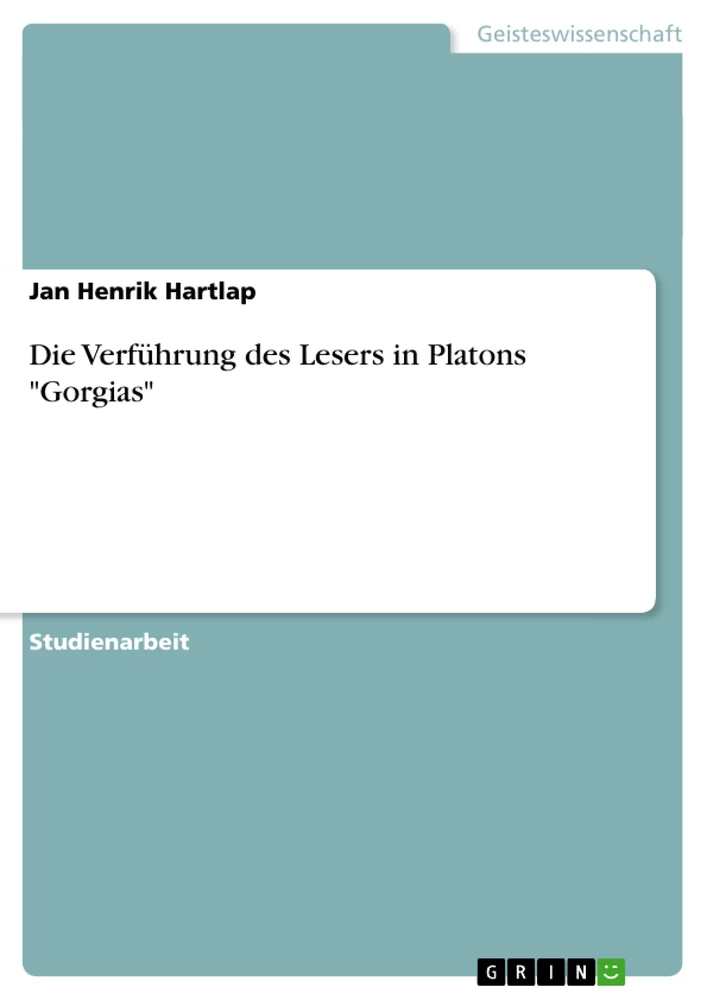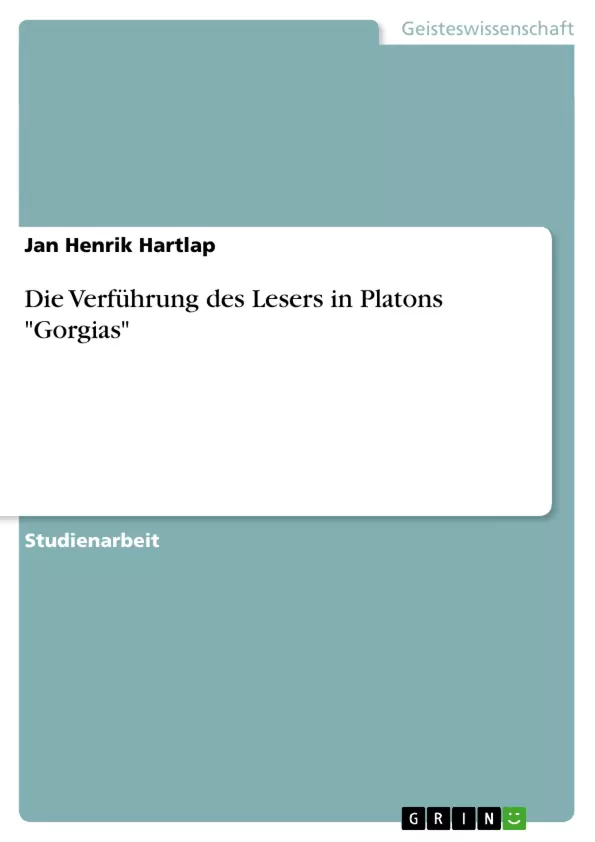Es ist hinlänglich und längst bekannt, daß Sokrates nichts Schriftliches hinterlassen hat. Nahezu alles was wir ihn über ihn wissen, ist uns von seinem Schüler Platon hinterlassen. Wenn wir also von einer Philosophie des Sokrates sprechen, so sprechen wir von einer Version derselben, wie sie uns von Platon überliefert worden ist, angereichert durch einige wenige andere Quellen. Dasselbe gilt natürlich auch, vielleicht sogar in einem größeren Maße für Sokrates Methode. Im Wesentlichen geht es dabei darum, daß Sokrates seine Gesprächspartner durch Fragen erst in ihren vorgefaßten Meinungen erschütterte, um sie dann im Verlauf des weiteren Gespräches zu neuen Erkenntnissen anzuleiten. Anzuleiten bedeutet hierbei, daß Sokrates eben nicht als jemand auftrat, der vorgab die Antwort auf die von ihm gestellten Fragen bereits zu kennen, sondern als jemand, dessen Erkenntnisprozess parallel zu dem seines Gesprächspartners verläuft. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, daß man auf diesem Wege jedesmal zu einem neuen Ergebnis gelangen würde. Die Wahrscheinlichkeit gebietet es, daß es Fälle gegeben haben muß, in denen Sokrates und sein Gesprächspartner ohne eine neue Erkenntnis auseinander gegangen sind, mit mehr unbeantworteten Fragen im Gepäck als vor ihrer Zusammenkunft. Solche Fälle sind uns aber nicht bekannt. Daraus folgt der Schluß, daß uns entweder solche Fälle nicht überliefert sind oder, daß es sich bei Sokrates Methodik um eine didaktische gehandelt hat, in der er Unwissenheit nur vorgespielt hat. In einem solchen Fall hätte Sokrates bereits ein Ziel vor Augen, auf das er mit seinen Fragen hinaus wollte. Dem Gesprächspartner würde der Eindruck vermittelt, er wäre selbständig zu einer Erkenntnis gelangt Eine solche didaktische Methode besitzt einen entscheidenden Vorteil. Der Gesprächspartner wird nicht explizit von einer Auffassung überzeugt sondern gelangt selber zu dieser und ist daher eher bereit diese auch anzunehmen. Er ist ja von selbst zu diesem Schluß gelangt. Es wurde ihm nicht seine Unwissenheit demonstriert und somit auch seine Eitelkeit nicht verletzt. Aus eben diesem Grund wird diese didaktische Methode noch heute in der Schulpädagogik angewandt. Nur macht sich in der Pädagogik niemand Illusionen darüber, daß der Lehrer einen Wissensvorsprung besitzt und gegenüber seinen Schülern eine Moderatorfunktion übernimmt. Diese Methode besitzt aber auch einen entscheidenden Nachteil. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Struktur des Gorgias
- Gorgias
- Polos
- Kallikles
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Platons Dialog "Gorgias" und analysiert die darin dargestellte Dialektik des Sokrates. Ziel ist es, die Gründe zu untersuchen, warum Gorgias, ein renommierter Rhetor, Sokrates Gesprächsführung nicht durchschaut und somit seiner Dialektik nicht entkommt.
- Die dialektische Methode des Sokrates
- Die rhetorischen Fähigkeiten von Gorgias
- Die fiktive Natur des Dialogs
- Die Frage nach der Historizität des Gesprächs zwischen Sokrates und Gorgias
- Die Rolle von Platons Darstellung im "Gorgias"
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert Sokrates' Philosophie und seine Methode, die auf der Erschütterung vorgefasster Meinungen durch Fragen basiert. Die Arbeit stellt die Besonderheiten von Sokrates dialektischer Methode im Kontext des "Gorgias" dar, insbesondere im Hinblick auf die Rhetorik.
- Das zweite Kapitel behandelt die Struktur des Dialogs "Gorgias" und beleuchtet die verschiedenen Gesprächspartner und ihre jeweiligen Positionen.
- Die folgenden Kapitel behandeln die Dialoge zwischen Sokrates und den einzelnen Gesprächspartnern, Gorgias, Polos und Kallikles.
Schlüsselwörter
Dialektik, Rhetorik, Sophisten, Sokrates, Platon, Gorgias, "Gorgias", Philosophie, Fiktion, Historizität, didaktische Methode.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Platons Dialog "Gorgias"?
Der Dialog thematisiert die Auseinandersetzung zwischen Sokrates' Dialektik und der Rhetorik der Sophisten, insbesondere des berühmten Redners Gorgias.
Was ist das Besondere an Sokrates' dialektischer Methode?
Sokrates erschüttert durch gezielte Fragen die vorgefassten Meinungen seiner Partner, um sie zu neuen Erkenntnissen zu führen, wobei er oft Unwissenheit nur vorspielt.
Warum entkommt Gorgias der Dialektik des Sokrates nicht?
Die Arbeit analysiert, warum selbst ein erfahrener Rhetor wie Gorgias die Gesprächsführung des Sokrates nicht durchschaut und sich in Widersprüche verwickeln lässt.
Sind die Gespräche im "Gorgias" historisch belegt?
Die Arbeit weist darauf hin, dass es sich bei Platons Dialogen um fiktive literarische Werke handelt, auch wenn sie historische Persönlichkeiten als Protagonisten nutzen.
Welche Rolle spielt die Eitelkeit in der Sokratischen Methode?
Durch die didaktische Methode wird dem Partner vermittelt, er sei selbst zur Erkenntnis gelangt, wodurch seine Eitelkeit nicht verletzt wird und die Akzeptanz der Wahrheit steigt.
- Citar trabajo
- Jan Henrik Hartlap (Autor), 2002, Die Verführung des Lesers in Platons "Gorgias", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18497