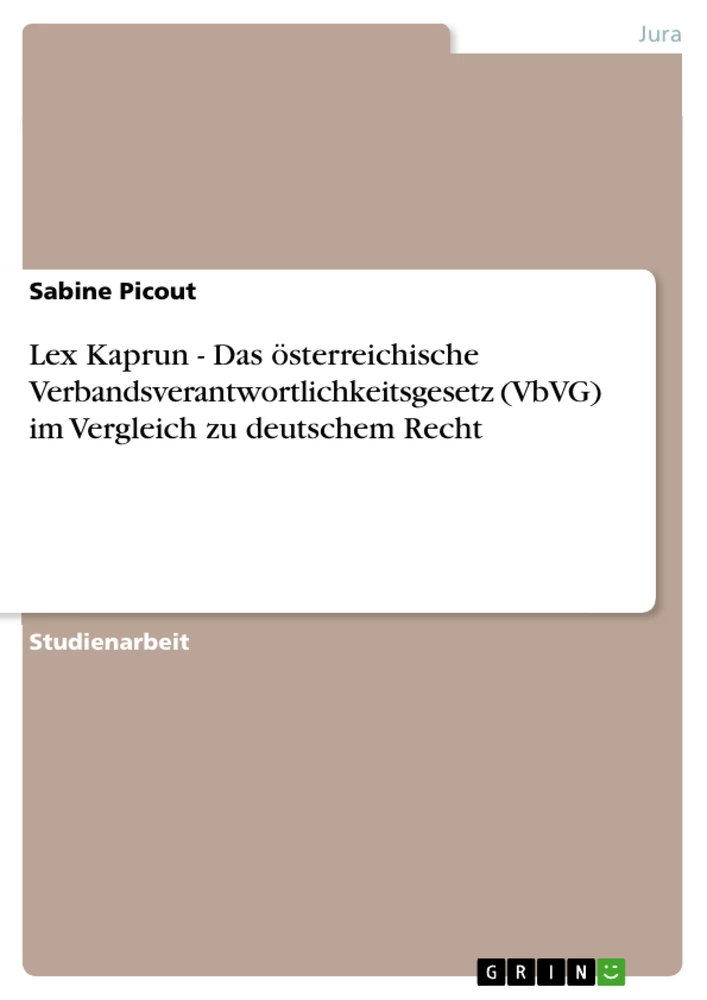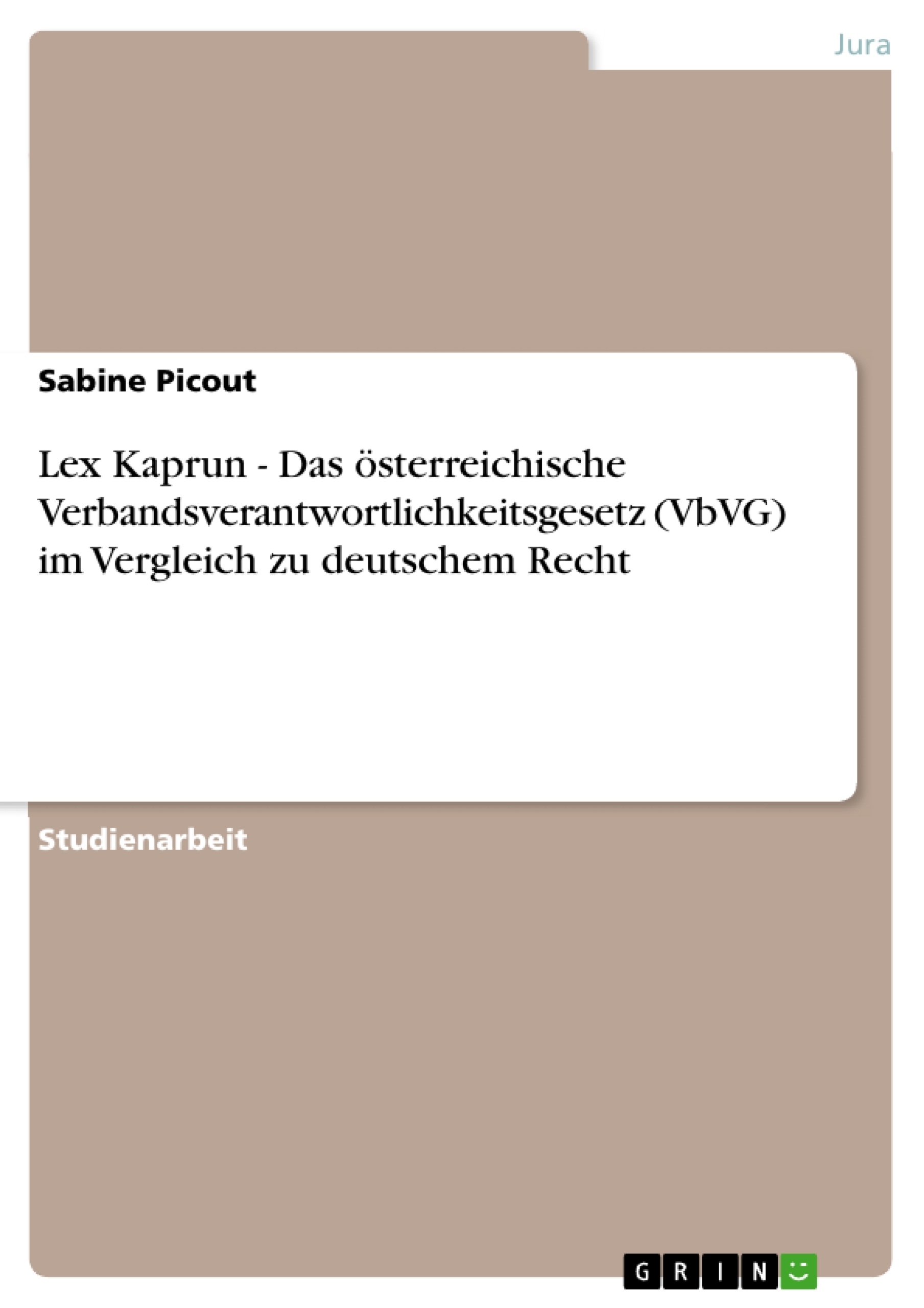Das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz ist ein sehr junges Gesetz, welches am 1. 1. 2006 in Kraft trat. Dieses neu geschaffene VbVG sollte ein umfassendes Verbandssanktionensystem einführen und beweckte dadurch die Verhinderung bzw. die Reduzierung von Verbandskriminalität.
Auf internationaler Ebene forderten auch zahlreiche internationale Verpflichtungen, Rechtsakte der EU, aber auch völkerrechtliche Übereinkommen (Europarat und OECD) die Einführung einer wirksamen, abschreckenden und angemessenen Sanktionierung juristischer Personen für bestimmte Straftaten, d.h. die Einführung einer deliktischen Verantwortlichkeit juristischer Personen. Dabei ist auf EU-Ebene vor allem das „Zweite Protokoll zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften“ nennenswert.
Die Verbandsverantwortlichkeit weicht deutlich vom traditionellen Strafrecht ab, da es sich dabei nicht um Strafrecht im eigentlichen Wortsinn, sondern um einen selbständigen Zweig im differenzierten Kriminalrecht handelt.
Da die Sanktionsadressaten hier juristische Personen und andere rechtsfähige Verbände sind und nicht natürliche Personen, werden die Unterschiede zwischen Verbänden und dem menschlichen Individuum schlagend, aufgrund derer nicht dieselben Mittel des Strafrechts Anwendung finden können. Z.B. kann nur ein Mensch iSd individuell-sittlichen Schuldbegriffs „schuldig“ werden. Weiters ist die Strafe für Verbände nicht mehr „sinnbildliches Übel“. Deshalb wird auch in diesem Gesetz das Wort „Strafe“ ausgeblendet und dafür der Begriff „Verbandsgeldbuße“ verwendet.
Anhand dieser sorgfältigen Auswahl der Terminologie wird auch das strafrechtliche Schuldprinzip nicht berührt, da der Verband nur „für eine Straftat verantwortlich“ ist. Es ist hier jedoch anzumerken, dass die strafrechtliche Sanktionierung des Verbandes wegen einer Straftat in einem Strafverfahren und selbst die Eintragung der Verbandsgeldbußen in einem Strafregister vorgesehen sind.
Die Verfolgung liegt im Ermessen des Staatsanwaltes. Auch ein diversionelles Vorgehen ist möglich. Neben den bisher bekannten Strafen, vorbeugenden Maßnahmen, Nebenfolgen, vermögensrechtlichen Anordnungen und der Diversion tritt nun die Verbandsgeldbuße als eine weitere Spur sui generis des Kriminalrechts.
Inhaltsverzeichnis
- I. Rechtslage in Österreich
- 1. Vorbemerkungen zum VbVG
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Sanktionsadressaten: Verband iSd § 1 (2) VbVG
- 4. „Mitarbeiter“ versus „Entscheidungsträger“ iSd § 2 (1) und § 2 (2) VbVG
- 5. Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit: Zurechnung § 3 VbVG
- 1. Allgemein
- 2. Nichtrepressive Sanktionen im deutschen Recht
- a) Generelle Haftungsvoraussetzungen
- b) 1. Fall: Die Verantwortlichkeit für Handlungen von Entscheidungsträgern
- c) 2. Fall: Die Verantwortlichkeit für Handlungen von Mitarbeitern
- II. Rechtsvergleich Deutschland
- III. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), das 2006 in Kraft trat. Die Arbeit untersucht die Zielsetzung des Gesetzes, den Anwendungsbereich, die Bestimmung der Sanktionsadressaten und die Voraussetzungen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden. Ein Rechtsvergleich mit dem deutschen Recht wird ebenfalls durchgeführt.
- Einführung und Zielsetzung des VbVG
- Anwendungsbereich und strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden
- Unterschiede zwischen „Mitarbeitern“ und „Entscheidungsträgern“
- Zurechnung von Straftaten im Rahmen des VbVG
- Rechtsvergleich Österreich - Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
I. Rechtslage in Österreich: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), ein relativ junges Gesetz, das ein umfassendes System zur Sanktionierung von Verbänden einführen soll, um Verbandskriminalität zu reduzieren. Es wird der deutliche Unterschied zum traditionellen Strafrecht hervorgehoben, da es sich nicht um Strafrecht im eigentlichen Sinn, sondern um einen eigenständigen Zweig des Kriminalrechts handelt. Die Arbeit betont die Abkehr vom traditionellen Schuldprinzip und die Einführung der „Verbandsgeldbuße“ als Sanktion. Der Fokus liegt auf der Zurechnung von Straftaten zu Verbänden und den damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen. Die Diskussion der materiell- und prozessrechtlichen Aspekte des VbVG bildet einen weiteren Schwerpunkt.
II. Rechtsvergleich Deutschland: Dieses Kapitel vergleicht die Rechtslage in Österreich mit der in Deutschland, wobei insbesondere die unterschiedlichen Ansätze zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Verbänden beleuchtet werden. Es werden die relevanten deutschen Vorschriften, insbesondere im Verwaltungsrecht und bezüglich der Unternehmensgeldbuße, detailliert analysiert und im Kontext des österreichischen VbVG eingeordnet. Die Kapitel untersuchen die Unterschiede in den Sanktionsmöglichkeiten und -verfahren. Die vergleichende Betrachtung erlaubt die Identifikation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den beiden Rechtssystemen.
Schlüsselwörter
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), Verbandskriminalität, strafrechtliche Verantwortlichkeit, juristische Personen, Sanktionen, Verbandsgeldbuße, Zurechnung, Entscheidungsträger, Mitarbeiter, Rechtsvergleich, Deutschland, Österreich.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Analyse des österreichischen Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) von 2006. Sie untersucht dessen Zielsetzung, Anwendungsbereich, die Bestimmung der Sanktionsadressaten und die Voraussetzungen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Rechtsvergleich mit dem deutschen Recht.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Einführung und Zielsetzung des VbVG, Anwendungsbereich und strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden, Unterschiede zwischen „Mitarbeitern“ und „Entscheidungsträgern“, Zurechnung von Straftaten im Rahmen des VbVG, und einen Rechtsvergleich Österreich - Deutschland. Die Arbeit umfasst eine detaillierte Betrachtung der Rechtslage in Österreich, inklusive Vorbemerkungen zum VbVG, Anwendungsbereich, Sanktionsadressaten, Unterscheidung zwischen Mitarbeitern und Entscheidungsträgern sowie den Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach §3 VbVG. Der Rechtsvergleich mit Deutschland umfasst einen Vergleich der unterschiedlichen Ansätze zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Verbänden, die relevanten deutschen Vorschriften (Verwaltungsrecht, Unternehmensgeldbuße) und einen Vergleich der Sanktionsmöglichkeiten und -verfahren.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: I. Rechtslage in Österreich (mit Unterkapiteln zu Vorbemerkungen zum VbVG, Anwendungsbereich, Sanktionsadressaten, Unterscheidung „Mitarbeiter“/„Entscheidungsträger“, Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit), II. Rechtsvergleich Deutschland, und III. Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), Verbandskriminalität, strafrechtliche Verantwortlichkeit, juristische Personen, Sanktionen, Verbandsgeldbuße, Zurechnung, Entscheidungsträger, Mitarbeiter, Rechtsvergleich, Deutschland, Österreich.
Welchen Schwerpunkt legt die Arbeit auf die Zurechnung von Straftaten?
Die Arbeit legt einen Schwerpunkt auf die Zurechnung von Straftaten zu Verbänden und die damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen. Sie beleuchtet die Abkehr vom traditionellen Schuldprinzip und die Einführung der „Verbandsgeldbuße“ als Sanktion. Sowohl die materiell- als auch die prozessrechtlichen Aspekte des VbVG werden diskutiert.
Wie unterscheidet sich das österreichische VbVG vom deutschen Recht?
Das Kapitel zum Rechtsvergleich beleuchtet die Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem deutschen Recht bezüglich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Verbänden. Es analysiert die relevanten deutschen Vorschriften, insbesondere im Verwaltungsrecht und bezüglich der Unternehmensgeldbuße, und vergleicht die Sanktionsmöglichkeiten und -verfahren beider Systeme, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das VbVG, ein relativ junges Gesetz, das ein umfassendes System zur Sanktionierung von Verbänden einführen soll, um Verbandskriminalität zu reduzieren. Sie untersucht die Zielsetzung des Gesetzes und beleuchtet die damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen.
- Citar trabajo
- MMag. Dr. Sabine Picout (Autor), 2006, Lex Kaprun - Das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) im Vergleich zu deutschem Recht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185024