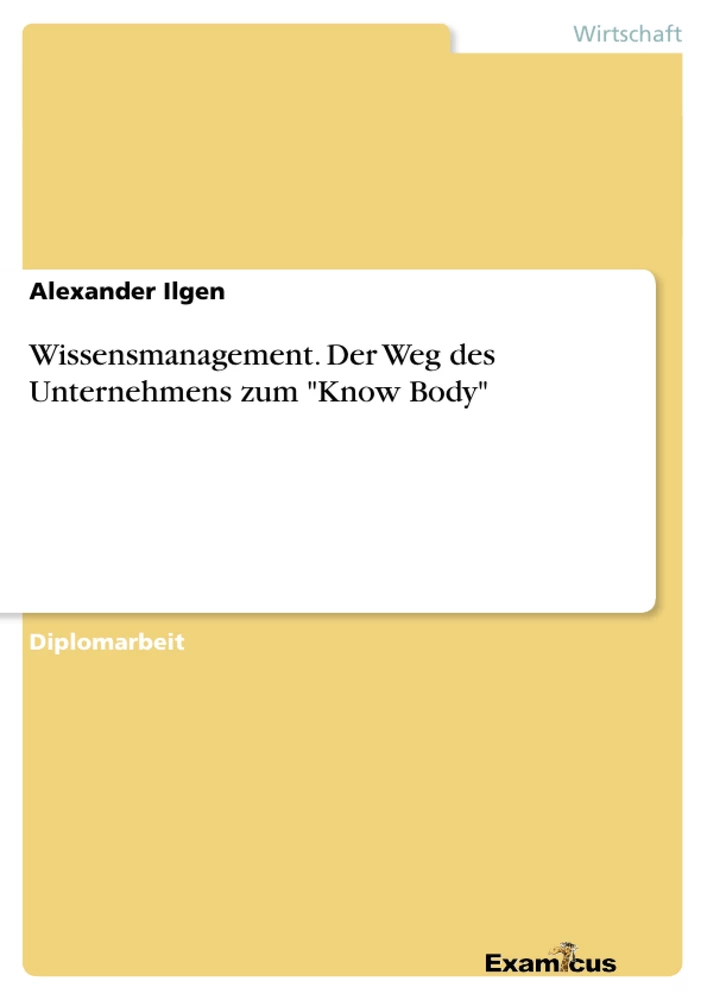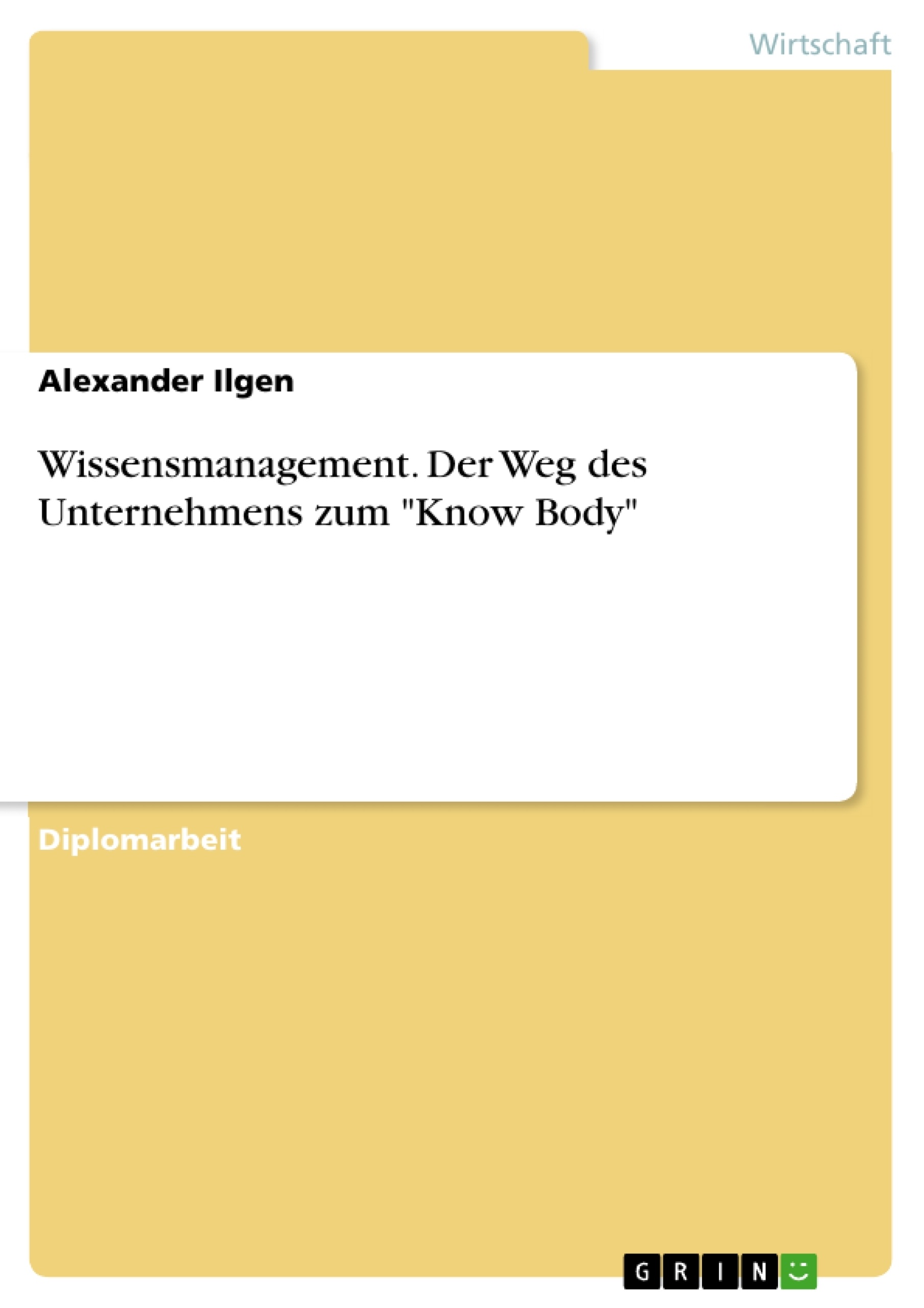„Bei einer 700-Dollar-Kamera entfällt ein vernachlässigbarer Anteil von 8,5 Prozent auf Material, der Rest wird für Mikroprozessoren und Software, also für die „Intelligenz“ des Produktes gezahlt.“ „Knowledge is the new form of capital“; „Knowledge is the futur“. Unter diesen und ähnlichen Überschriften ist ein neuer Fokus in der Theorie und in der Praxis entstanden, welcher Wissen in den letzten Jahren zum zentralen, erfolgsentscheidenden Produktionsfaktor hat werden lassen.
„Wenn wir auf die Geschichte der Menschheit zurückblicken, können wir zwei große Änderungswellen erkennen: die Agrarrevolution und die industrielle Revolution. Derzeit stehen wir, so der amerikanische Soziologe Alvin Toffler, vor dem dritten großen Umbruch: „die Wissensrevolution“.“ Dieser tiefgreifende strukturelle Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft hat zu einer veränderten Bedeutung der Produktionsfaktoren geführt. Während der Faktor Boden in der Agrargesellschaft sowohl für die Produktion als auch für die gesellschaftliche Stellung eine zentrale Rolle spielte, lösten Arbeit und Kapital diesen im Zuge der Industrialisierung ab. Investitionen in Maschinen oder Fabriken bestimmten über die Macht einer Nation und über den Reichtum einer Person. Die zunehmende Bedeutung der nicht industriell oder landwirtschaftlich erzeugten Güter hat dazu geführt, daß der tertiäre Sektor Ende der 70er Jahren eine beträchtliche Expansion erfuhr. Der unternehmerische Erfolg und die gesellschaftliche Macht wurden zunehmend durch Informationsquantität, -vorsprung und -vernetzung bestimmt. Die Information avancierte zum vierten Produktionsfaktor. Die Dienstleistungs- bzw. Informationsgesellschaft scheint jedoch heutzutage von einer „unternehmerischen Wissensgesellschaft“ abgelöst zu werden. In Zeiten in denen Informationen im Überfluß für jedermann vorhanden sind, stellt sich die Frage, ob es noch die Informationen an sich sind, die als Produktions- bzw. Erfolgsfaktor bezeichnet werden können, oder eher das Wissen, welches diese erzeugen können. Es geht nicht mehr darum, die Menge an vorhandenen Informationen möglichst effizient mittels leistungsfähiger EDV-Techniken zu verwalten, sondern darum, das Potential, welches hinter den Informationen steht, zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Executive Summary
- 1. Einleitung: Wissen als entscheidender Wettbewerbsfaktor
- 2. Terminologische Implikationen des Wissensmanagements
- 2.1. Der Begriff „Wissen“
- 2.1.1. Der Wissensbegriff im alltäglichen Sprachgebrauch
- 2.1.2. Das Wissensverständnis in der Philosophie
- 2.1.3. Der Wissensbegriff in der Betriebswirtschaftslehre
- 2.2. Wissensarten
- 2.3. Zum Begriff Wissensmanagement
- 2.3.1. Das Managementverständnis
- 2.3.2. Wissen managen: Reichweite und Implikationen
- 2.1. Der Begriff „Wissen“
- 3. Wissensmanagement als ganzheitlicher Ansatz
- 3.1. Methodisches Vorgehen
- 3.2. Das Wissensmanagement-Konzept
- 3.2.1. Wissensziele
- 3.2.2. Wissensidentifikation
- 3.2.3. Wissenserwerb
- 3.2.4. Wissensentwicklung
- 3.2.5. Wissens(ver)teilung
- 3.2.6. Wissensnutzung
- 3.2.7. Wissensbewahrung
- 3.2.8. Wissensbewertung
- 3.2.9. Wissenscontrolling
- 3.3. Voraussetzungen für die Einführung eines Konzeptes zum Management von Wissen
- 4. Instrumente zur Implementierung von Wissensmanagement
- 4.1. Technische Wissensinstrumente
- 4.2. Humanorientierte Instrumente - Wissenslandkarten
- 4.3. Klassische Managementinstrumente
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhänge
- Anhang I: Firmenkontaktliste
- Anhang II: Leitfaden für die Expertengespräche
- Anhang III: Clusterung und Kodierung der Interviewergebnisse
- Anhang IV: Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Wissensmanagement und untersucht dessen Bedeutung als strategischer Wettbewerbsfaktor. Ziel ist es, ein ganzheitliches Wissensmanagement-Konzept zu entwickeln, das die verschiedenen Aspekte des Wissensmanagements, von der Wissensidentifikation bis zur Wissensbewahrung, umfasst. Die Arbeit analysiert die terminologischen Implikationen des Wissensmanagements, beleuchtet die verschiedenen Wissensarten und untersucht die Voraussetzungen für die Einführung eines Wissensmanagement-Konzeptes.
- Wissensmanagement als strategischer Wettbewerbsfaktor
- Entwicklung eines ganzheitlichen Wissensmanagement-Konzeptes
- Terminologische Implikationen des Wissensmanagements
- Voraussetzungen für die Einführung eines Wissensmanagement-Konzeptes
- Instrumente zur Implementierung von Wissensmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Wissen als entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar und führt in die Thematik des Wissensmanagements ein. Kapitel 2 befasst sich mit den terminologischen Implikationen des Wissensmanagements. Es werden verschiedene Wissensbegriffe aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, darunter der alltägliche Sprachgebrauch, die Philosophie und die Betriebswirtschaftslehre. Des Weiteren werden verschiedene Wissensarten im Unternehmen vorgestellt und die Bedeutung des Wissensmanagements für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erläutert.
Kapitel 3 widmet sich dem Wissensmanagement als ganzheitlicher Ansatz. Es wird ein methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Wissensmanagement-Konzeptes vorgestellt und die einzelnen Bausteine des Konzeptes, wie Wissensziele, Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung, Wissensbewertung und Wissenscontrolling, werden detailliert beschrieben. Die Voraussetzungen für die Einführung eines Wissensmanagement-Konzeptes werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit den Instrumenten zur Implementierung von Wissensmanagement. Es werden sowohl technische Wissensinstrumente, wie z.B. Wissensdatenbanken und Expertensysteme, als auch humanorientierte Instrumente, wie z.B. Wissenslandkarten, und klassische Managementinstrumente, wie z.B. Balanced Scorecard und Benchmarking, vorgestellt. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des Wissensmanagements.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wissensmanagement, Wissen als Wettbewerbsfaktor, Wissensarten, Wissensmanagement-Konzept, Wissensziele, Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung, Wissensbewertung, Wissenscontrolling, Instrumente zur Implementierung von Wissensmanagement, Technische Wissensinstrumente, Humanorientierte Instrumente, Klassische Managementinstrumente.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Wissen heute als zentraler Produktionsfaktor gesehen?
In der modernen Wissensgesellschaft bestimmen Informationsvorsprung und die intelligente Nutzung von Daten maßgeblich über Wettbewerbsvorteile und unternehmerischen Erfolg.
Was ist der Unterschied zwischen Information und Wissen?
Informationen sind Daten in einem Kontext. Wissen entsteht erst, wenn diese Informationen durch Erfahrung und Vernetzung zur Lösung von Problemen genutzt werden.
Welche Bausteine umfasst ein ganzheitliches Wissensmanagement-Konzept?
Dazu gehören Wissensziele, Identifikation, Erwerb, Entwicklung, Verteilung, Nutzung, Bewahrung, Bewertung und Controlling von Wissen.
Was sind Wissenslandkarten?
Wissenslandkarten sind humanorientierte Instrumente, die grafisch darstellen, wo im Unternehmen welches Expertenwissen vorhanden ist.
Welche technischen Instrumente unterstützen das Wissensmanagement?
Beispiele sind Wissensdatenbanken, Expertensysteme und Intranets, die den schnellen Zugriff auf gespeichertes Know-how ermöglichen.
- Citar trabajo
- Alexander Ilgen (Autor), 1998, Wissensmanagement. Der Weg des Unternehmens zum "Know Body", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185146