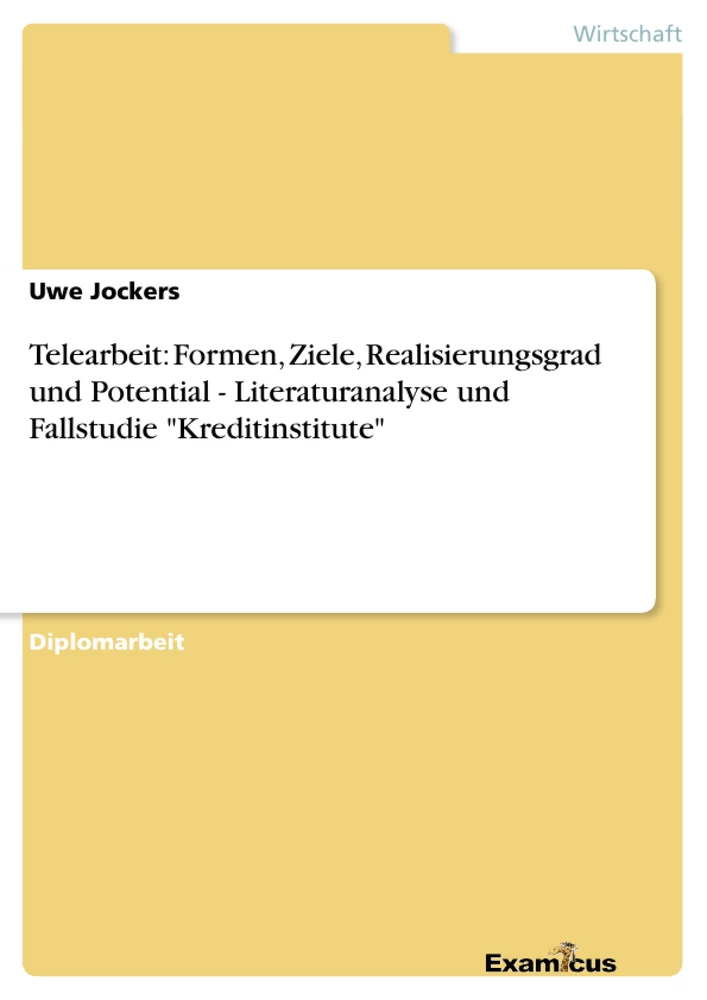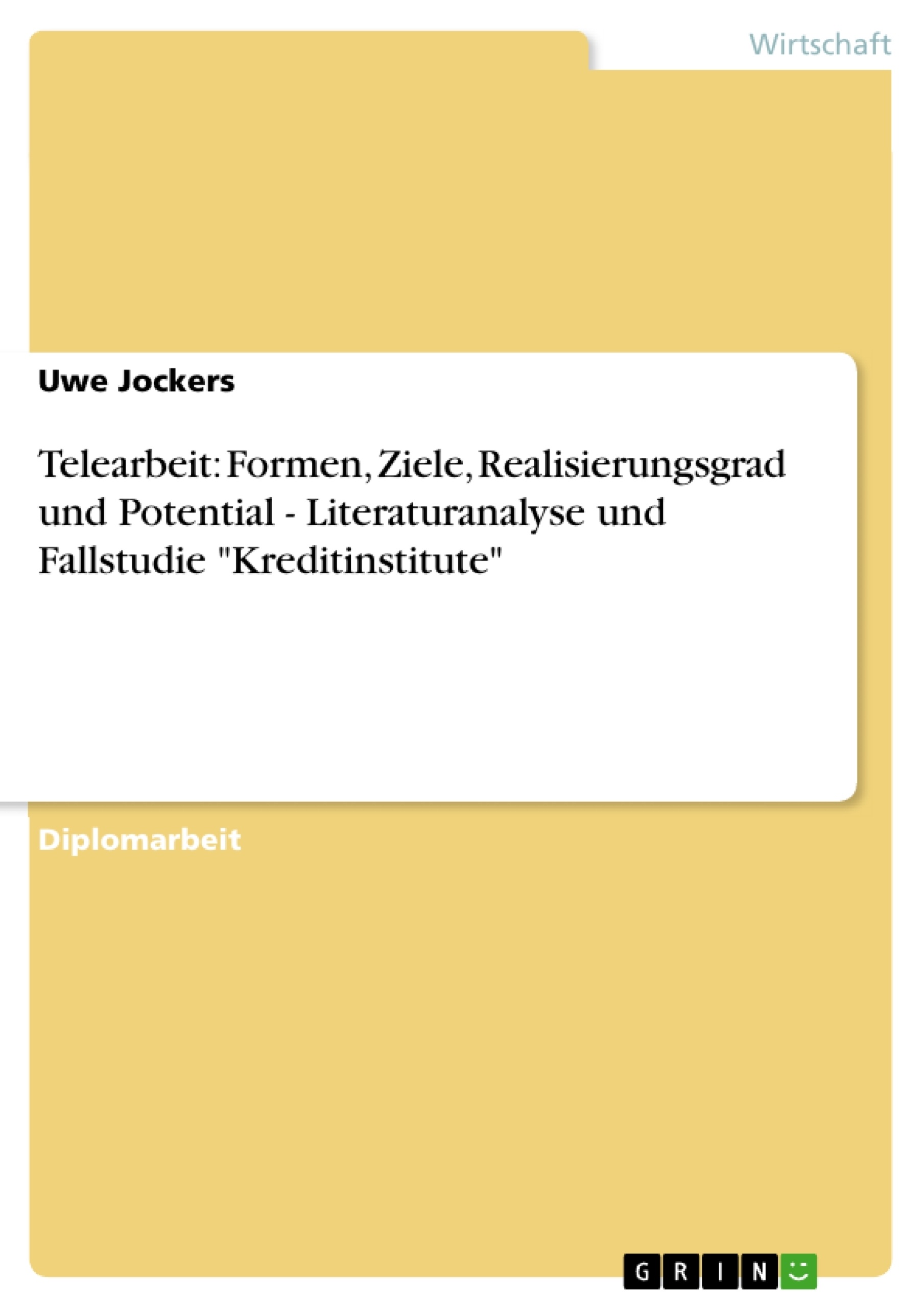Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste branchenübergreifende Teil „Literatursanalyse“ geht ausführlich auf alle mit Telearbeit in Beziehung stehenden Aspekte ein. Zunächst erfolgt eine definitorische Abgrenzung des Begriffs Telearbeit, bevor umfassend auf die vielfältigen Ausprägungsformen von Telearbeit eingegangen wird. Im Rahmen der Darstellung der gesellschaftlichen Aspekte der Telearbeit finden arbeitsmarkt- und strukturpolitische Wirkungen der Telearbeit ebenso Berücksichtigung wie ökologische und soziale Aspekte. Daran anschließend wird Telearbeit aus unternehmerischer Perspektive heraus betrachtet. Hierbei sind es insbesondere die organisatorischen Aspekte (Kommunikation, Koordination, Anforderungen an Führung und Mitarbeiter, Auswahl geeigneter Tätigkeitsfelder) und technischen Aspekte (Hard- und Software, Telekommunikationslösungen, neue Technologien, wie CSCW-Anwendungen), die eingehend behandelt werden. Ferner erfolgt eine Analyse der quantitativen und qualitativen Kosten- und Nutzenfaktoren der Telearbeit aus Sicht der Mitarbeiter und des Unternehmens. Nach der Darstellung des gegenwärtigen Einsatzstandes der Telearbeit (Analyse der Ergebnisse verschiedener auch internationaler Untersuchungen) wird der Schritt zur Branche der Kreditinstitute gemacht. Im Fallstudienteil wird zunächst die Struktur des Bankwesens in Deutschland dargestellt, bevor eine derzeit typische Aufbauorganisation einer Universalbank Grundlage für die Ableitung der Telearbeitspotentiale in Banken wird. Die Darstellung der veränderten Rahmenbedingungen im Kreditgewerbe (Veränderungen von seiten der Kunden, Mitarbeiter und Konkurrenz) stellt die Brücke zum Business Process Reengineering dar. Dieses wird auf einigen Seiten in Beziehung zur Telearbeit gesetzt und herausgearbeitet, daß Telearbeit durchaus als ein Teilaspekt eines umfassenden Reengineering angesehen werden kann. Den Abschluß der Arbeit bildet eine empirische Untersuchung in 72 Kreditinstituten hinsichtlich deren Telearbeitsaktivitäten. Da Kreditinstitute als für Telearbeit prädestiniert gelten, werden die Ergebnisse der Bankuntersuchung mit den Ergebnissen branchenübergreifender Untersuchungen (z.B. des Fraunhofer Instituts oder der empirica) abgeglichen. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Erkenntnisgewinn und einigen Gedanken zur weiteren Entwicklung der Telearbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- LITERATURANALYSE
- Historische Entwicklung, Definition und Formen der Telearbeit
- Geschichte der Telearbeit
- Definition der Telearbeit
- Organisationsformen der Telearbeit
- Reine Teleheimarbeit
- Satellitenbüros
- Nachbarschaftsbüros, Telecottages und Telezentren
- Alternierende Telearbeit als Mischform
- Mobile Telearbeit als Mischform
- Virtuelle Unternehmen
- Zusammenfassung, Bewertung und Vereinbarungen für das weitere Vorgehen
- Gesellschaftliche Aspekte der Telearbeit
- Arbeitsmarkt- und strukturpolitische Aspekte der Telearbeit
- Ökologische Aspekte der Telearbeit
- Soziale Aspekte der Telearbeit
- Zusammenfassung und Bewertung
- Unternehmensbezogene Aspekte der Telearbeit
- Organisatorische Aspekte der Telearbeit
- Neue Bedingungen für die Kommunikation und Koordination
- Anforderungen an Führung und Mitarbeiter
- Auswahl der geeigneten Tätigkeitsfelder und Organisationsform
- Technische Aspekte der Telearbeit
- Grundlagen der Gestaltung von Telearbeitsplätzen
- Hardwareausstattung
- Telekommunikationsausstattung
- Software und Dienste
- CSCW-Anwendungen als Motor für Telearbeit
- Datenschutz und Datensicherheit
- Kosten und Nutzen der Telearbeit
- Kosten und Nutzen für das Unternehmen
- Kosten und Nutzen für den Telearbeiter
- Zusammenfassung und Bewertung
- Daten zur Telearbeit: Akteure, Projekte, Realisierungsgrad und Potential
- Akteure und Projekte
- Private Initiativen zur Telearbeit
- Politische Initiativen zur Telearbeit
- Realisierungsgrad und Potentiale der Telearbeit
- Realisierungsgrad der Telearbeit
- Potentiale der Telearbeit
- Zusammenfassung und Bewertung
- FALLSTUDIE
- Telearbeit in Kreditinstituten
- Definition 'Kreditinstitut' - Typen und Merkmale von Kreditinstituten
- Potentiale für Telearbeit in Kreditinstituten
- Potentiale in Hilfsabteilungen
- Potentiale in Leistungsabteilungen
- Potentiale in Stabsabteilungen
- Potentiale in sonstigen Bereichen und Perspektiven
- Veränderte Rahmenbedingungen der Kreditinstitute
- Veränderungen von seiten der Mitarbeiter
- Veränderungen von seiten der Kunden
- Veränderungen von seiten der Konkurrenz
- Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen: Reengineering und Telearbeit
- Zusammenfassung und Bewertung
- Schriftliche Befragung zur Telearbeit in Kreditinstituten
- Zielsetzung
- Untersuchungsdesign
- Auswertung der schriftlichen Befragung
- Verständnis von Telearbeit und Realisierungsgrad
- Einführung der Telearbeit
- In Telearbeit praktizierte Tätigkeiten - Potentiale für Telearbeit in Banken
- Hemmende Faktoren der Telearbeit
- Technische Aspekte, Kostenverteilung und Kommunikation
- Zusammenfassung und Bewertung
- Historische Entwicklung und Definition der Telearbeit
- Organisationsformen der Telearbeit
- Gesellschaftliche und unternehmensbezogene Aspekte der Telearbeit
- Realisierungsgrad und Potentiale der Telearbeit
- Telearbeit in Kreditinstituten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Telearbeit und untersucht dessen Formen, Ziele, Realisierungsgrad und Potentiale. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein umfassendes Bild der Telearbeit zu zeichnen und deren Bedeutung für Unternehmen und Arbeitnehmer zu beleuchten. Die Arbeit gliedert sich in eine Literaturanalyse und eine Fallstudie, die sich auf Kreditinstitute konzentriert.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung der Telearbeit ein und erläutert die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit. Die Literaturanalyse beleuchtet die historische Entwicklung der Telearbeit, definiert den Begriff und stellt verschiedene Organisationsformen vor. Sie analysiert die gesellschaftlichen und unternehmensbezogenen Aspekte der Telearbeit, einschließlich der technischen Voraussetzungen, des Datenschutzes und der Kosten-Nutzen-Analyse.
Die Fallstudie konzentriert sich auf die Telearbeit in Kreditinstituten. Sie definiert den Begriff 'Kreditinstitut' und untersucht die Potentiale für Telearbeit in verschiedenen Abteilungen. Die Arbeit analysiert die veränderten Rahmenbedingungen der Kreditinstitute und die Reaktion auf diese Veränderungen durch Reengineering und Telearbeit.
Die schriftliche Befragung zur Telearbeit in Kreditinstituten untersucht das Verständnis von Telearbeit, den Realisierungsgrad, die Einführung der Telearbeit, die in Telearbeit praktizierten Tätigkeiten, die hemmenden Faktoren und die technischen Aspekte, die Kostenverteilung und die Kommunikation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Telearbeit, Formen der Telearbeit, Ziele der Telearbeit, Realisierungsgrad der Telearbeit, Potentiale der Telearbeit, Literaturanalyse, Fallstudie, Kreditinstitute, Reengineering, Kommunikation, Kosten-Nutzen-Analyse, Datenschutz, Datensicherheit, technische Aspekte, gesellschaftliche Aspekte, unternehmensbezogene Aspekte, Arbeitsmarkt, Strukturpolitik, Ökologie, Soziales, Mitarbeiter, Kunden, Konkurrenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche verschiedenen Formen der Telearbeit gibt es?
Man unterscheidet reine Teleheimarbeit, Satellitenbüros, Nachbarschaftsbüros (Telezentren), alternierende Telearbeit (Mischung aus Büro und Zuhause) sowie mobile Telearbeit.
Warum gelten Kreditinstitute als prädestiniert für Telearbeit?
Viele Tätigkeiten in Banken sind informationsbasiert und können unabhängig vom Standort durchgeführt werden, insbesondere in Hilfs-, Leistungs- und Stabsabteilungen.
Was sind die Vorteile von Telearbeit für Unternehmen?
Unternehmen können Büroflächenkosten sparen, die Flexibilität erhöhen und durch moderne Arbeitsmodelle attraktiver für qualifizierte Mitarbeiter werden.
Welche Rolle spielt Datenschutz bei der Telearbeit in Banken?
Datenschutz und Datensicherheit sind zentrale technische Aspekte. In Kreditinstituten müssen besonders hohe Sicherheitsstandards für den Fernzugriff auf sensible Kundendaten gewährleistet sein.
Was ergab die empirische Untersuchung bei 72 Kreditinstituten?
Die Befragung analysiert den tatsächlichen Realisierungsgrad, hemmende Faktoren (wie Führungskultur) und die in der Praxis am häufigsten für Telearbeit genutzten Tätigkeitsfelder.
- Arbeit zitieren
- Uwe Jockers (Autor:in), 1997, Telearbeit: Formen, Ziele, Realisierungsgrad und Potential - Literaturanalyse und Fallstudie "Kreditinstitute", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185169