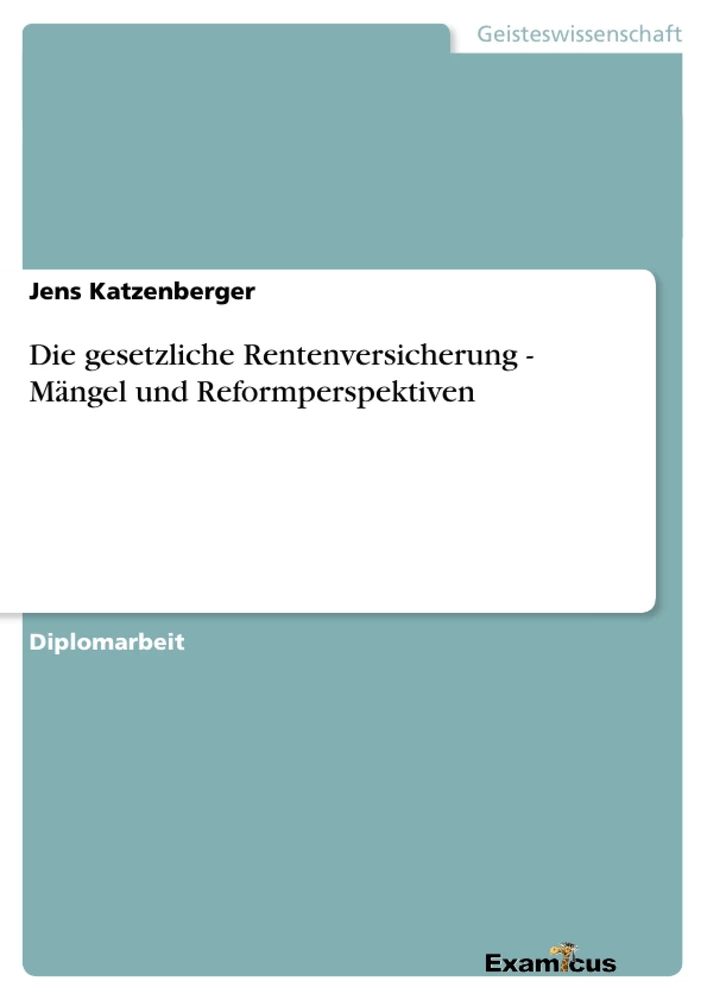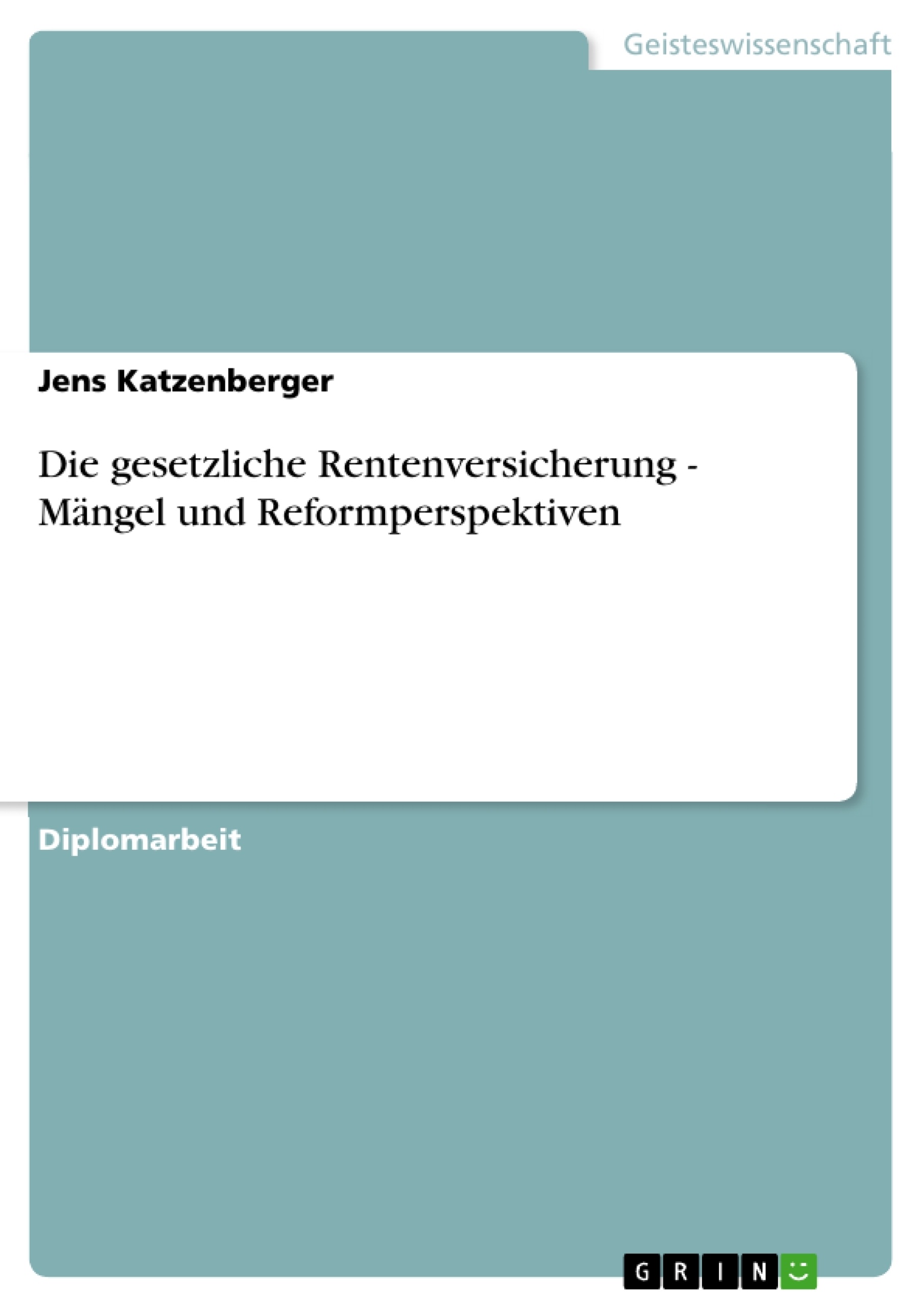Alterssicherung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die fast alle Felder politischen und gesellschaftlichen Handelns berührt. Demographische Aspekte müssen bei der Diskussion ebenso beachtet werden, wie die Situation in der Arbeitswelt. Veränderungen im soziologischen Aufbau (neue Rolle der Frauen) unserer Gesellschaft müssen ebenso berücksichtigt werden, wie finanzpolitische Zwänge. Soziale Aspekte, wie Solidarität und Armutsvermeidung einerseits und marktwirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Freiheit andererseits sollten sich die Waage halten. Jeder wird im Laufe seines Lebens mit dem System der Alterssicherung in Kontakt kommen. Während der aktiven Erwerbsphase trägt man als Beitragszahler zum Erhalt des Systems bei, um im Gegenzug Ansprüche an das System für die Zukunft zu erwerben. Im Alter gehört man dann zu den Leistungsempfängern. Auch als Kind ist man quasi schon Teil des Generationenvertrags, da das System für zukünftige Beitragszahlungen nicht in der Luft schwebt, sondern von einer nachwachsenden Generation getragen werden muß. Somit ist klar, daß das System der Alterssicherung ein fester Bestandteil unseres Lebens ist. Früher nahm diesen Platz die Großfamilie ein, sozusagen ein Generationenvertrag im Kleinen. Die Stabilität des Systems, die Belastung und die Leistungen, die durch es verursacht bzw. gewährleistet werden, wirken sich umfassend auf die Lebensbedingungen der Menschen aus, die Teil des Systems sind. Gerät das System in eine Krise, besteht auch eine gesamtgesellschaftliche Krise. Die Krisen können verschiedenster Natur sein, es können sich ändernde Rahmenbedingungen oder es können auch Fehler im System sein, die zu Vertrauensverlusten führen (z.B. Benachteiligung von Frauen, Armut im Alter). Hieraus sind auch viele Tätigkeitsfelder für die soziale Arbeit erkennbar, darum ist es für die Sozialarbeit auch wichtig, sich in die Diskussion einzumischen. Die Beiträge zur Alterssicherung gehören zu den vielbeschworenen Lohnnebenkosten und sind somit Bestandteil der Diskussion um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Auch hierbei darf sich die Sozialarbeit nicht heraushalten. Schließlich tangiert die Alterssicheruung auch die gesamte Bandbreite familiären Zusammenlebens. Zuletzt ist die Alterssicherung auch Bestandteil des solidarischen Versicherungssystems, welches in unserer Gesellschaft seit langer Zeit für sozialen Ausgleich sorgt. Der Diskussion, ob das auch in Zukunft so ist, sollten sich Sozialarbeiter nicht verstellen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS JETZIGE MODELL DER GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG - GESCHICHTE, SYSTEM UND FINANZIERUNG
- DIE GESCHICHTE DER GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG
- Die Gründung der gesetzlichen Rentenversicherung als eine Folge der industriellen Revolution
- Die gesetzliche Rentenversicherung bis zur Rentenreform 1957
- Rentenberechnung
- Die Rente von 1957 bis heute
- DAS JETZIGE SYSTEM - VERSICHERTE, LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN, LEISTUNGEN
- Versichertenkreis
- Die rentenrechtlichen Zeiten
- Rentenberechnung
- Die Gesamtleistungsbewertung
- Die Leistungen der GRV
- Die Rentenarten
- Fremdrenten
- Die rentenrechtlichen Zeiten, die in der ehemaligen DDR erworben wurden
- Rehabilitation
- FINANZIERUNG DES SYSTEMS
- Die Einnahmen
- Die Beitragszahlungen
- Der Bundeszuschuß
- Die Ausgaben
- Rentenausgaben
- Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und gesetzlichen Pflegeversicherung (GPV) der Rentner
- Rehabilitationsmaßnahmen
- Rückschlüsse aus der Finanzierungssituation der GRV
- MÄNGEL DER BESTEHENDEN GESETZLICHEN ALTERSSICHERUNG
- DEMOGRAPHISCHE VERÄNDERUNGEN ALS LANGFRISTIGE GEFÄHRDUNG DER GRV
- Die bisherige Entwicklung des Gebährverhaltens (Fertilität), der Sterblichkeit (Mortalität) und der Migration
- Die zukünftige demographische Entwicklung und die Auswirkungen auf die GRV
- Erhöhung der Frauenerwerbsquote
- Kontrollierte Einwanderung
- Schlußfolgerungen aus der demographischen Entwicklung
- MÄNGEL IM HINBLICK AUF ENTWICKLUNGEN IN DER ARBEITSWELT
- Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
- Auswirkungen der Änderungen des Erwerbsverhaltens auf die GRV und auf die Anwartschaften der Versicherten
- Fazit aus der Entwicklung der Arbeitswelt
- BENACHTEILIGUNG VON FRAUEN
- Kindererziehung
- Altersgrenzen
- Benachteiligungen bei den Erwerbsunfähigkeitsrenten
- Berechnung beitragsfreier Zeiten
- Hinterbliebenenrecht
- Fazit aus der frauenfeindlichen Ausgestaltung des Rentenrechts
- SCHLECHTERSTELLUNG DER FAMILIEN
- Zum Wesen des Familienlastenausgleichs
- Der Familienlastenausgleich in der GRV
- Zur Bewertung des Familienlastenausgleich außerhalb der GRV
- KANN DIE GRV ARMUT IM ALTER VERHINDERN?
- Wie stellt sich Altersarmut dar?
- Die Rolle der GRV bei der Entstehung und Bekämpfung von Altersarmut
- Zur zukünftigen Entwicklung von Altersarmut
- DIE BELASTUNG DER GRV DURCH DIE SOGENANNTEN „VERSICHERUNGSFREMDE LEISTUNGEN“
- Versuch einer Definition - Was sind versicherungsfremde Leistungen?
- Die versicherungsfremden Leistungen im einzelnen
- Umfang der versicherungsfremden Leistungen und die Abdeckung durch den Bundeszuschuß
- Rechtliche und soziale Beurteilung der bisherigen Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen
- MÖGLICHE ALTERNATIVEN AN STELLE DES BESTEHENDE SYSTEMS
- DAS KAPITALDECKUNGSVERFAHREN
- Demographische und wachtsumsfördernde Argumente
- Das Kapitalanlageproblem
- Politische und soziale Gegenargumente
- DIE GRUNDRENTE
- Argumente für die Einführung einer Bürgerrente
- Kritische Betrachtungen des Grundrentenmodells
- DIE ALTERNATIV-MODELLE ALS REFORMANSTÖBE
- ALTERSSICHERUNG IN EUROPA
- ALTERSSICHERUNGSYSTEME IM VERGLEICH
- DIE ALTERSSICHERUNG IN DER SCHWEIZ
- Darstellung des schweizerischen Modells
- Beurteilung des schweizerischen Modells
- DIE STAATLICHE ALTERSVORSORGE IN GROßBRITANNIEN
- Darstellung des Systems der staatliche Altersvorsorge in Großbritannien
- Beurteilung des Systems der staatliche Altersvorsorge in Großbritannien
- DIE AKTUELLE DISKUSSION
- DIE VORSCHLÄGE DER KOMMISSION,,FORTENTWICKLUNG DER RENTENVERSICHERUNG"
- Grundentscheidungen
- Die Vorschläge der Kommission im einzelnen
- Die erwarteten Finanzwirkungen der Vorschläge der Kommission
- Beurteiliung der Vorschläge der Komission
- STELLUNGNAHMEN DER REGIERUNGSKOALITION UND DER OPPOSITIONSPARTEIEN
- Der Gesetzentwurf vom 18. Juni 1997 als Stellungnahme der Regierungskoalition
- Stellungnahme der Alterssicherungskommission der SPD-,,Strukturreform statt Leistungskürzungen“
- Einschätzungen und Reformvorschläge der Kommission
- Kritische Betrachtung der Vorschläge
- Vorschläge von Bündnis '90/Die Grünen -,,Den Generationenvertrag neu verhandeln"
- Die Reformvorschläge von Bündnis '90/Die Grünen im einzelnen
- Kritische Betrachtung der Vorschläge
- WEITERE STELLUNGNAHMEN VERSCHIEDENER GESELLSCHAFTLICHER GRUPPEN
- Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
- Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
- Eine Studie des IW als Stellungnahme von Arbeitgeberseite
- Die Eckpunkte einer Reform der Alterssicherung nach Ansicht des IW
- Kritische Betrachtung der Vorschläge
- SCHLUBBEMERKUNGEN
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. Sie analysiert das bestehende System, beleuchtet seine Mängel und diskutiert mögliche Reformansätze. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der aktuellen Situation der Altersvorsorge in Deutschland zu zeichnen und die Herausforderungen für die Zukunft aufzuzeigen.
- Die Geschichte und Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung
- Die Finanzierung des Systems und die demographischen Herausforderungen
- Die Mängel des bestehenden Systems, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitswelt, Frauen und Familien
- Mögliche Reformansätze und alternative Modelle der Altersvorsorge
- Der internationale Vergleich von Alterssicherungssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise dar.
Kapitel 1 beleuchtet das bestehende Modell der gesetzlichen Rentenversicherung. Es geht auf die Geschichte des Systems, die Finanzierung und die Leistungen ein. Die Kapitel 1.1 und 1.2 beschreiben die Entwicklung der Rentenversicherung von ihren Anfängen bis zur Gegenwart und erläutern die Funktionsweise des aktuellen Systems. Kapitel 1.3 analysiert die Finanzierung des Systems und die Herausforderungen, die sich aus der demographischen Entwicklung ergeben.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Mängeln des bestehenden Systems. Es werden die Auswirkungen der demographischen Entwicklung, der Arbeitswelt und der Benachteiligung von Frauen und Familien auf die Rentenversicherung untersucht. Kapitel 2.1 analysiert die demographischen Herausforderungen, die sich aus der Alterung der Gesellschaft ergeben. Kapitel 2.2 beleuchtet die Auswirkungen der Arbeitswelt auf die Rentenversicherung, insbesondere die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit und der Veränderungen des Erwerbsverhaltens. Kapitel 2.3 und 2.4 befassen sich mit der Benachteiligung von Frauen und Familien im Rentenrecht. Kapitel 2.5 diskutiert die Rolle der Rentenversicherung bei der Entstehung und Bekämpfung von Altersarmut.
Kapitel 3 stellt verschiedene alternative Modelle der Altersvorsorge vor. Es werden das Kapitaldeckungsverfahren, die Grundrente und weitere Reformansätze diskutiert. Kapitel 3.1 analysiert das Kapitaldeckungsverfahren und seine Vor- und Nachteile. Kapitel 3.2 beleuchtet die Grundrente und ihre potenziellen Auswirkungen. Kapitel 3.3 diskutiert die verschiedenen Reformansätze und ihre Relevanz für die Zukunft der Altersvorsorge.
Kapitel 4 vergleicht die Alterssicherungssysteme in Europa. Es werden die Systeme in der Schweiz und in Großbritannien vorgestellt und analysiert. Kapitel 4.1 bietet einen Überblick über die verschiedenen Alterssicherungssysteme in Europa. Kapitel 4.2 und 4.3 analysieren die Systeme in der Schweiz und in Großbritannien im Detail.
Kapitel 5 beleuchtet die aktuelle Diskussion um die Reform der Rentenversicherung. Es werden die Vorschläge der Kommission „Fortentwicklung der Rentenversicherung“ sowie die Stellungnahmen der Regierung, der Opposition und verschiedener gesellschaftlicher Gruppen vorgestellt und analysiert. Kapitel 5.1 analysiert die Vorschläge der Kommission und ihre potenziellen Auswirkungen. Kapitel 5.2 beleuchtet die Stellungnahmen der Regierung, der Opposition und verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Kapitel 5.3 diskutiert die verschiedenen Reformvorschläge und ihre Relevanz für die Zukunft der Altersvorsorge.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die gesetzliche Rentenversicherung, Altersvorsorge, demographische Entwicklung, Arbeitswelt, Frauen, Familien, Altersarmut, Reformansätze, Kapitaldeckungsverfahren, Grundrente, internationale Vergleiche und die aktuelle Diskussion um die Reform der Rentenversicherung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die größte Herausforderung für die gesetzliche Rentenversicherung (GRV)?
Die demographische Entwicklung, insbesondere die alternde Gesellschaft und sinkende Geburtenraten, gefährdet die langfristige Finanzierbarkeit des Umlageverfahrens.
Warum werden Frauen im aktuellen Rentensystem oft benachteiligt?
Frauen haben oft geringere Rentenanwartschaften durch Kindererziehungszeiten, Teilzeitarbeit und niedrigere Löhne, was das Risiko für Altersarmut erhöht.
Was versteht man unter „versicherungsfremden Leistungen“?
Das sind Leistungen, die nicht durch Beiträge gedeckt sind, sondern gesamtgesellschaftliche Aufgaben darstellen (z.B. Renten für Kindererziehung oder Kriegsfolgelasten), die eigentlich aus Steuern finanziert werden sollten.
Welche Alternativen gibt es zum aktuellen Rentensystem?
Diskutiert werden unter anderem das Kapitaldeckungsverfahren (private Vorsorge), eine steuerfinanzierte Grundrente oder Modelle wie in der Schweiz (Drei-Säulen-System).
Wie funktioniert der „Generationenvertrag“?
Die aktuell Erwerbstätigen finanzieren durch ihre Beiträge die Renten der aktuellen Rentner, in der Erwartung, dass die nachfolgende Generation später dasselbe für sie tut.
- Quote paper
- Jens Katzenberger (Author), 1997, Die gesetzliche Rentenversicherung - Mängel und Reformperspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185214