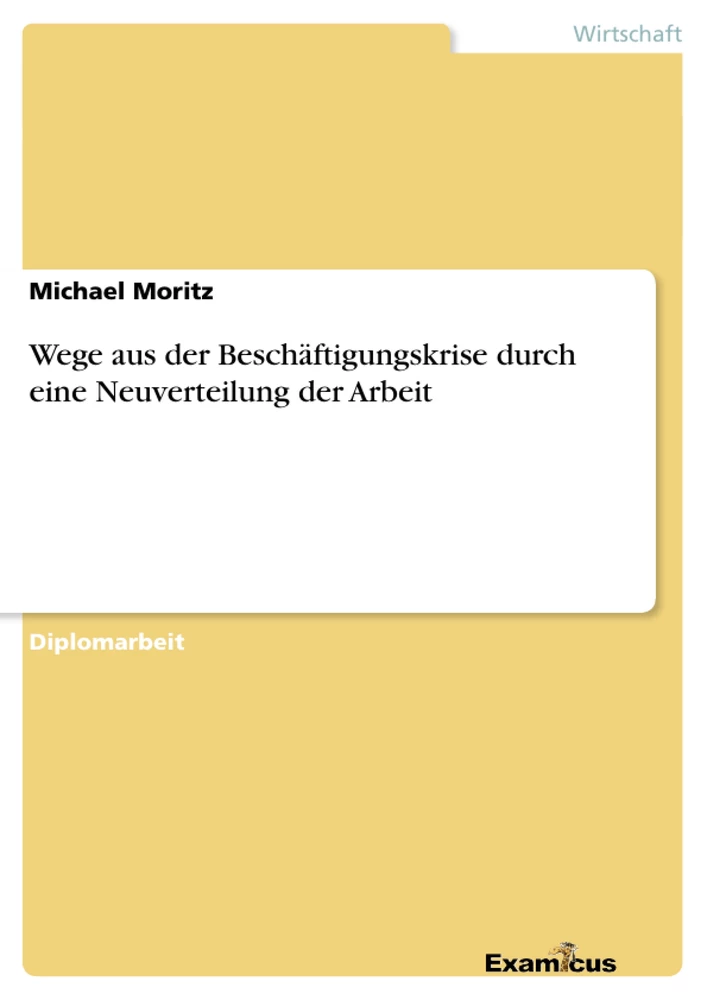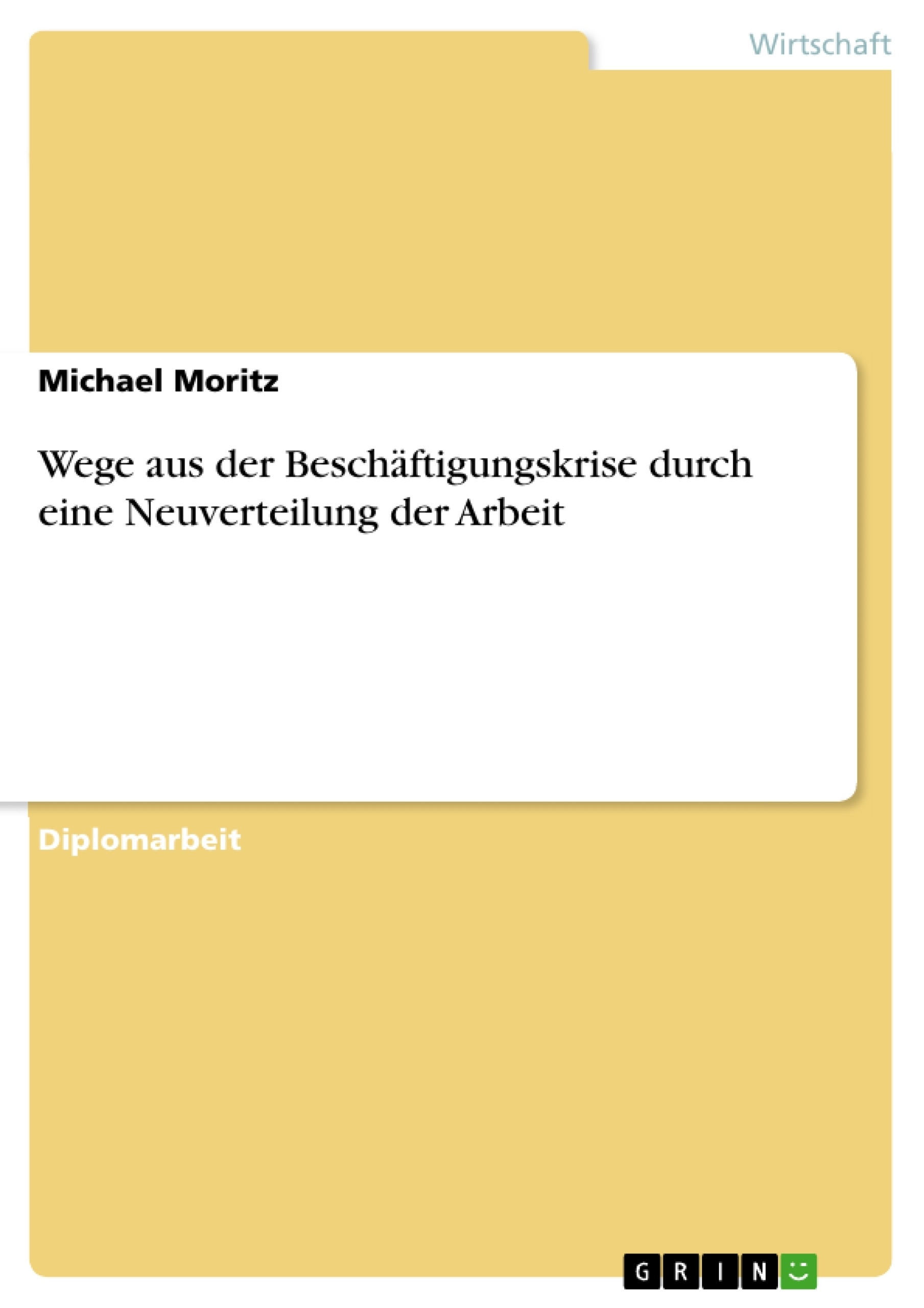Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll untersucht werden, inwieweit ein Interessenausgleich zwischen Arbeitslosen und Arbeitnehmern, die ihre Arbeitszeit verkürzen wollen, mit dem Ziel einer höheren Beschäftigungsquote erreicht werden kann. Dabei werden unter dem Begriff “Beschäftigung” explizit auch Formen jenseits der Erwerbsarbeit miteinbezogen und wird geprüft, welche Beschäfti-gungsformen zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes beitragen können. Einen zentralen Stellenwert nimmt die Berücksichtigung der Arbeitszeitpräferenzen von erwerbsfähigen Personen ein. Durch die Prämisse der Freiwilligkeit, eine Arbeit aufzunehmen bzw. die Arbeitszeit zu reduzieren, soll erreicht werden, daß alle daran beteiligten Personen (derzeitige Arbeitnehmer, derzeitige Arbeitslose, Arbeitgeber) im ökonomischen Sinne bessergestellt (bzw. zumindest nicht schlechter gestellt) werden.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Krise am Arbeitsmarkt
- 1.1 Problem- und Fragestellungen
- 1.2 Ziel der Arbeit und Themaabgrenzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Quellen- und Literaturlage
- 2. Arbeit im Wandel der Zeit
- 2.1 Was ist Arbeit?
- 2.1.1 Unterschiedliche Bewertung identischer Tätigkeiten
- 2.1.2 Der Stellenwert der Erwerbsarbeit
- 2.1.3 Wesentliche Eigenschaften von Arbeit
- 2.2 Erwerbsformen im Umbruch
- 2.2.1 Der Umbruch in der Statistik
- 2.2.2 Ursachen des Umbruchs
- 2.3 Einbeziehung der Ressource Zeit: Mangel an Zeit statt Mangel an Geld
- 2.4 Arbeitszeit und Arbeitszeitpräferenzen
- 2.4.1 Gesetzliche Bestimmungen
- 2.4.2 Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der Arbeitszeit
- 2.4.3 Arbeitszeitwünsche
- 2.1 Was ist Arbeit?
- 3. Neuverteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung und -flexibilisierung
- 3.1 Tarifliche Arbeitszeitverkürzung
- 3.1.1 Generelle Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich
- 3.1.2 Generelle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich
- 3.2 Freiwillige Arbeitszeitverkürzung: Ungenutzte Potentiale bei Teilzeitbeschäftigung
- 3.2.1 Schwierigkeit einer exakten Abgrenzung
- 3.2.2 Struktur der Teilzeitarbeit in Deutschland
- 3.2.3 Teilzeitquoten im internationalen Vergleich
- 3.2.4 Schätzansätze für die Erhöhung der Teilzeitquote
- 3.2.5 Bewertung der Schätzansätze
- 3.3 Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung
- 3.3.1 Modelle zur Flexibilisierung der Arbeitszeit
- 3.3.2 Telearbeit
- 3.4 Vor- und Nachteile reduzierter und flexibler Arbeitszeitbudgets
- 3.1 Tarifliche Arbeitszeitverkürzung
- 4. Mehr Beschäftigung durch Überstundenabbau
- 4.1 Geleistete Überstunden in Deutschland
- 4.1.1 Überstundenarbeit seit 1960
- 4.1.2 Verteilung des Überstundenvolumens
- 4.2 Gründe für Überstundenarbeit
- 4.3 Schätzansätze für einen beschäftigungsorientierten Abbau von Überstunden
- 4.4 Bewertung der Schätzansätze
- 4.1 Geleistete Überstunden in Deutschland
- 5. Aufwertung unbezahlter Arbeit
- 5.1 Unbezahlte Arbeit der privaten Haushalte
- 5.2 Ehrenamtliches Engagement
- 5.2.1 Definition des Begriffs “Ehrenamt”
- 5.2.2 Ehrenamtliches Engagement im Überblick
- 5.2.2.1 Verteilung nach ausgewählten Merkmalen
- 5.2.2.2 Strukturwandel beim Ehrenamt
- 5.2.3 Entlastung des Arbeitsmarktes durch Erhöhung der Attraktivität von Ehrenämtern
- 5.2.3.1 Die Idee der Bürgerarbeit
- 5.2.3.2 Beurteilung der Chancen von Bürgerarbeit
- 5.3 Modell eines Erziehungsgehaltes
- 5.3.1 Benachteiligung von Erziehenden
- 5.3.2 Vorschläge zur Einführung eines Erziehungsgehaltes
- 5.3.3 Beschäftigungseffekte bei Einführung eines Erziehungsgehaltes
- 5.3.4 Kritische Würdigung der Vorschläge
- 6. Anreize für Arbeitslose zur Aufnahme von Arbeit
- 6.1 Die Entwicklung des "klassischen" zweiten Arbeitsmarktes
- 6.2 Eine negative Einkommensteuer
- 6.2.1 Mangelnder Anreiz zur Arbeitsaufnahme
- 6.2.2 Das Modell der negativen Einkommensteuer
- 6.2.3 Einwände gegen die negative Einkommensteuer
- 6.3 Ein dritter Sektor für Gemeinschaftsaufgaben
- 6.4 Übernahme von Ehrenämtern
- 6.4.1 Zeitliche Beschränkung kraft Gesetzes
- 6.4.2 Geringes Interesse von Arbeitslosen
- 6.4.3 Qualifizierung durch Ehrenamt
- 6.4.4 Keine Alternative zum ersten Arbeitsmarkt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Beschäftigungskrise in Deutschland durch eine Neuverteilung der Arbeit gelöst werden kann. Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Arbeitszeitverkürzung, -flexibilisierung und -umverteilung, um die Beschäftigung zu erhöhen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Implikationen der verschiedenen Modelle beleuchtet.
- Arbeitszeitverkürzung und -flexibilisierung als Mittel zur Beschäftigungssteigerung
- Überstundenabbau als Instrument zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Aufwertung unbezahlter Arbeit und deren Potenzial für die Arbeitsmarktpolitik
- Anreize für Arbeitslose zur Aufnahme von Arbeit durch verschiedene Modelle
- Die Rolle des Staates bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen und der Förderung von Beschäftigung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Problematik der Beschäftigungskrise in Deutschland dar und definiert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Es werden die wichtigsten Fragestellungen und die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Wirtschaftslage beleuchtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Wandel der Arbeit im Laufe der Zeit. Es werden verschiedene Definitionen von Arbeit diskutiert und der Stellenwert der Erwerbsarbeit in der heutigen Gesellschaft beleuchtet. Zudem werden die Ursachen für den Wandel der Erwerbsformen und die Bedeutung der Ressource Zeit im Kontext der Arbeitswelt analysiert.
Das dritte Kapitel untersucht die Möglichkeiten der Neuverteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung und -flexibilisierung. Es werden verschiedene Modelle der Arbeitszeitverkürzung, wie z.B. die generelle Arbeitszeitverkürzung mit und ohne Lohnausgleich, sowie die Teilzeitbeschäftigung, analysiert. Zudem werden die Vor- und Nachteile flexibler Arbeitszeitmodelle, wie z.B. Telearbeit, diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Potenzial des Überstundenabbaus zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Es werden die Ursachen für Überstundenarbeit in Deutschland analysiert und verschiedene Schätzansätze für einen beschäftigungsorientierten Abbau von Überstunden vorgestellt.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Aufwertung unbezahlter Arbeit. Es werden die Bedeutung der unbezahlten Arbeit in privaten Haushalten und das ehrenamtliche Engagement in Deutschland beleuchtet. Zudem werden die Chancen und Herausforderungen der Bürgerarbeit und die Idee eines Erziehungsgehaltes diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Beschäftigungskrise, die Neuverteilung der Arbeit, Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitflexibilisierung, Teilzeitbeschäftigung, Überstundenabbau, unbezahlte Arbeit, Ehrenamt, Bürgerarbeit, Erziehungsgehalt, negative Einkommensteuer und der dritte Sektor.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann Arbeitszeitverkürzung die Beschäftigungskrise lösen?
Durch eine Neuverteilung des vorhandenen Arbeitsvolumens auf mehr Köpfe kann die Arbeitslosigkeit gesenkt werden.
Was versteht man unter „Bürgerarbeit“?
Ein Modell zur Aufwertung ehrenamtlicher Tätigkeiten für Gemeinschaftsaufgaben, um dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu geben.
Welche Rolle spielt der Überstundenabbau?
Ein systematischer Abbau von Überstunden könnte rechnerisch tausende neue Vollzeitstellen schaffen.
Was ist eine negative Einkommensteuer?
Ein Modell zur Schaffung von Arbeitsanreizen, bei dem Geringverdiener staatliche Zuschüsse statt Steuerabzüge erhalten.
Wie wird unbezahlte Arbeit in der Statistik berücksichtigt?
Die Arbeit fordert eine stärkere Einbeziehung von Erziehungsleistungen und Hausarbeit in das Verständnis von gesellschaftlich relevanter „Beschäftigung“.
- Arbeit zitieren
- Michael Moritz (Autor:in), 1998, Wege aus der Beschäftigungskrise durch eine Neuverteilung der Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185289