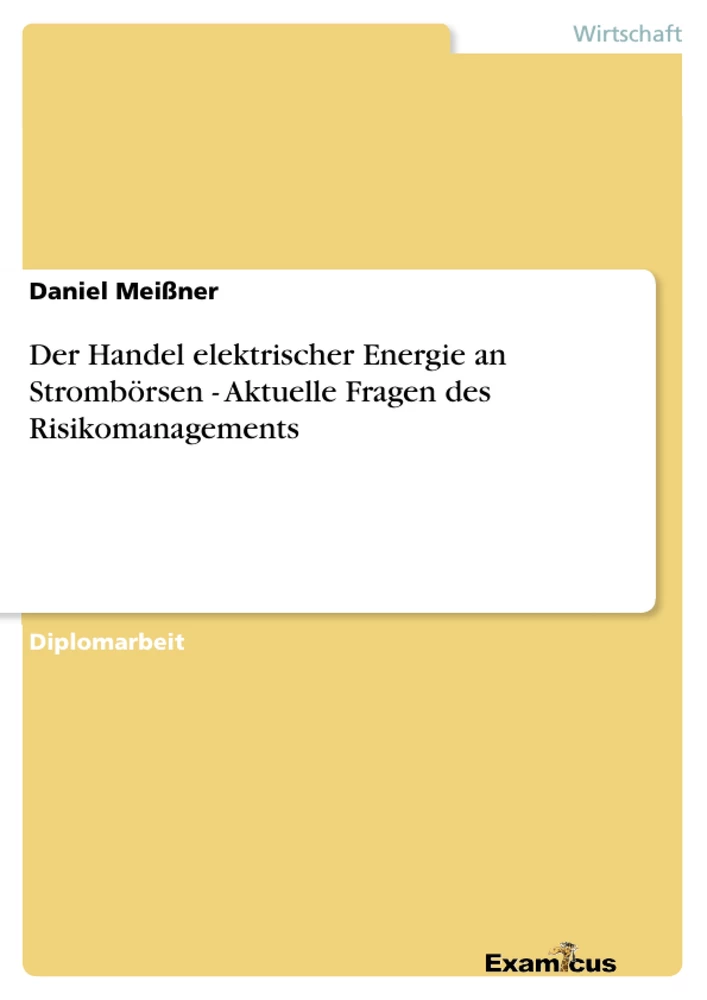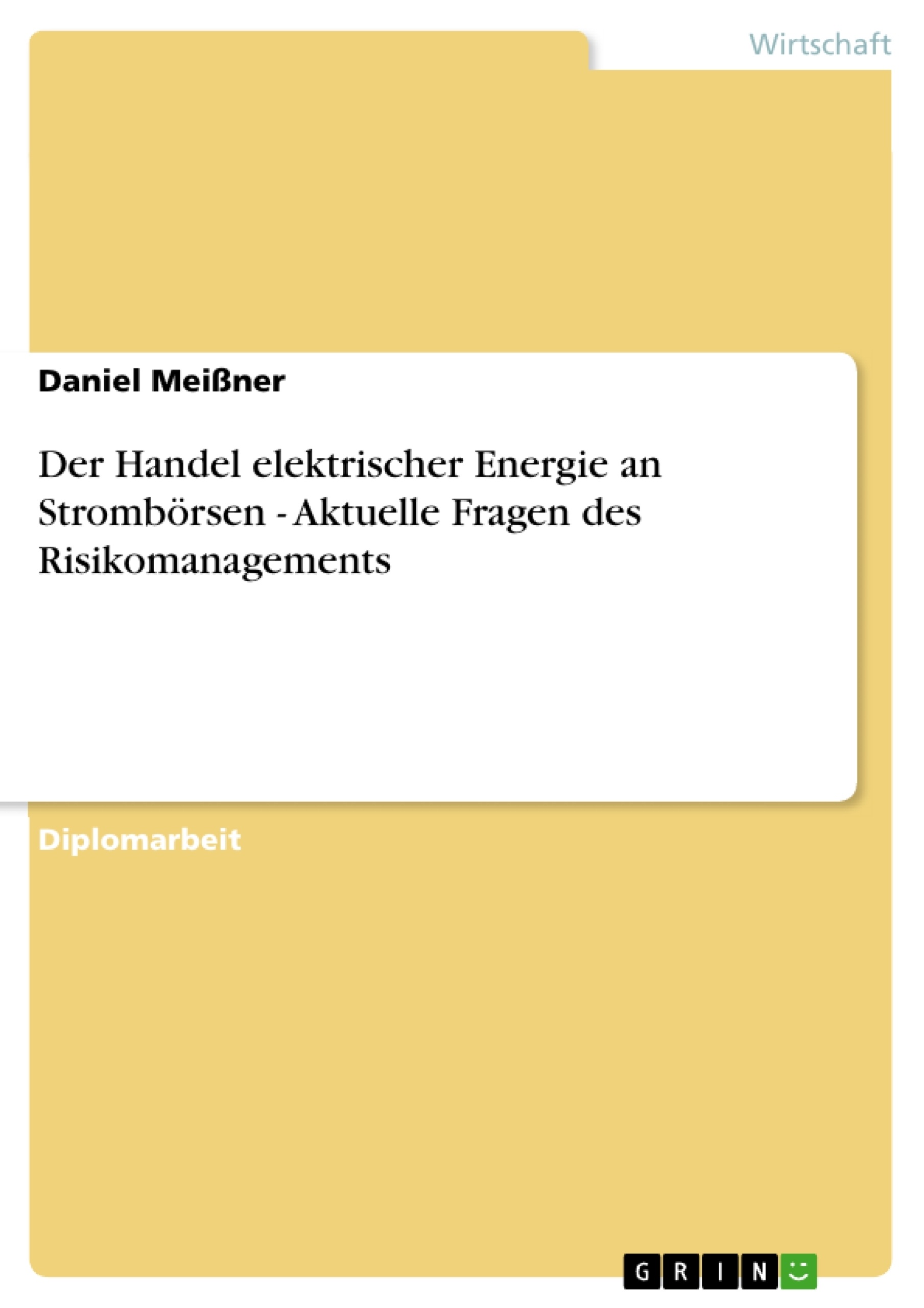Mit Inkrafttreten der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im April 1998 wurde der deutsche Elektrizitätsmarkt in einem Schritt dereguliert. Seit diesem Termin können Industrie- und Privatkunden in Deutschland ihren Stromlieferanten selbst wählen. Die Liberalisierung der ehemals durch Gebietsmonopole geschützten Energiewirtschaft ist ein weltweiter Trend. Auf den deregulierten Märkten ist, zusätzlich zur Stromerzeugung und dem Stromtransport, ein neues Element der Elektrizitätswirtschaft entstanden: Der Handel mit Strom. Der freie Handel mit elektrischer Energie birgt sowohl Chancen als auch Risiken für die Marktteilnehmer, deren Planungssicherheit bezüglich Erlöse und Absatzvolumina sinkt.
Von etablierten Warenmärkten sind Organisationsformen bekannt, die einen mit geringen Trans¬aktionskosten verbundenen, transparenten, schnellen und sicheren Handel ermöglichen. In den meisten Ländern mit liberalisiertem Elektrizitätsmarkt sind deshalb Strombörsen gegründet worden oder sind Strombörsen in Planung. In Deutschland sprach sich kürzlich die Projektgruppe „Deutsche Strom- und Energiebörse“ (gebildet auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums) für Frankfurt am Main als Sitz der künftigen Strombörse aus.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Risiken, die beim Handel mit elektrischer Energie an Strombörsen auftreten, zu beschreiben und darzustellen, wie diesen begegnet werden kann. Dabei werden die spezifischen Eigenschaften der Ware Elektrizität im Vergleich zu etablierten Warenmärkten geschildert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Begriffsdefinitionen
- 1.3.1 Risiko
- 1.3.2 Risikomanagement
- 2 Strombörsen
- 2.1 Die Entwicklung von Waren- und Warenterminbörsen
- 2.1.1 Warenbörsen
- 2.1.2 Warenterminbörsen
- 2.2 Die Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte in Europa
- 2.2.1 Strom als Ware
- 2.2.2 Strombörsen und wettbewerblicher Stromhandel
- 2.2.3 Marktteilnehmer des wettbewerblichen Stromhandels
- 2.2.3.1 Erzeuger
- 2.2.3.2 Händler
- 2.2.3.3 Broker
- 2.2.3.4 Kunden
- 2.2.4 Durchleitungsverfahren in Deutschland
- 2.3 Struktur des zukünftigen Strommarktes
- 2.3.1 OTC- bzw. Grundlastmarkt
- 2.3.2 Spotmarkt
- 2.3.3 Stromterminmarkt
- 2.3.4 Ausgleichsmarkt
- 2.4 Konsequenzen aus der Liberalisierung der Strommärkte
- 2.4.1 Konsequenzen aus der Liberalisierung ausländischer Strommärkte
- 2.4.1.1 Kalifornien
- 2.4.1.2 Norwegen, Schweden, Finnland
- 2.4.1.3 England und Wales
- 2.4.1.4 Niederlande
- 2.4.2 Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft in Deutschland
- 3 Risikomanagement an Warenbörsen
- 3.1 Risikoarten des Warenspot- und Warenterminhandels
- 3.1.1 Risiken der Marktform
- 3.1.1.1 Erfüllungsrisiko und Wiedereindeckungsrisiko
- 3.1.1.2 Liquiditätsrisiko aufgrund geringer Marktreife
- 3.1.2 Marktpreisrisiken
- 3.1.2.1 Zinsrisiko
- 3.1.2.2 Währungsrisiko
- 3.1.2.3 Warenpreisrisiko
- 3.1.3 Derivate Risiken
- 3.1.3.1 Basisrisiko
- 3.1.3.2 Informationsrisiko
- 3.1.3.3 Modellrisiko
- 3.1.3.4 Liquiditätsrisiko
- 3.1.4 Sonstige Risiken
- 3.1.4.1 Operative Risiken
- 3.1.4.2 Rechtliche, bilanzielle und steuerliche Risiken
- 3.2 Marktteilnehmer der Warenterminbörse
- 3.3 Risikomessung
- 3.3.1 Handelsportfolio
- 3.3.2 Sensitivitäten
- 3.3.3 Value-at-Risk
- 3.4 Instrumente des Risikomanagements
- 3.4.1 Futures
- 3.4.1.1 Hedging mit Futures
- 3.4.1.2 Bewertung von Futures
- 3.4.2 Optionen
- 3.4.2.1 Hedging mit Optionen
- 3.4.2.2 Bewertung von Optionen
- 3.4.3 Kombinierte Instrumente
- 4 Risikomanagement an Strombörsen
- 4.1 Risikoarten des Stromhandels
- 4.1.1 Risiken der Marktform
- 4.1.2 Marktpreisrisiko
- 4.1.2.1 Volumenrisiko
- 4.1.2.2 Wetterrisiko
- 4.1.2.3 Kundenrisiko
- 4.1.2.4 Brennstoffpreisrisiko
- 4.1.3 Derivate Risiken
- 4.1.3.1 Basisrisiko
- 4.1.3.2 Modellrisiko
- 4.1.3.3 Produktionsrisiko
- 4.1.4 Sonstige Risiken
- 4.1.4.1 Technisches Risiko
- 4.1.4.2 Durchleitungsrisiko
- 4.1.4.3 Investitionsrisiko
- 4.2 Marktteilnehmer an der Stromterminbörse
- 4.3 Risikomessung im Stromhandel
- 4.3.1 Portfolio im Stromhandel
- 4.3.2 Sensitivitäten
- 4.3.3 Value-at-Risk
- 4.3.4 Marginal-Energy-Price-Risk
- 4.4 Instrumente des Risikomanagements an der Strombörse
- 4.4.1 Strom-Futures
- 4.4.1.1 Hedging mit Strom-Futures
- 4.4.1.2 Bewertung von Strom-Futures
- 4.4.2 Optionen auf Strom-Futures
- 4.4.2.1 Hedging mit Optionen auf Strom-Futures
- 4.4.2.2 Bewertung von Optionen auf Strom-Futures
- 4.4.3 Kombinierte Instrumente im Stromhandel
- 4.6 Außerbörsliche Instrumente des Risikomanagements im Stromhandel
- 4.7 Anwendung von Risikomanagementinstrumenten im Stromhandel
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Risikomanagement im Handel elektrischer Energie an Strombörsen. Ziel ist es, die spezifischen Risiken dieses Marktes zu identifizieren und geeignete Risikomanagementinstrumente zu analysieren.
- Entwicklung und Struktur von Strombörsen
- Risikoarten im Stromhandel (Marktpreisrisiken, Derivaterisiken, etc.)
- Instrumente des Risikomanagements (Futures, Optionen)
- Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte
- Konsequenzen der Marktliberalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Problemstellung der Arbeit, die sich mit den aktuellen Fragen des Risikomanagements im Handel elektrischer Energie an Strombörsen auseinandersetzt. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und definiert zentrale Begriffe wie Risiko und Risikomanagement. Die Bedeutung einer klaren Definition dieser Begriffe für die spätere Analyse der Risiken im Stromhandel wird hervorgehoben.
2 Strombörsen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Waren- und Warenterminbörsen und deren Einfluss auf die Entstehung von Strombörsen. Es beschreibt die Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte in Europa, die Strom als Ware etablierte und zu einem wettbewerblichen Stromhandel führte. Der Fokus liegt auf den Marktteilnehmern (Erzeuger, Händler, Broker, Kunden), den verschiedenen Marktsegmenten (Spotmarkt, Terminmarkt, etc.) und den Konsequenzen der Liberalisierung, sowohl in Deutschland als auch im internationalen Kontext (Kalifornien, Norwegen, Schweden, Finnland, England und Wales, Niederlande). Die unterschiedlichen Strukturen und Entwicklungen der Märkte werden verglichen und analysiert.
3 Risikomanagement an Warenbörsen: Dieses Kapitel dient als Grundlage für die spätere Analyse des Risikomanagements im Stromhandel. Es werden verschiedene Risikoarten im Warenspot- und Warenterminhandel detailliert beschrieben, darunter Marktpreisrisiken, Derivaterisiken und sonstige Risiken (operative, rechtliche, bilanzielle und steuerliche Risiken). Die Kapitel erläutern die Methoden der Risikomessung (Handelsportfolio, Sensitivitäten, Value-at-Risk) und die gängigen Instrumente des Risikomanagements (Futures und Optionen) sowie deren Anwendung und Bewertung. Der Zusammenhang zwischen Risikoarten, Risikomessung und den eingesetzten Instrumenten wird präzise dargestellt.
4 Risikomanagement an Strombörsen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Risiken des Stromhandels, die sich von denen an traditionellen Warenbörsen durch die Besonderheiten des Stroms als Ware unterscheiden. Es werden Marktpreisrisiken (Volumenrisiko, Wetterrisiko, Kundenrisiko, Brennstoffpreisrisiko), Derivaterisiken, und sonstige Risiken (technische Risiken, Durchleitungsrisiken, Investitionsrisiken) analysiert. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel werden die Methoden der Risikomessung im Stromhandel (Portfolio, Sensitivitäten, Value-at-Risk, Marginal-Energy-Price-Risk) und die Instrumente des Risikomanagements (Strom-Futures, Optionen auf Strom-Futures, kombinierte Instrumente und außerbörsliche Instrumente) erläutert. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten des Strommarktes und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Risikomanagement.
Schlüsselwörter
Strombörsen, Risikomanagement, Liberalisierung, Elektrizitätsmarkt, Marktpreisrisiko, Derivate, Futures, Optionen, Hedging, Value-at-Risk, Marktteilnehmer, Stromhandel, Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Risikomanagement an Strombörsen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Risikomanagement im Handel elektrischer Energie an Strombörsen. Sie identifiziert die spezifischen Risiken dieses Marktes und analysiert geeignete Risikomanagementinstrumente.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Struktur von Strombörsen, verschiedene Risikoarten im Stromhandel (Marktpreisrisiken, Derivaterisiken etc.), Instrumente des Risikomanagements (Futures, Optionen), die Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung mit Problemstellung, Aufbau und Begriffsdefinitionen; ein Kapitel über Strombörsen mit deren Entwicklung, Liberalisierung und Marktstruktur; ein Kapitel zum Risikomanagement an Warenbörsen als Grundlage; ein Kapitel zum Risikomanagement an Strombörsen mit Fokus auf spezifische Risiken des Strommarktes; und abschließend ein Fazit.
Welche Risikoarten werden im Stromhandel behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Risikoarten, darunter Marktpreisrisiken (Volumenrisiko, Wetterrisiko, Kundenrisiko, Brennstoffpreisrisiko), Derivaterisiken, und sonstige Risiken (technische Risiken, Durchleitungsrisiken, Investitionsrisiken). Auch Risiken der Marktform und Erfüllungsrisiken werden berücksichtigt.
Welche Instrumente des Risikomanagements werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Futures, Optionen und kombinierte Instrumente sowie außerbörsliche Instrumente. Der Fokus liegt auf deren Anwendung und Bewertung im Kontext des Stromhandels, inklusive Hedging-Strategien.
Wie wird die Risikomessung im Stromhandel beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Methoden der Risikomessung wie die Analyse des Handelsportfolios, Sensitivitäten, Value-at-Risk und Marginal-Energy-Price-Risk.
Welche Rolle spielt die Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte?
Die Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte ist ein zentraler Aspekt der Arbeit. Sie wird im Kontext der Entstehung von Strombörsen und der daraus resultierenden Konsequenzen für den Stromhandel und das Risikomanagement analysiert. Der Vergleich mit ausländischen Märkten (Kalifornien, Norwegen, Schweden, Finnland, England und Wales, Niederlande) wird herangezogen.
Welche Marktteilnehmer werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Marktteilnehmer, darunter Erzeuger, Händler, Broker und Kunden, und analysiert deren Rolle im Stromhandel und im Kontext des Risikomanagements.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strombörsen, Risikomanagement, Liberalisierung, Elektrizitätsmarkt, Marktpreisrisiko, Derivate, Futures, Optionen, Hedging, Value-at-Risk, Marktteilnehmer, Stromhandel, Wettbewerb.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im Dokument bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und dessen Fokus.
- Arbeit zitieren
- Daniel Meißner (Autor:in), 1999, Der Handel elektrischer Energie an Strombörsen - Aktuelle Fragen des Risikomanagements, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185389