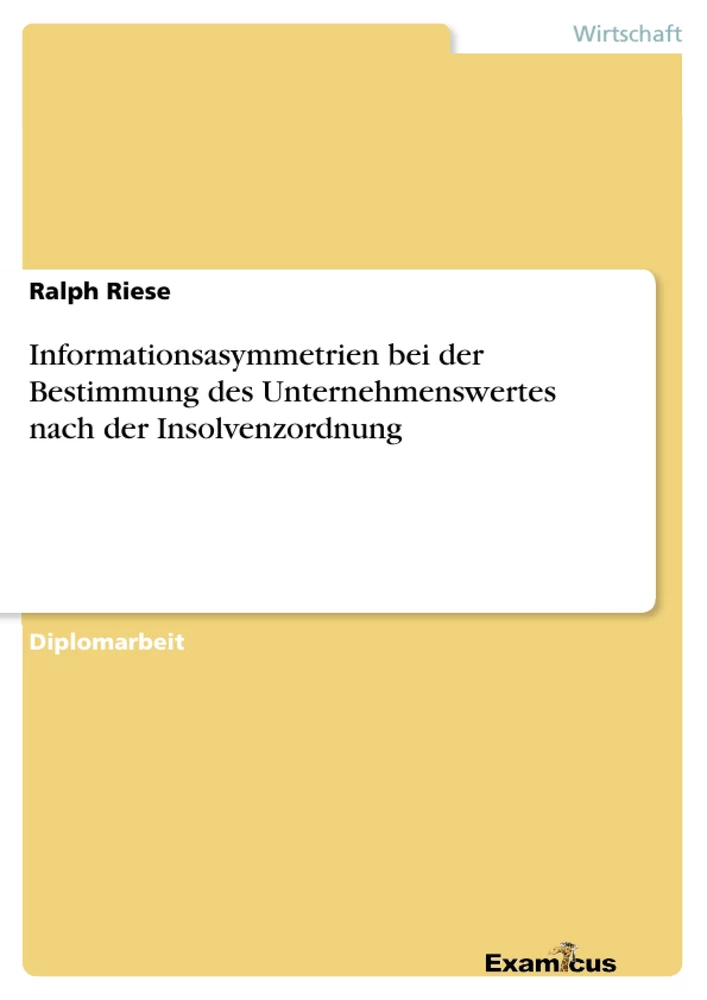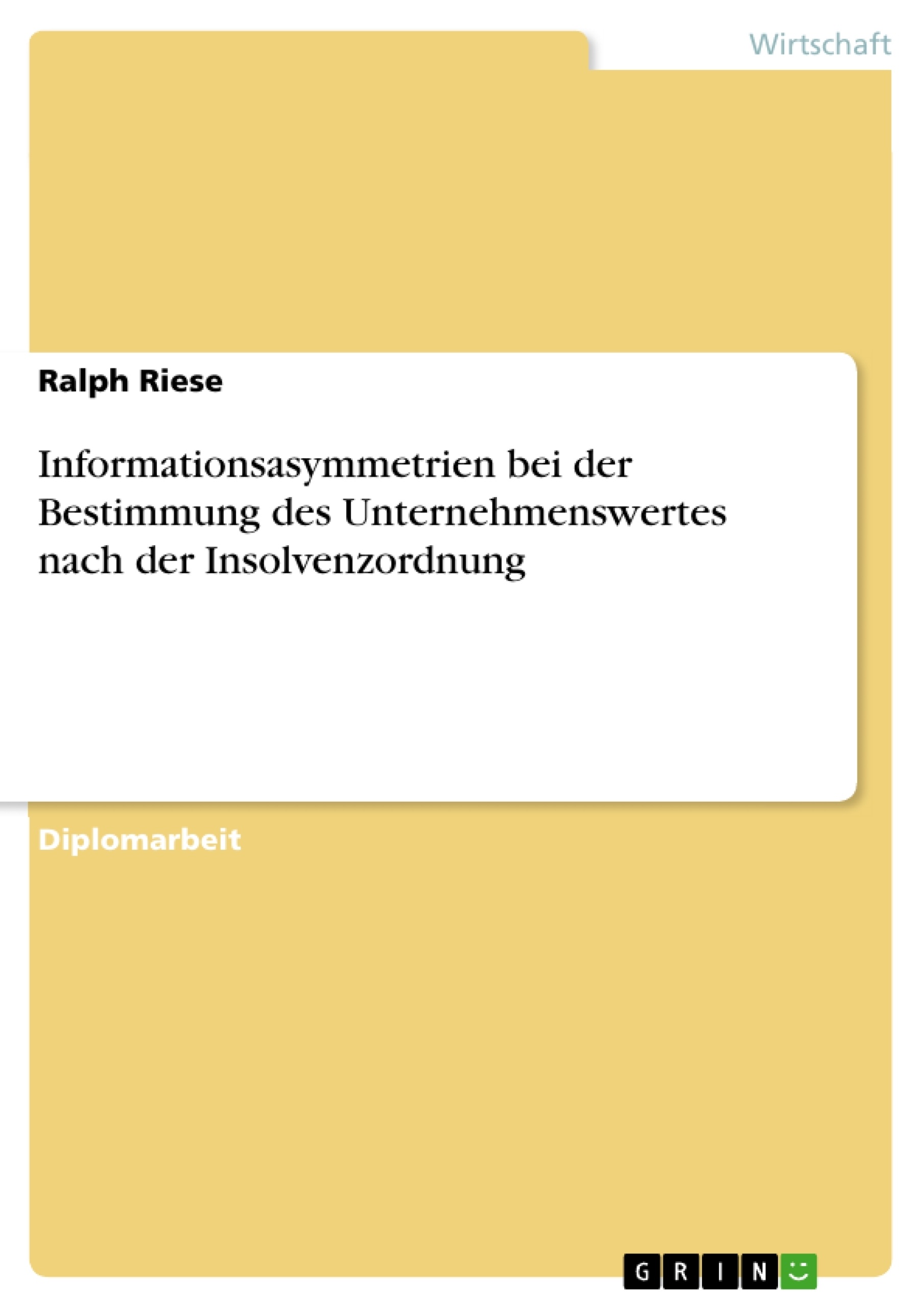Dem bis zum 31.12.1998 geltenden Insolvenzrecht wurde eine zu hohe Liquidationslastigkeit vorgeworfen. Es kam unter dem Schlagwort der sog. Zerschlagungsautomatik zu heftig geführten Diskussionen, bei denen der Vorwurf erhoben wurde, das Insolvenzrecht führe zu einer Verschleuderung von Vermögenswerten und zur häufig unnötigen Vernichtung von Arbeitsplätzen. Das zentrale Anliegen des Gesetzgebers für die nun am 01.01.1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung war es deshalb, die Verwirklichung anderer Alternativen im Vergleich zur Unternehmensliquidation zu ermöglichen. Nicht mehr die Liquidation sollte die dominierende Option sein, sondern alle Verwertungsmöglichkeiten sollen, wenn ökonomisch sinnvoll, eine Chance auf Realisation erhalten. Mit anderen Worten war es das Ziel, alle Verwertungsalternativen gleichberechtigt zur Disposition zu stellen. Damit sind die Ermittlung und die Auswahl von Verwertungsalternativen für insolvente Unternehmungen aber nichts anderes als ein klassisches Bewertungsproblem.
Bisher ist die Insolvenzproblematik eher von Juristen beherrscht worden, die die Notwendigkeit und den Zweck des Insolvenzrechtes im Wesentlichen darin gesehen haben, durch ein hoheitliches Verfahren den Marktaustritt von wirtschaftlich versagenden Unternehmen zu regeln. Im Mittelpunkt des Interesses standen hier die Fragen der Haftungsverwirklichung und der Verfahrensausgestaltung. Der Komplex der Haftungsausgestaltung umfasste die Fragen der Bestimmung von Vermögensfragen sowie die Klärung von Ansprüchen und deren Durchsetzung. Der Komplex der Verfahrensausgestaltung betraf die Rechte und Pflichten der an einem Insolvenzverfahren im weitesten Sinne Beteiligten (Schuldner, Gläubiger, Verwalter, Gericht).
Aufgrund mangelnder Sachkenntnis der mit der Insolvenz befassten Juristen wird nun im neuen Insolvenzrecht den betriebswirtschaftlichen Bewertungen des Unterneh-mens durch einen Insolvenzverwalter oder eine beauftragte externe Person eine erhebliche Bedeutung beigemessen. Die Aufgabe bei der Bewertung der Verwertungsalternativen für das fallierende Unternehmen ist es, die im Vergleich beste Alternative zu finden, die eine maximale Gläubigerbefriedigung ermöglicht. Dazu müssen die Werte ermittelt werden, die eine effiziente Entscheidung rechtfertigen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Arbeit
- GRUNDLAGEN
- Insolvenzrecht
- Überblick
- Insolvenzordnung
- § 1 InsO - Alternative Verwertungsmöglichkeiten
- Beteiligte am Insolvenzprozess
- Insolvenzplan
- Obstruktionsverbot
- Minderheitenschutz
- Informationsasymmetrien
- Allgemein
- Hidden Action
- Hidden Information
- Hidden Characteristics
- UNTERNEHMENSBEWERTUNG IM RAHMEN DER INSOLVENZ
- Strategien der Unternehmensfortführung
- Fortführung als Sanierung vs. Liquidation
- Sanierung
- Übertragende Sanierung
- Liquidation
- Unternehmenswerte unter Berücksichtigung der Insolvenzordnung
- Objektiver vs. subjektiver Unternehmenswert
- Fortführungswert
- Allgemein
- Going-Concern-Wert
- Liquidationswert (Zerschlagungswert)
- Allgemein
- Einzelliquidationswert
- Gesamtliquidationswert
- Kombination aus Fortführungs- und Teilliquidationswert
- Verfahren zur Bestimmung des Unternehmenswertes
- Ertragswertverfahren zur Bestimmung des Unternehmenswertes
- Allgemein
- Problem - Unsicherheit
- Zukunftsbezogene Werte
- Problem - Zinssatz
- Schlussfolgerung
- Liquidationswertverfahren zur Bestimmung des Unternehmenswertes
- Allgemein
- Probleme
- Schlussfolgerung
- INTERESSENKONFLIKTE UND DEREN HARMONISIERUNG
- Interessenkonflikte und Informationsasymmetrien der einzelnen Beteiligten am Insolvenzverfahren
- Schuldner
- Gläubiger
- Gesicherte Gläubiger
- Ungesicherte Gläubiger
- Arbeitnehmer
- Gericht und Insolvenzverwalter
- Lösungsversuche zur Konfliktbeseitigung
- Signalling - Zeichen des Besserinformierten
- Signale durch den Schuldner
- Signale durch den gesicherten Gläubiger
- Schlussfolgerung
- Screening - Kontrolle durch den Schlechterinformierten
- Kontrolle durch das Gericht
- Kontrolle durch den Insolvenzverwalter
- Kontrolle durch die ungesicherten Gläubiger
- Schlussfolgerung
- Agency-Theorie
- Anreizsysteme für den Schuldner
- Anreizsystem für den gesicherten Gläubiger
- Schlussfolgerung
- Self-Selection
- Haftung bei Fehlentscheidungen
- Manager bzw. Geschäftsführer
- Insolvenzverwalter
- Gericht
- Schlussfolgerung
- ALTERNATIVE MÖGLICHKEITEN ZUR UNTERNEHMENSWERTBESTIMMUNG
- Überblick
- Modell von Bebchuk
- Darstellung
- Berücksichtigung von Informationsasymmetrien
- Kritische Würdigung
- Modell von Aghion, Hart und Moore
- Darstellung
- Berücksichtigung von Informationsasymmetrien
- Kritische Würdigung
- Kritische Würdigung der alternativen Modelle
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- ANHANG
- LITERATURVERZEICHNIS
- RECHTSQUELLENVERZEICHNIS
- SONSTIGE QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Problematik von Informationsasymmetrien bei der Bestimmung des Unternehmenswertes im Rahmen der Insolvenzordnung. Ziel ist es, die Auswirkungen von Informationsasymmetrien auf den Insolvenzprozess und die Unternehmensbewertung zu analysieren und Lösungsansätze zur Harmonisierung der Interessen der beteiligten Akteure aufzuzeigen.
- Informationsasymmetrien im Insolvenzprozess
- Unternehmensbewertung unter Berücksichtigung der Insolvenzordnung
- Interessenkonflikte der Beteiligten am Insolvenzverfahren
- Lösungsansätze zur Konfliktbeseitigung
- Alternative Modelle zur Unternehmenswertbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Informationsasymmetrien bei der Unternehmensbewertung im Insolvenzverfahren ein und erläutert die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die rechtlichen Grundlagen des Insolvenzrechts und die verschiedenen Arten von Informationsasymmetrien. Kapitel 3 befasst sich mit der Unternehmensbewertung im Rahmen der Insolvenz, wobei die verschiedenen Bewertungsmethoden und die Bedeutung des Fortführungs- und Liquidationswertes im Detail beleuchtet werden. Kapitel 4 analysiert die Interessenkonflikte der beteiligten Akteure im Insolvenzverfahren und untersucht verschiedene Lösungsansätze zur Konfliktbeseitigung, wie Signalling, Screening, Agency-Theorie und Self-Selection. Kapitel 5 stellt alternative Modelle zur Unternehmenswertbestimmung vor und diskutiert deren Vor- und Nachteile. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Informationsasymmetrien, Unternehmensbewertung, Insolvenzordnung, Insolvenzverfahren, Interessenkonflikte, Signalling, Screening, Agency-Theorie, Self-Selection, alternative Modelle, Fortführungswert, Liquidationswert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der neuen Insolvenzordnung von 1999?
Ziel ist es, Alternativen zur Liquidation (Zerschlagung) zu fördern und die Sanierung von Unternehmen gleichberechtigt zu ermöglichen.
Welche Rolle spielen Informationsasymmetrien im Insolvenzverfahren?
Sie führen zu Interessenkonflikten, da Schuldner, Gläubiger und Verwalter unterschiedliche Wissensstände über den wahren Wert des Unternehmens haben.
Was unterscheidet Fortführungswert und Liquidationswert?
Der Fortführungswert betrachtet den Wert bei laufendem Betrieb (Going-Concern), während der Liquidationswert den Erlös bei Einzelveräußerung der Vermögensgegenstände schätzt.
Wie können Interessenkonflikte durch Signalling gelöst werden?
Durch Signalling gibt der besser informierte Teil (z. B. der Schuldner) Informationen preis, um Vertrauen bei den Gläubigern zu schaffen.
Was besagt die Agency-Theorie im Insolvenzkontext?
Sie analysiert die Beziehung zwischen Prinzipal (Gläubiger) und Agent (Verwalter/Schuldner) und sucht nach Anreizsystemen zur optimalen Gläubigerbefriedigung.
- Arbeit zitieren
- Ralph Riese (Autor:in), 1999, Informationsasymmetrien bei der Bestimmung des Unternehmenswertes nach der Insolvenzordnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185392