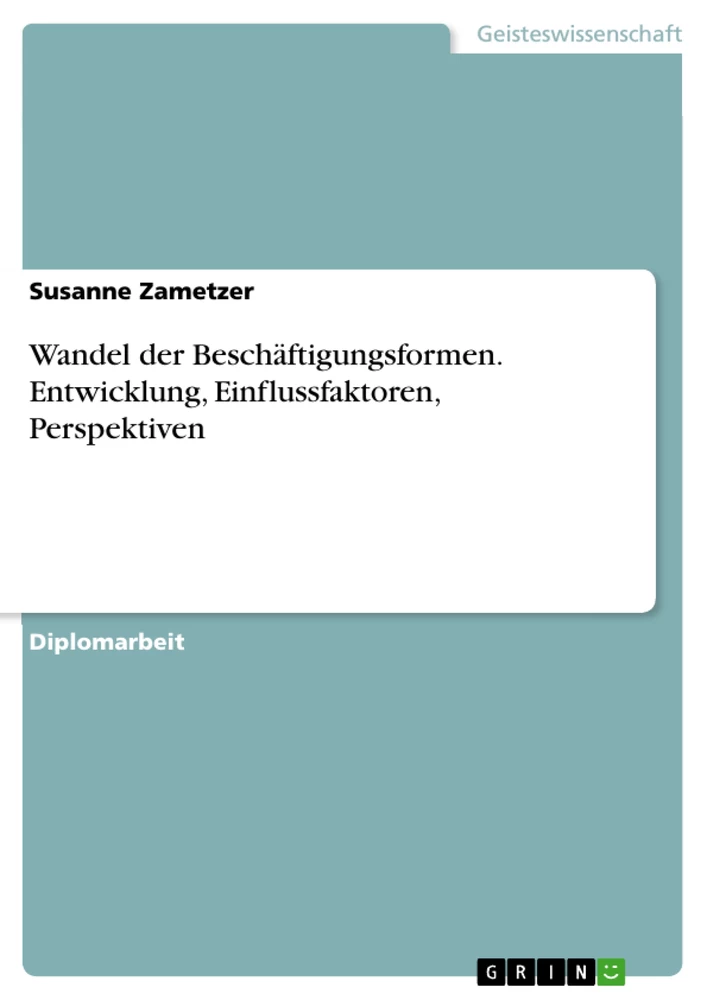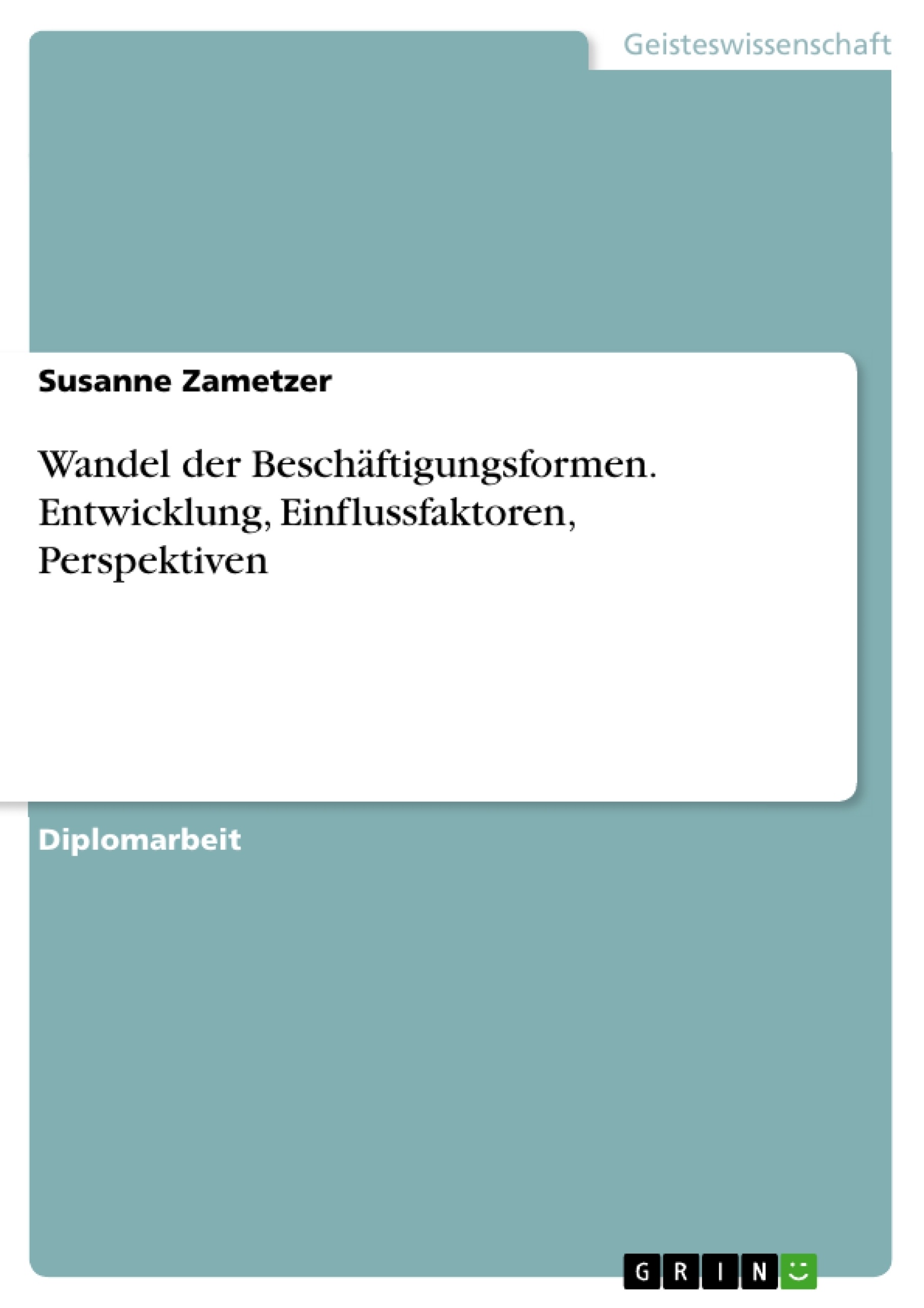Diese Arbeit erläutert die Möglichkeiten und Motive der internen und externen betrieblichen Beschäftigungsflexibilisierung. Als Beispiele für externe flexible Beschäftigungsformen werden exemplarisch die Arbeitnehmerüberlassung und das Subunternehmer-Vertragsverhältnis durch Werk- und Dienstvertrag vorgestellt.
Anschließend wird anhand einer Studie des Nürnberger Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, sowie der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen die Entwicklung der Beschäftigungsformen aufgezeigt.
Im Kernbereich dieser Arbeit wird die Fragestellung behandelt, welche Bestimmungs- und Einflußfaktoren die Wahl einer Beschäftigungsform aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht beeinflussen. Neben den Handlungsvorgaben durch den Gesetzgeber, werden weitere exogene Faktoren wie der Strukturwandel und die Entwicklung und Lage am Arbeitsmarkt betrachtet. Als Bestimmungsfaktoren für die Präferenzen der Arbeitsmarktakteure werden die Höhe der Lohnstück- bzw. Arbeits- und Transferkosten, der Wertewandel, die wachsende Erwerbstätigkeit von Frauen und die zunehmende Vereinbarung flexibler Arbeitszeitmodelle sowie die betrieblichen Outsourcingtendenzen vorgestellt.
Aufgrund der Thematik dieser Arbeit wurde dem Kapitel Betriebliche Outsourcingtendenzen nähere Aufmerksamkeit geschenkt: Neben der Begriffserläuterung werden die Ziele der Fremdvergabe angesprochen sowie die Formen des Outsourcing vorgestellt. Die Outsourcing-Strategie, Vorgehensweise und Aspekte der Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner werden beschrieben. Die Auflistung von Vor- und Nachteilen verdeutlicht die Chancen und Risiken, die sich beim Outsourcing von Unternehmensfunktionen ergeben. Die Kapitel Insourcing- und Inplacement, sowie das Konzept der Kernkompetenzen runden das Outsourcingprofil ab.
Das letzte Kapitel ist der zukünftigen Arbeitswelt gewidmet. Zu Beginn werden die neuen Beschäftigungsformen in Virtuellen Kooperationen vorgestellt. Hierbei handelt es sich um das Konzept des Teleworking, eine Zwischenstufe zur zwischenbetrieblichen Kooperation durch Virtualisierung - dem Virtuellen Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsgrundlagen und Entwicklung der Beschäftigungsformen
- Empirische Daten zum Wandel der Beschäftigungsformen
- Einflußfaktoren auf die Wahl einer Beschäftigungsform
- Perspektiven der Beschäftigungsformen
- Aussagen zur Entwicklungen der Beschäftigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Beschäftigungsformen und die damit verbundenen Einflussfaktoren. Sie beleuchtet die Entwicklung verschiedener Beschäftigungsmodelle, analysiert empirische Daten und skizziert zukünftige Perspektiven.
- Entwicklung verschiedener Beschäftigungsformen
- Einflussfaktoren auf die Wahl der Beschäftigungsform
- Analyse empirischer Daten zum Beschäftigungswandel
- Zukünftige Perspektiven der Beschäftigungsformen
- Auswirkungen auf die Personalarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Motivation und die Zielsetzung der Arbeit sowie den Aufbau und den Ablauf der Untersuchung. Sie skizziert die Problemstellung und die Relevanz des Themas im Kontext des Wandels der Arbeitswelt.
Begriffsgrundlagen und Entwicklung der Beschäftigungsformen: Dieses Kapitel legt die konzeptionellen Grundlagen der Arbeit fest. Es definiert "Normalarbeit" und abweichende Beschäftigungsformen, analysiert die betriebliche Beschäftigungsflexibilisierung und deren verschiedene Formen. Es werden Aspekte der flexiblen Beschäftigung im Vergleich zur Normalarbeit beleuchtet und Beispiele für externe flexible Beschäftigungsformen, wie Zeitarbeit und Subunternehmerverträge, detailliert dargestellt. Die Bedeutung von Begrifflichkeiten und deren historische Entwicklung werden kritisch untersucht.
Empirische Daten zum Wandel der Beschäftigungsformen: Dieses Kapitel präsentiert empirische Daten aus verschiedenen Studien, um den Wandel der Beschäftigungsformen zu belegen. Es werden die Ergebnisse von Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) und der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen ausgewertet und verglichen. Die Kapitel analysiert die Veränderungen in den Erwerbsformen und beleuchtet die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in verschiedenen Sektoren und Beschäftigungsverhältnissen. Die Daten dienen als Grundlage für die anschließende Analyse der Einflussfaktoren.
Einflußfaktoren auf die Wahl einer Beschäftigungsform: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die die Wahl einer bestimmten Beschäftigungsform beeinflussen. Es analysiert das Arbeitsmarktgeschehen nach verschiedenen Modellen (Bartelheimer, Walwe) und beleuchtet die Bedeutung von Strukturwandel, Lohnstückkosten, Arbeits- und Transfereinkommen sowie den Wertewandel. Der Einfluss der wachsenden Erwerbsorientierung von Frauen und der zunehmenden Vereinbarung flexibler Arbeitszeitmodelle wird ebenso untersucht wie Outsourcing-Tendenzen der Unternehmen.
Perspektiven der Beschäftigungsformen: In diesem Kapitel werden zukünftige Entwicklungen der Beschäftigungsformen prognostiziert. Es werden neue Beschäftigungsformen in virtuellen Kooperationen, Teleworking und virtuelle Unternehmen beleuchtet und die Anforderungen an das Personal in diesen neuen Arbeitsumgebungen analysiert. Ein Fallbeispiel illustriert die praktischen Herausforderungen und Chancen dieser Entwicklungen.
Aussagen zur Entwicklungen der Beschäftigung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel zusammen und zieht allgemeine Schlussfolgerungen über die zukünftige Entwicklung der Beschäftigung. Es werden die fünf Megatrends des Wandels der Arbeitswelt diskutiert und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiterstruktur und die Beschäftigungsformen der Zukunft analysiert. Die Implikationen für die Personalarbeit werden abschließend betrachtet.
Schlüsselwörter
Beschäftigungsformen, Flexibilisierung, Normalarbeit, Zeitarbeit, Subunternehmerverträge, Arbeitsmarkt, Strukturwandel, Wertewandel, Outsourcing, Virtuelle Unternehmen, Telearbeit, Personalarbeit, Zukunftsperspektiven.
FAQs: Wandel der Beschäftigungsformen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Wandel der Beschäftigungsformen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung verschiedener Beschäftigungsmodelle, der Einflussfaktoren auf deren Wahl und der Zukunftsperspektiven.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entwicklung verschiedener Beschäftigungsformen (z.B. Normalarbeit im Vergleich zu flexiblen Beschäftigungsformen wie Zeitarbeit und Subunternehmerverträge), die Einflussfaktoren auf die Wahl einer Beschäftigungsform (z.B. Strukturwandel, Lohnstückkosten, Wertewandel, Outsourcing), die Analyse empirischer Daten zum Beschäftigungswandel, zukünftige Perspektiven der Beschäftigungsformen (z.B. Telearbeit, virtuelle Unternehmen) und die Auswirkungen auf die Personalarbeit. Es werden auch die fünf Megatrends des Wandels der Arbeitswelt diskutiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsgrundlagen und Entwicklung der Beschäftigungsformen, Empirische Daten zum Wandel der Beschäftigungsformen, Einflussfaktoren auf die Wahl einer Beschäftigungsform, Perspektiven der Beschäftigungsformen und Aussagen zur Entwicklung der Beschäftigung.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Das Dokument verwendet empirische Daten aus verschiedenen Studien, darunter Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) und der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen. Diese Daten werden ausgewertet und verglichen, um den Wandel der Beschäftigungsformen zu belegen und die Veränderungen in den Erwerbsformen und Beschäftigtenzahlen in verschiedenen Sektoren und Beschäftigungsverhältnissen aufzuzeigen.
Welche Einflussfaktoren auf die Wahl der Beschäftigungsform werden analysiert?
Das Dokument analysiert verschiedene Einflussfaktoren, darunter Strukturwandel, Lohnstückkosten, Arbeits- und Transfereinkommen, Wertewandel, die wachsende Erwerbsorientierung von Frauen, die zunehmende Vereinbarung flexibler Arbeitszeitmodelle und Outsourcing-Tendenzen der Unternehmen. Es werden dabei auch verschiedene Modelle (Bartelheimer, Walwe) betrachtet.
Welche Zukunftsperspektiven werden aufgezeigt?
Das Dokument prognostiziert zukünftige Entwicklungen der Beschäftigungsformen, beleuchtet neue Beschäftigungsformen in virtuellen Kooperationen, Teleworking und virtuellen Unternehmen und analysiert die Anforderungen an das Personal in diesen neuen Arbeitsumgebungen. Ein Fallbeispiel illustriert die praktischen Herausforderungen und Chancen dieser Entwicklungen. Die fünf Megatrends des Wandels der Arbeitswelt und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiterstruktur und die Beschäftigungsformen der Zukunft werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Beschäftigungsformen, Flexibilisierung, Normalarbeit, Zeitarbeit, Subunternehmerverträge, Arbeitsmarkt, Strukturwandel, Wertewandel, Outsourcing, Virtuelle Unternehmen, Telearbeit, Personalarbeit, Zukunftsperspektiven.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Wissenschaftler, Studenten, Personalmanager und alle, die sich mit dem Wandel der Arbeitswelt und den damit verbundenen Veränderungen der Beschäftigungsformen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Susanne Zametzer (Author), 1999, Wandel der Beschäftigungsformen. Entwicklung, Einflussfaktoren, Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185455