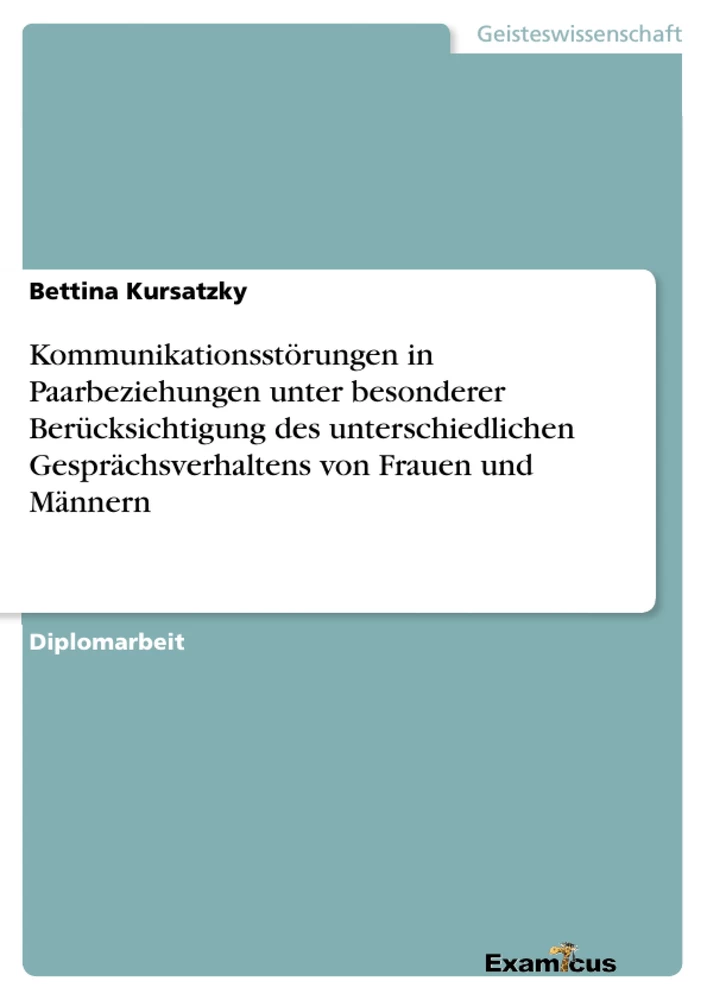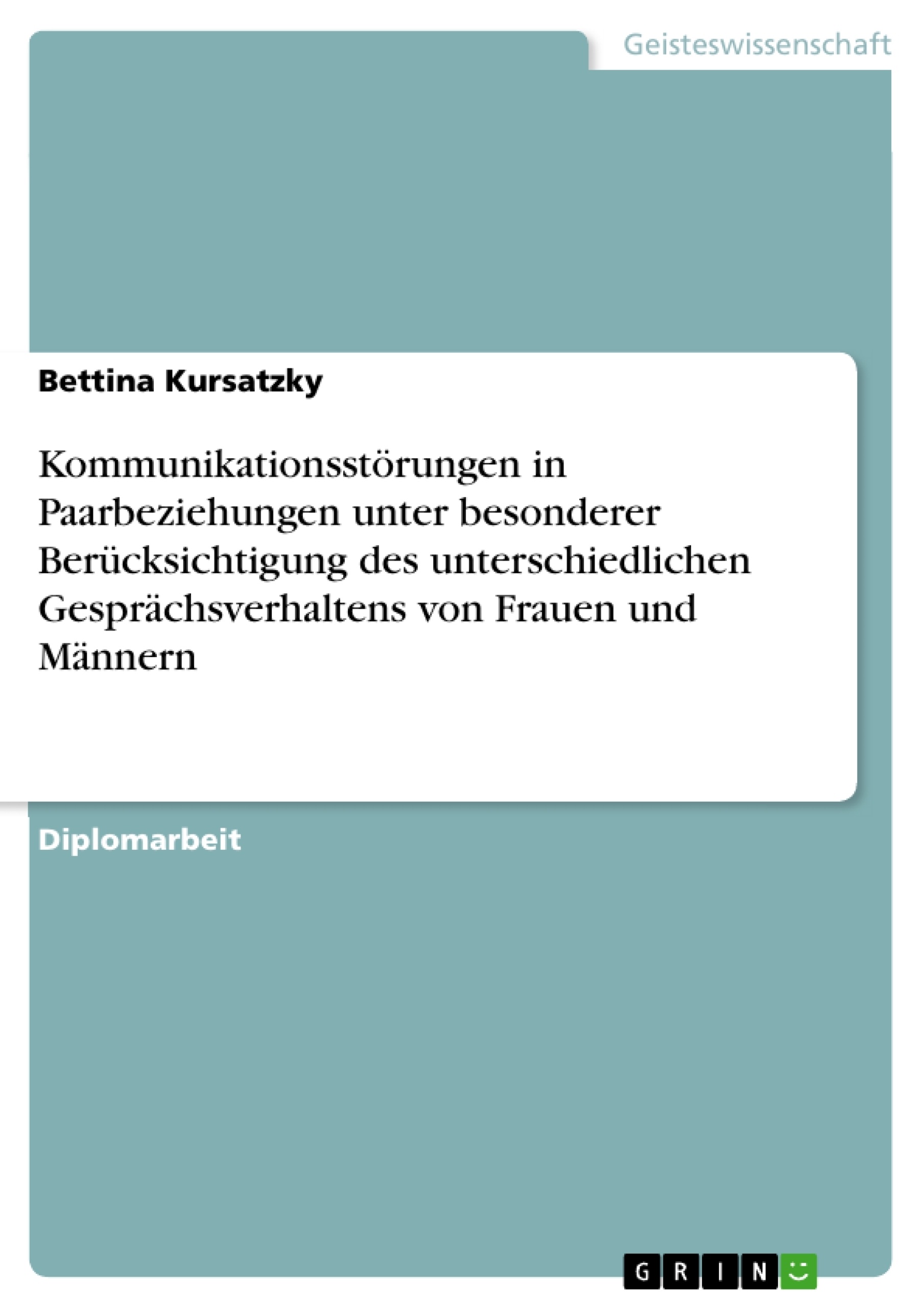Inhalt dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit den Verständnis-schwierigkeiten zwischen Frauen und Männern. Frauen und Männer fassen dieselbe Unterhaltung häufig ganz anders auf und reagieren unterschiedlich darauf, auch wenn es auf den ersten Blick betrachtet gar nicht zu Missverständnissen gekommen ist.
Es existieren zahlreiche Untersuchungen und Theorien, die den Geschlechtsunterschied und das Verhalten, das Frauen und Männern zugeschrieben wird, zu erklären versuchen.
Es geht mir in meiner Arbeit nicht darum, den einen oder anderen Kommunikationsstil zu pauschalisieren. Die unterschiedlichen weiblichen und männlichen Charaktere - u.a. bedingt durch unterschiedliche Erfahrungen - wirken sich auf das gesamte Verhalten eines Menschen positiv oder negativ aus. Nach Hagemann-White ist die Variation innerhalb eines Geschlechts in der Regel größer als die Differenz zwischen den Geschlechtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff „Kommunikation“
- Kommunikation verstehen
- Kommunikationstheorie nach Schulz von Thun
- Gesprächshemmer
- Tonfall
- Geschwindigkeit
- Schweigen
- Unterbrechen
- Lautstärke
- Körpersprache
- Weibliche und männliche Sozialisation und die Auswirkungen
- Zur Erforschung von Geschlechtsunterschieden
- Differenz-Theorie
- Kern-Geschlechtsidentität
- Gesellschaftliche Strukturen und traditionelles Verhalten
- Komponenten der Geschlechtsidentität
- Geschlechtspartner Orientierung
- Sozialisation und unterschiedliche Verhaltensweisen von Mädchen / Frauen und Jungen/ Männer
- Weibliche und männliche Sozialisation in bezug auf Sprache
- Der theoretische Zusammenhang von Sozialisation und Sprache
- Sozialisation und Sprachverhalten von Mädchen und Jungen
- Merkmale des Sprachstils von Frauen und Männern
- Geschlechtsspezifische Vorurteile bezüglich des weiblichen Kommunikationsstil
- Macht und Kontrolle in Gesprächen
- Macht und Kontrolle bei nichtverbaler Kommunikation
- Macht und Kontrolle bei verbaler Kommunikation
- Interaktionsarbeit in Paarbeziehungen – Eine Untersuchung von Fishman
- Konflikte in Paarbeziehungen
- Ursprung und Vermeidung von Konflikten nach Schulz von Thun
- Interpunktion
- Reaktionen zum Schutz des Selbstwertgefühls nach Satir
- Strategien zum Schutz vor Verletzungen nach Gray
- Streitpositionen nach Pieritz/ Spahn
- Ursprung und Vermeidung von Konflikten nach Schulz von Thun
- Wege zur Konfliktlösung zwischen Frauen und Männern
- Verständnis
- Der Eigenanteil
- Effektive Fragestellungen
- Verhaltensregeln nach Gordon
- Aktives Zuhören
- Formen des Feed-back
- Unterschiedliche Botschaften
- Offene Appelle und die Schwierigkeit, sie anzuwenden nach Schulz von Thun
- Flexibilität
- Sozialpädagogische Relevanz
- Benutzte Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Frauen und Männern, insbesondere in Paarbeziehungen. Sie untersucht die Ursachen für Missverständnisse und zeigt Möglichkeiten auf, das Verständnis zwischen den Geschlechtern zu verbessern.
- Untersuchung der unterschiedlichen Kommunikationsstile von Frauen und Männern
- Analyse der Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Sozialisation auf das Sprachverhalten
- Bedeutung von Macht und Kontrolle in Gesprächen zwischen Frauen und Männern
- Erforschung von Konfliktursachen und -lösungsstrategien in Paarbeziehungen
- Hervorhebung der sozialpädagogischen Relevanz des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Frauen und Männern ein und stellt die Relevanz des Themas für Paarbeziehungen heraus. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Frauen und Männern auf Kommunikation und die Rolle von Vorurteilen in der Wahrnehmung des jeweils anderen Geschlechts.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff „Kommunikation“ und erläutert die Kommunikationstheorie nach Schulz von Thun. Es werden verschiedene Gesprächshemmer wie Tonfall, Geschwindigkeit, Schweigen, Unterbrechen, Lautstärke und Körpersprache analysiert.
Kapitel 3 untersucht die weibliche und männliche Sozialisation und ihre Auswirkungen auf das Verhalten von Frauen und Männern. Es werden verschiedene Theorien zur Erforschung von Geschlechtsunterschieden vorgestellt, darunter die Differenz-Theorie und die Kern-Geschlechtsidentität. Außerdem werden die gesellschaftlichen Strukturen und das traditionelle Verhalten von Frauen und Männern in Bezug auf Geschlechtsrollen und Geschlechtspartnerorientierung beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der weiblichen und männlichen Sozialisation in Bezug auf Sprache. Es wird der theoretische Zusammenhang zwischen Sozialisation und Sprache erörtert und das Sprachverhalten von Mädchen und Jungen im Kontext der Sozialisation analysiert. Das Kapitel beleuchtet die Merkmale des Sprachstils von Frauen und Männern und untersucht die geschlechtsspezifischen Vorurteile bezüglich des weiblichen Kommunikationsstils. Außerdem werden die Themen Macht und Kontrolle in Gesprächen zwischen Frauen und Männern behandelt, sowohl in Bezug auf verbale als auch nonverbale Kommunikation. Abschließend wird die Interaktionsarbeit in Paarbeziehungen anhand einer Untersuchung von Fishman analysiert.
Kapitel 5 befasst sich mit Konflikten in Paarbeziehungen. Es werden die Ursachen und Vermeidung von Konflikten nach Schulz von Thun erläutert, wobei der Fokus auf der Interpunktion von Konflikten liegt. Außerdem werden die Reaktionen zum Schutz des Selbstwertgefühls nach Satir und die Strategien zum Schutz vor Verletzungen nach Gray vorgestellt. Abschließend werden die Streitpositionen nach Pieritz/ Spahn analysiert.
Kapitel 6 stellt verschiedene Wege zur Konfliktlösung zwischen Frauen und Männern vor. Es werden die Bedeutung von Verständnis, Eigenanteil und effektiven Fragestellungen für die Konfliktlösung hervorgehoben. Außerdem werden die Verhaltensregeln nach Gordon, wie aktives Zuhören, Formen des Feedbacks und unterschiedliche Botschaften, erläutert. Das Kapitel behandelt auch die offenen Appelle nach Schulz von Thun und die Schwierigkeit, sie anzuwenden. Abschließend wird die Bedeutung von Flexibilität für die Konfliktlösung betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kommunikation, Geschlechterrollen, Sozialisation, Sprachverhalten, Konflikte, Paarbeziehungen, Verständnis, Konfliktlösung, Aktives Zuhören, Feedback, Geschlechtsunterschiede, Vorurteile, Macht und Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Warum kommunizieren Männer und Frauen oft unterschiedlich?
Die Arbeit führt dies auf unterschiedliche Sozialisationsprozesse in der Kindheit zurück, die zu geschlechtsspezifischen Sprachstilen führen.
Was sind typische „Gesprächshemmer“ in Paarbeziehungen?
Dazu gehören ein aggressiver Tonfall, Schweigen, häufiges Unterbrechen oder eine abwehrende Körpersprache.
Wie hilft das Modell von Schulz von Thun bei Paarkonflikten?
Es hilft zu verstehen, dass jede Nachricht vier Ebenen hat (Sachebene, Selbstkundgabe, Beziehungsebene, Appell) und Missverständnisse oft auf unterschiedlichen Ebenen entstehen.
Welche Rolle spielt „Macht und Kontrolle“ im Gespräch?
Die Arbeit untersucht, wie durch Redeanteile oder nonverbale Signale unbewusst Machtverhältnisse in der Beziehung ausgehandelt werden.
Was versteht man unter „Aktivem Zuhören“?
Es ist eine Technik nach Gordon, bei der man dem Partner durch Empathie und Spiegeln des Gehörten signalisiert, dass man ihn wirklich versteht.
- Quote paper
- Bettina Kursatzky (Author), 2000, Kommunikationsstörungen in Paarbeziehungen unter besonderer Berücksichtigung des unterschiedlichen Gesprächsverhaltens von Frauen und Männern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185597