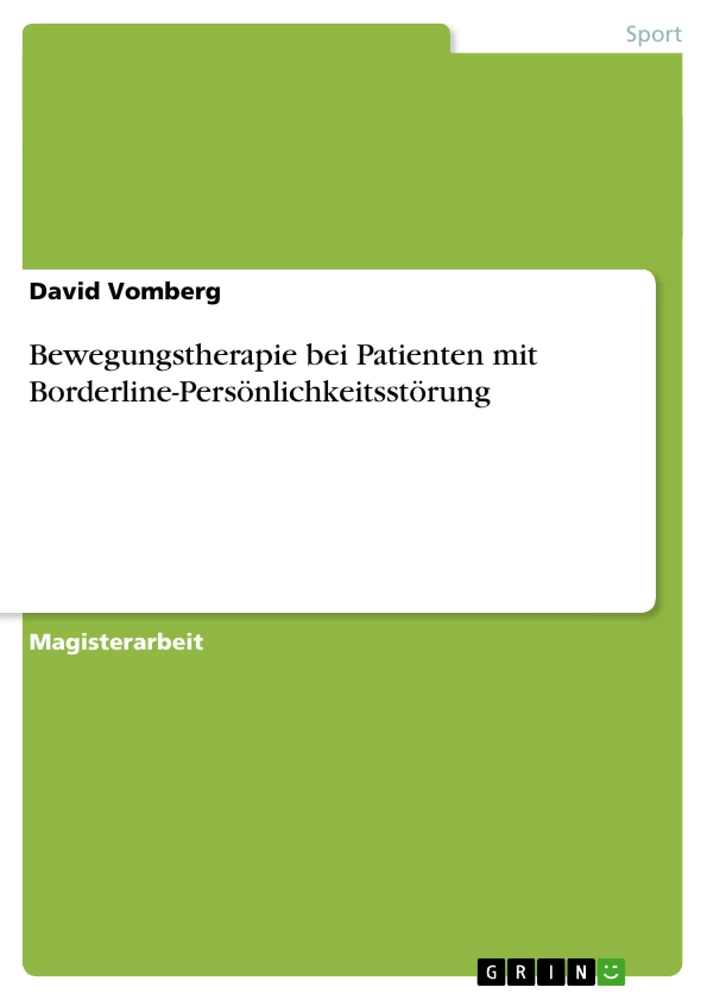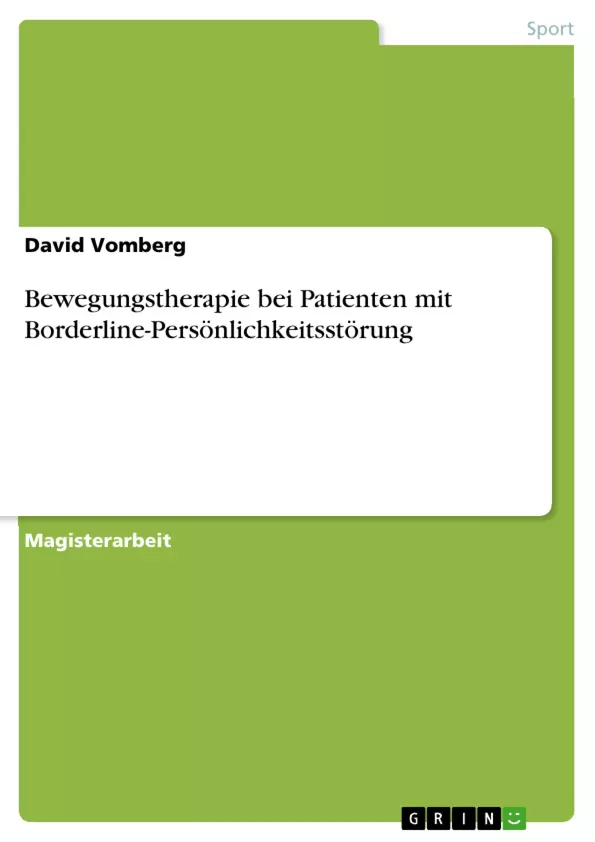Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) bilden nach denen mit Suchtproblemen und Depressionen die drittgrößte Gruppe innerhalb der psychischen Erkrankungen (GNEIST, 1999, S. 11).
Ausgehend von mehr als 14.000 Patienten in der Bundesrepublik ist es überraschend, dass die meisten Publikationen, die sich mit dem Thema BPS beschäftigen, aus den letzten Jahren sind. Insbesondere zum Themenbereich der Bewegungs- oder Sporttherapie lassen sich keine Publikationen finden. Als einzige Schrift zu diesem Thema kann eine Diplomarbeit der DSHS Köln aus dem Jahre 2000 angeführt werden, welche jedoch von rein theoretischer Art ist und auf keiner empirischen Untersuchung basiert. Aufgrund dieser Ausgangssituation kann die Vermutung aufgestellt werden, dass bewegungs- oder sporttherapeutische Konzepte für BPS-Patienten weitgehend unbekannt und daher im klinischen Alltag nicht üblich sind.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich primär mit zwei Hauptbereichen: der Erhebung der aktuellen Situation der stationären Versorgung und der Vorstellung eines bewegungstherapeutischen Konzepts.
Das Konzept soll als Anregung verstanden werden und wird den Kliniken, die sich während der Befragung interessiert geäußert hatten, zur Verfügung gestellt werden. Da das Konzept vom Autor selber nicht in der Praxis durchgeführt wurde, wird die praktische Umsetzung durch die Therapeuten der entsprechenden Kliniken erfolgen. Interessant wäre eine erneute Befragung der Therapeuten nach etwa einem halben Jahr, wenn Erfahrungen mit dem Konzept gesammelt wurden, um so herauszufinden, welche Teile eventuell modifiziert werden müssten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Die Borderline-Persönlichkeitsstörung im DSM IV
- Die Systematik des DSM
- Die Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung im DSM IV
- Die emotional-instabile Persönlichkeit im ICD-10
- Die Systematik des ICD
- Die Kriterien der emotional-instabilen Persönlichkeit im ICD-10
- Verlauf, Differentialdiagnostik und Epidemiologie
- Verlauf
- Differentialdiagnostik
- Epidemiologie
- Erklärungsansätze der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Tiefenpsychologischer Ansatz
- Symbiotische Phase
- Phasen der Loslösung und Individuation
- Borderline-typische Abwehrmechanismen
- Dialektisch-behavioraler Ansatz
- Humanistischer Ansatz
- Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell
- Die dialektisch-behaviorale Therapie
- Überblick über das Behandlungskonzept der DBT
- Die Therapiestruktur der DBT
- Behandlungsstrategien
- Basisstrategien
- Spezifische Strategien
- Die Sporttherapie
- Begriffsbestimmung der Sporttherapie
- Ziele der Sporttherapie
- Methoden der Sporttherapie
- Erhebung zur Sporttherapie für Borderline-Patienten
- Vorstellung des Fragebogens
- Fragebogen
- Erläuterung der Fragen
- Darstellung der Untersuchungsgruppe
- Darstellung und Auswertung der Ergebnisse
- Fazit
- Formulierung der Therapieziele
- Bewegungs- und sporttherapeutische Ziele
- Differentielle Ziele und Themen in den Therapiephasen
- Vermittlung der Therapieziele
- Methoden und Techniken
- Inhalte und Methoden
- Funktionelle Gymnastik
- Spielformen
- Gymnastik/Tanz
- Tanz/Improvisation/Bewegungstheater
- Naturerlebnis – Wandern - Orientierung
- Achtsamkeit
- Atemübungen
- Entspannung
- Vorstellung des Konzeptes
- Aspekte der Therapiegestaltung
- Gruppenzusammensetzung
- Gruppengröße
- Zeitliche Dauer/Häufigkeit
- Räumlichkeit
- Inhalte
- Rituale
- Struktur der Therapieeinheiten
- Der Therapeut
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die aktuelle Situation der stationären Bewegungstherapie bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und präsentiert ein neuartiges bewegungstherapeutisches Konzept. Die Arbeit zielt darauf ab, die Lücke in der Forschung zu diesem Thema zu schließen und praktische Handlungsempfehlungen für die klinische Praxis zu liefern.
- Aktuelle Situation der stationären Versorgung von Borderline-Patienten im Hinblick auf Bewegungstherapie
- Entwicklung eines evidenzbasierten bewegungstherapeutischen Konzepts für Borderline-Patienten
- Beschreibung und Analyse verschiedener Erklärungsansätze der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Integration der dialektisch-behavioralen Therapie (DBT) in das bewegungstherapeutische Konzept
- Formulierung konkreter Therapieziele und -methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsstand zur Bewegungstherapie bei Borderline-Patienten und hebt die Lücke in der bisherigen Forschung hervor. Sie stellt die Hauptziele der Arbeit vor: die Erhebung der aktuellen Situation der stationären Versorgung und die Entwicklung eines bewegungstherapeutischen Konzepts. Die Arbeit betont die Bedeutung der Thematik angesichts der hohen Anzahl von Borderline-Patienten in Deutschland.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung: Dieses Kapitel erläutert das Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) anhand der Kriterien des DSM-IV und des ICD-10. Es beschreibt die Symptome, den Verlauf der Erkrankung, die Differentialdiagnostik und die epidemiologischen Daten. Der Fokus liegt auf einer klaren Darstellung des Störungsbildes, um ein fundiertes Verständnis für die nachfolgenden Kapitel zu schaffen. Die verschiedenen Klassifizierungssysteme werden verglichen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile werden implizit diskutiert.
Erklärungsansätze der Borderline-Persönlichkeitsstörung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung der BPS, einschließlich tiefenpsychologischer, dialektisch-behavioraler und humanistischer Perspektiven sowie des Vulnerabilitäts-Stress-Modells. Es wird detailliert auf die jeweiligen Theorien eingegangen und ihre Bedeutung für das Verständnis der Störung und deren Behandlung erörtert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der komplexen Ursachen der BPS und deren Interaktion.
Die dialektisch-behaviorale Therapie: Dieses Kapitel präsentiert die dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) als ein etabliertes und empirisch fundiertes Behandlungskonzept für Borderline-Patienten. Es beschreibt den Überblick über das Behandlungskonzept, die Therapiestruktur und die verschiedenen Behandlungsstrategien. Die DBT dient als Grundlage für das in der Arbeit entwickelte bewegungstherapeutische Konzept.
Die Sporttherapie: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Sporttherapie, einschließlich Begriffsbestimmung, Zielen und Methoden. Es bildet die theoretische Basis für die Anwendung von Sporttherapie bei Borderline-Patienten. Es wird auf die Vielfältigkeit der Methoden eingegangen und ihr Potential zur Behandlung psychischer Erkrankungen diskutiert.
Erhebung zur Sporttherapie für Borderline-Patienten: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte Erhebung zur aktuellen Situation der Sporttherapie in deutschen Kliniken für Borderline-Patienten. Es beinhaltet die Vorstellung des Fragebogens, die Darstellung der Untersuchungsgruppe und die Auswertung der Ergebnisse. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Stand der Versorgung und dienen als Grundlage für das entwickelte Konzept.
Formulierung der Therapieziele: Dieses Kapitel formuliert die spezifischen Therapieziele des entwickelten bewegungstherapeutischen Konzepts. Es differenziert zwischen allgemeinen Bewegungs- und Sporttherapiezielen und spezifischen Zielen, die sich an den verschiedenen Therapiephasen orientieren. Die Ziele werden präzise definiert und an den Bedürfnissen von Borderline-Patienten ausgerichtet.
Vermittlung der Therapieziele: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden und Techniken zur Vermittlung der Therapieziele an die Patienten. Es werden verschiedene Methoden vorgestellt, wie beispielsweise Funktionelle Gymnastik, Spielformen, Tanz, Bewegungstheater, Naturerlebnisse, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen und Entspannungstechniken. Die Auswahl der Methoden wird detailliert begründet.
Vorstellung des Konzeptes: Dieses Kapitel stellt das entwickelte bewegungstherapeutische Konzept im Detail vor. Es beinhaltet Aspekte der Therapiegestaltung wie Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße, zeitliche Dauer und Häufigkeit der Therapieeinheiten, die Räumlichkeiten, die Inhalte, Rituale und die Rolle des Therapeuten. Es bietet einen umfassenden Überblick über das gesamte Konzept und seine praktischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, Bewegungstherapie, Sporttherapie, Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT), stationäre Versorgung, psychische Erkrankung, Therapiekonzept, Erhebung, Empirie, klinische Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Bewegungstherapeutisches Konzept für Borderline-Patienten
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die aktuelle Situation der stationären Bewegungstherapie bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und präsentiert ein neuartiges bewegungstherapeutisches Konzept. Ziel ist es, die Forschungslücke zu diesem Thema zu schließen und praktische Handlungsempfehlungen für die klinische Praxis zu liefern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) umfassend, einschließlich der Diagnostik (DSM-IV, ICD-10), verschiedener Erklärungsansätze (tiefenpsychologisch, dialektisch-behavioral, humanistisch, Vulnerabilitäts-Stress-Modell), der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT) und der Sporttherapie. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Vorstellung eines neuen bewegungstherapeutischen Konzepts, basierend auf empirischen Ergebnissen einer durchgeführten Erhebung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, der Beschreibung der BPS, Erklärungsansätzen der BPS, der DBT, der Sporttherapie, einer Erhebung zur Sporttherapie bei Borderline-Patienten, der Formulierung von Therapiezielen, der Vermittlung dieser Ziele und der Vorstellung des entwickelten Konzepts. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche mit einer empirischen Erhebung mittels eines Fragebogens zur aktuellen Situation der Sporttherapie in deutschen Kliniken für Borderline-Patienten. Das entwickelte Konzept basiert auf evidenzbasierten Erkenntnissen und integriert die DBT.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Erhebung liefert Erkenntnisse über den aktuellen Stand der Versorgung von Borderline-Patienten mit Sporttherapie in Deutschland. Die Arbeit präsentiert ein detailliertes, neuartiges bewegungstherapeutisches Konzept, das spezifische Therapieziele, Methoden und die Gestaltung der Therapieeinheiten beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für Therapeuten, die mit Borderline-Patienten arbeiten, insbesondere Bewegungstherapeuten und Psychologen. Sie bietet praktische Handlungsempfehlungen und ein konkretes Therapiekonzept. Auch für Forscher im Bereich der Borderline-Persönlichkeitsstörung und Bewegungstherapie ist die Arbeit von Interesse.
Welche Therapieziele werden formuliert?
Die Therapieziele umfassen allgemeine Bewegungs- und sporttherapeutische Ziele sowie spezifische Ziele, die sich an den verschiedenen Therapiephasen orientieren. Diese Ziele sind präzise definiert und an den Bedürfnissen von Borderline-Patienten ausgerichtet. Die Arbeit beschreibt detailliert die Methoden und Techniken zur Vermittlung dieser Ziele.
Welche Methoden werden in dem entwickelten Konzept eingesetzt?
Das Konzept nutzt eine Vielzahl an Methoden, darunter Funktionelle Gymnastik, Spielformen, Tanz, Bewegungstheater, Naturerlebnisse, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen und Entspannungstechniken. Die Auswahl der Methoden wird detailliert begründet.
Wie ist das entwickelte Konzept aufgebaut?
Das entwickelte Konzept beinhaltet Aspekte der Therapiegestaltung wie Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße, zeitliche Dauer und Häufigkeit der Therapieeinheiten, die Räumlichkeiten, die Inhalte, Rituale und die Rolle des Therapeuten. Es bietet einen umfassenden Überblick über das gesamte Konzept und seine praktischen Implikationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Borderline-Persönlichkeitsstörung, Bewegungstherapie, Sporttherapie, Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT), stationäre Versorgung, psychische Erkrankung, Therapiekonzept, Erhebung, Empirie, klinische Praxis.
- Quote paper
- M.A. David Vomberg (Author), 2003, Bewegungstherapie bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18559