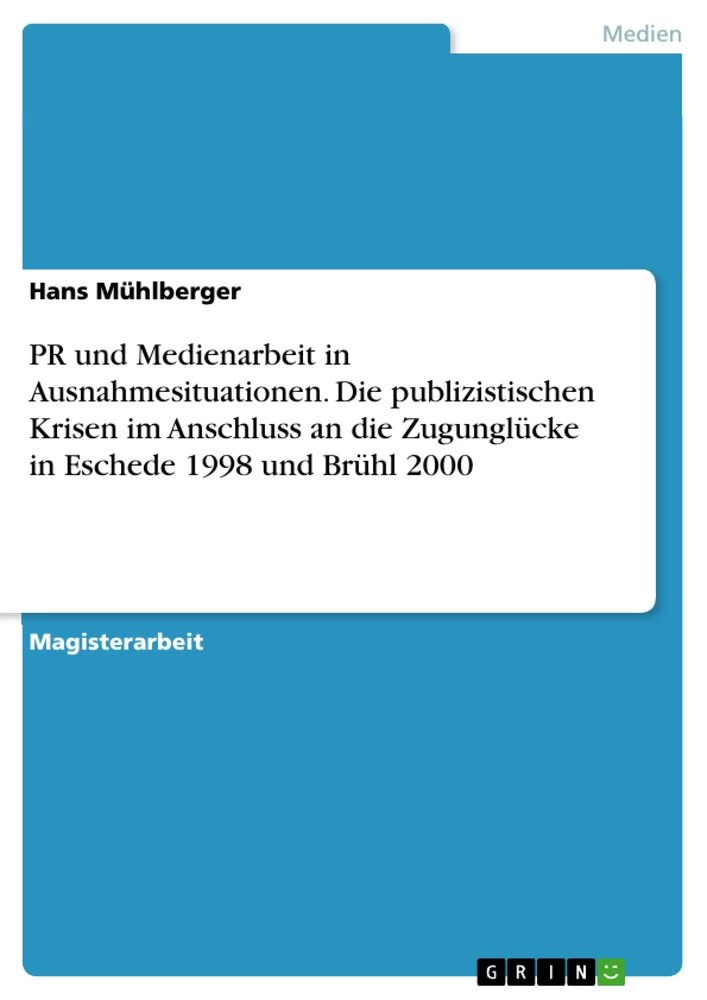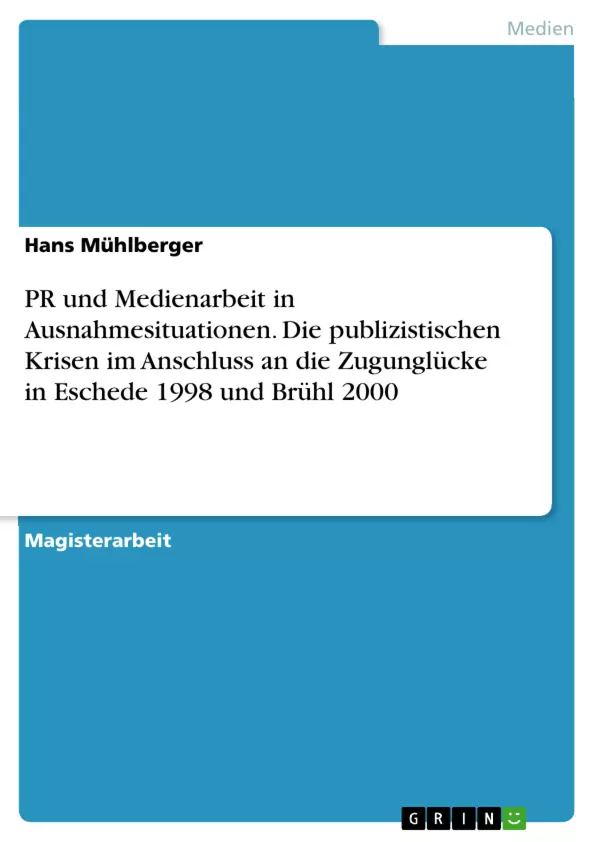Im Folgenden sollen die publizistischen Krisen im Anschluß an die Zugunglücke von Eschede und Brühl untersucht und miteinander verglichen werden. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Rolle ausgewählter Printmedien, Einflussfaktoren auf die Berichterstattung und das daraus entstehende Bild der Bahn in der veröffentlichten Meinung. Ziel der Arbeit ist es, über eine Analyse der Berichterstattung Rückschlüsse auf die Medienarbeit der Deutschen Bahn AG in den beiden Fällen zu ziehen, sowie Charakteristika und eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Auch ist es Ziel, die wichtigsten Einflussgrößen auf den Verlauf der publizistischen Krisen nach den Unglücken in Eschede und Brühl herauszuarbeiten. Besonders soll dabei natürlich auf die Rolle der DB AG in der Medienberichterstattung – sowohl als Aussageträger und Quelle, als auch als Kommunikationsobjekt – eingegangen werden. Es soll heraus gefunden werden, wie die Unfälle und die unmittelbaren Folgen dargestellt wurden, welche Aspekte in der Folgezeit besonders stark thematisiert wurden, welche vollkommen neuen Themen (die z.B die Bahn betreffen, aber nichts mehr mit den Unglücken zu tun haben) kreiert wurden.
Zudem sollen eventuelle Unterschiede in der Struktur und im Verlauf der publizistischen Krisen von Eschede und Brühl miteinander verglichen werden. Inwieweit war es z.B nach den Unglücken in Eschede und Brühl tatsächlich so, dass die DB AG keinen Einfluss mehr darauf hatte, was über sie geschrieben wurde? Wieso ließ sie sich diesen Einfluss nehmen? Hat sie die Möglichkeiten, ihre Sicht der Dinge in den Massenmedien durchzusetzen, angemessen genutzt?
Konkret geht es also um die Schnittstelle, an der Massenmedien und Unternehmenskommunikatoren im Krisenfall aufeinander treffen. Die Arbeit wird zum einen von Medienseite angegangen: Welche Personen(gruppen) binden die Medien in die Berichterstattung mit ein? Welche Themen gewichten sie besonders stark, wessen Meinung und Wertung lassen sie einfließen? Zum anderen interessiert die Unternehmensseite: Was unternimmt die Kommunikationsabteilung der DB AG, um in der Berichterstattung präsent zu sein? Wie wird sie mit dem immensen Informationsbedarf der Massenmedien in der Krise fertig? Inwieweit trägt sie mit einer passiven Informationspolitik dazu bei, dass die Medien andere Quellen zu Recherchezwecken heran ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Die Krise
- Begrifflichkeiten: Krise und Unternehmenskrise
- Begrifflichkeiten: Konflikte? Krisen? Katastrophen?
- Krisentypen und Ausprägungen von Krisen
- Merkmale
- Ursachen
- Auswirkungen
- Krisenursachen
- Krisenfolgen
- Krisenverläufe
- Reaktionsverlauf
- Krisenverlauf aus Sicht des Unternehmens
- Verlauf publizistischer Krisen
- Begrifflichkeiten: Die publizistische Krise
- Das Krisenverlaufsmodell von Klenk
- Struktur und Dynamik publizistischer Krisen
- Krise und Kommunikation: Handeln in Ausnahmesituationen
- Krisenkommunikation als elementarer Bestandteil von PR
- Abgrenzung zur Krisenprävention und Risikokommunikation
- Risikokommunikation
- Krisenprävention
- Erfolgsfaktoren der Krisenkommunikation
- Die Rolle der Medien
- Öffentlichkeit als Hintergrund öffentlicher Meinung
- Öffentliche Meinung
- Entstehung öffentlicher Kommunikation/öffentlicher Meinung
- Medienrealität nach Mathes
- Massenmedien als Gestalter der öffentlichen Meinung
- Verhältnis Medien – PR: Wer beeinflusst wen?
- Folgerungen zum Medienverhalten in Krisen
- Erfolgreiche Medienarbeit in Krisenzeiten
- Konzept der Krisenkommunikation
- Strategie
- Instrumente
- Infrastruktur
- Taktik
- Ziele
- Eckpunkte der Medienarbeit in Krisenzeiten
- Forschungsfragen
- Die Deutsche Bahn AG
- Das Unternehmen
- Kontextvariablen der DB AG
- Politik und Wettbewerb
- Organisation und Behördentum
- Öffentlichkeit
- Rahmenbedingungen der Unternehmenskommunikation
- Rahmenbedingungen der Krisenkommunikation
- Die Unglücke in Eschede und Brühl
- Chronologie der Ereignisse
- Chronologie Eschede
- Chronologie Brühl
- Gemeinsamkeiten der Unglücke
- Phasen der publizistischen Krisen
- Phasen der Berichterstattung (Eschede)
- Phasen der Berichterstattung (Brühl)
- Durchführung der Untersuchung
- Anlage der Untersuchung
- Untersuchungszeitraum und Medienauswahl
- Operationalisierung des Kategoriensystems
- Beschreibung der Kategorien
- Die Auswertung
- Formale Merkmale des untersuchten Materials
- Ergebnisse der inhaltlichen Untersuchung
- Interpretation
- Rückschlüsse auf die Forschungsfragen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Krisenkommunikation der Deutschen Bahn AG im Anschluss an die Zugunglücke von Eschede (1998) und Brühl (2000). Ziel ist es, die Medienarbeit des Unternehmens in diesen Ausnahmesituationen zu analysieren und Erfolgsfaktoren sowie Schwächen aufzuzeigen. Die Arbeit befasst sich mit der theoretischen Fundierung von Krisenkommunikation und deren praktische Anwendung im Kontext der Bahn-Unglücke.
- Analyse der Krisenkommunikation der Deutschen Bahn AG
- Untersuchung des Medienverhaltens in Krisensituationen
- Bewertung der Erfolgsfaktoren und Schwächen der Krisenkommunikation
- Vergleich der publizistischen Krisenverläufe in Eschede und Brühl
- Theoretische Einordnung der Ereignisse im Rahmen der Krisenkommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Krisenkommunikation ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie begründet die Wahl der Fallstudien – die Zugunglücke in Eschede und Brühl – und umreißt die Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Der Fokus liegt auf der Analyse der publizistischen Krisen und dem Umgang der Deutschen Bahn AG mit den Medien in diesen Ausnahmesituationen.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der Krisenkommunikation. Es werden verschiedene Begrifflichkeiten von Krisen, deren Ursachen, Auswirkungen und Verläufe definiert und eingeordnet. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Verständnis publizistischer Krisen und deren spezifischer Dynamik. Das Kapitel dient als fundierte Basis für die anschließende empirische Untersuchung.
Krise und Kommunikation: Handeln in Ausnahmesituationen: Dieses Kapitel fokussiert auf die Bedeutung von Kommunikation in Krisensituationen und die Rolle der Krisenkommunikation als integraler Bestandteil von Public Relations. Es differenziert zwischen Krisenkommunikation, Krisenprävention und Risikokommunikation und benennt die wesentlichen Erfolgsfaktoren einer effektiven Krisenkommunikation. Der Abschnitt stellt den theoretischen Rahmen für die spätere Analyse der Fallbeispiele dar.
Die Rolle der Medien: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Medien im Kontext von Krisen. Es beleuchtet das Verhältnis zwischen Medien und Public Relations, den Einfluss der öffentlichen Meinung und die Herausforderungen der Medienarbeit in Ausnahmesituationen. Die verschiedenen Theorien zur Entstehung der öffentlichen Meinung und die Medienrealität werden hier eingehend behandelt. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der Medienberichterstattung über die Zugunglücke.
Erfolgreiche Medienarbeit in Krisenzeiten: Dieses Kapitel beschreibt ein Konzept für erfolgreiche Medienarbeit in Krisenzeiten. Es erläutert die notwendigen Strategien, Instrumente, die benötigte Infrastruktur, die einzusetzende Taktik und die zu verfolgenden Ziele. Das Kapitel dient als Maßstab für die Bewertung der Krisenkommunikation der DB AG.
Die Deutsche Bahn AG: Dieses Kapitel porträtiert die Deutsche Bahn AG als Unternehmen und analysiert die Kontextvariablen, die ihre Unternehmenskommunikation und insbesondere die Krisenkommunikation beeinflussen. Hier werden politische, wettbewerbliche, organisatorische und öffentlichkeitsbezogene Faktoren beleuchtet, die die Handlungsspielräume und Herausforderungen der DB AG in Krisenzeiten prägen.
Die Unglücke in Eschede und Brühl: Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse der Zugunglücke von Eschede und Brühl chronologisch und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Katastrophen. Die unterschiedlichen Phasen der publizistischen Krisen in beiden Fällen werden im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Krisenkommunikation, Public Relations, Medienarbeit, Deutsche Bahn AG, Zugunglück, Eschede, Brühl, Öffentliche Meinung, Krisenmanagement, Medienberichterstattung, Kommunikationsstrategien, Risikokommunikation, Krisenprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Krisenkommunikation der Deutschen Bahn AG nach den Zugunglücken von Eschede und Brühl
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Krisenkommunikation der Deutschen Bahn AG nach den Zugunglücken von Eschede (1998) und Brühl (2000). Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Medienarbeit des Unternehmens in diesen Ausnahmesituationen, der Identifizierung von Erfolgsfaktoren und Schwächen sowie dem Vergleich der publizistischen Krisenverläufe beider Ereignisse.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Krisenkommunikation, einschließlich Definitionen von Krisen, deren Ursachen, Auswirkungen und Verläufe. Besonderes Augenmerk liegt auf publizistischen Krisen, deren Dynamik und dem Verständnis der Rolle von Medien und öffentlicher Meinung. Die Konzepte von Krisenprävention und Risikokommunikation werden ebenfalls erläutert.
Wie wird die Rolle der Medien behandelt?
Die Arbeit untersucht detailliert die Rolle der Medien in Krisensituationen, das Verhältnis zwischen Medien und Public Relations, den Einfluss der öffentlichen Meinung und die Herausforderungen der Medienarbeit in Ausnahmesituationen. Es werden Theorien zur Entstehung öffentlicher Meinung und zur Medienrealität diskutiert, um das Verständnis der Medienberichterstattung über die Zugunglücke zu verbessern.
Wie wird die Deutsche Bahn AG in die Analyse eingebunden?
Die Deutsche Bahn AG wird als Unternehmen vorgestellt, wobei die Kontextvariablen (politische, wettbewerbliche, organisatorische und öffentlichkeitsbezogene Faktoren) analysiert werden, die ihre Unternehmenskommunikation und insbesondere die Krisenkommunikation beeinflussen. Diese Kontextfaktoren werden mit den Herausforderungen der DB AG in Krisenzeiten in Verbindung gebracht.
Wie werden die Unglücke von Eschede und Brühl verglichen?
Die Ereignisse in Eschede und Brühl werden chronologisch dargestellt, und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der beiden Katastrophen werden analysiert. Die Arbeit untersucht detailliert die Phasen der publizistischen Krisen in beiden Fällen und vergleicht die Medienberichterstattung.
Wie ist die empirische Untersuchung aufgebaut?
Die empirische Untersuchung umfasst die Definition des Untersuchungszeitraums und der Medienauswahl, die Operationalisierung eines Kategoriensystems und die Beschreibung der Kategorien. Die Auswertung beinhaltet die Analyse formaler Merkmale des untersuchten Materials und die Ergebnisse der inhaltlichen Untersuchung. Die Interpretation der Ergebnisse beinhaltet Rückschlüsse auf die Forschungsfragen und eine Zusammenfassung der Erkenntnisse.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Krisenkommunikation der Deutschen Bahn AG, das Medienverhalten in Krisensituationen, die Erfolgsfaktoren und Schwächen der Krisenkommunikation, den Vergleich der publizistischen Krisenverläufe in Eschede und Brühl sowie die theoretische Einordnung der Ereignisse im Rahmen der Krisenkommunikation. Konkrete Forschungsfragen werden im Kapitel "Erfolgreiche Medienarbeit in Krisenzeiten" detaillierter formuliert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen Krisenkommunikation, Public Relations, Medienarbeit, Deutsche Bahn AG, Zugunglück, Eschede, Brühl, Öffentliche Meinung, Krisenmanagement, Medienberichterstattung, Kommunikationsstrategien, Risikokommunikation und Krisenprävention.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu Einleitung, theoretischem Hintergrund, Krise und Kommunikation, Rolle der Medien, erfolgreicher Medienarbeit in Krisenzeiten, der Deutschen Bahn AG, den Unglücken in Eschede und Brühl sowie zur Durchführung der Untersuchung (inkl. Auswertung und Interpretation).
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn des Dokuments und listet alle Unterkapitel auf.
- Citation du texte
- Hans Mühlberger (Auteur), 2000, PR und Medienarbeit in Ausnahmesituationen. Die publizistischen Krisen im Anschluss an die Zugunglücke in Eschede 1998 und Brühl 2000, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185600