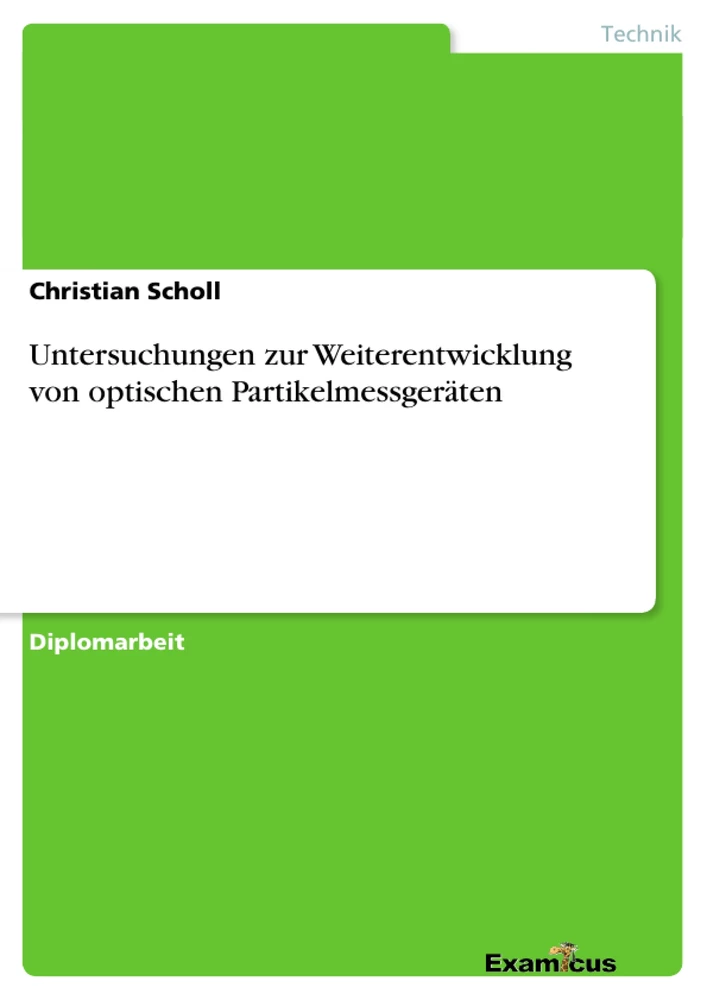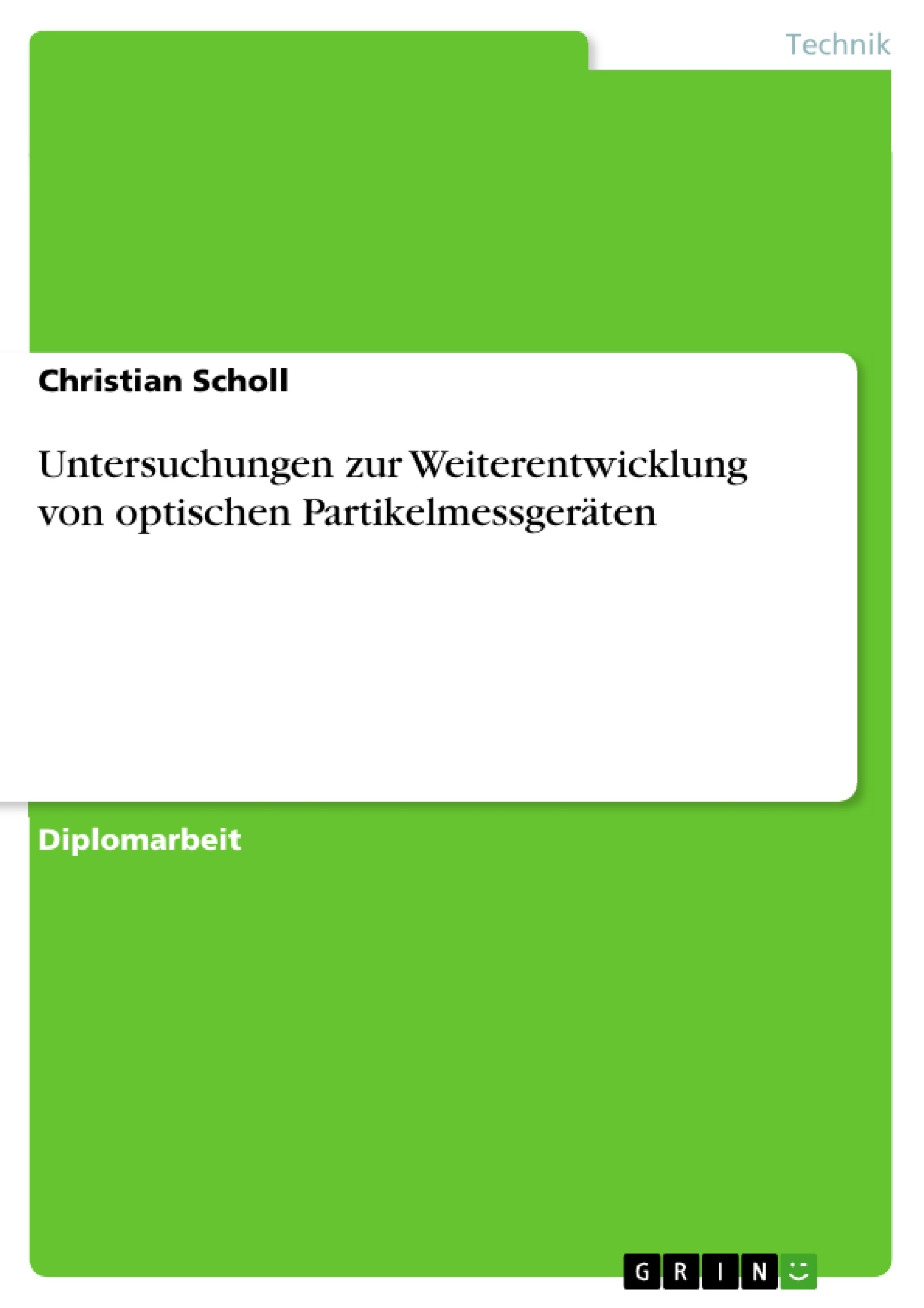Zur Charakterisierung, Qualitätsüberprüfung, Produktionssteuerung und Optimierung einer vielzahl industrieller Güter und Prozesse ist die Kenntnis von Partikelgröße und Partikelform von entscheidender Bedeutung. Diese Eigenschaften beeinflussen in hohem Maße das Verhalten eines Feststoffes. Schon beim Gewinnungsprozess muss eine bestimmte Partikelgröße erreicht werden, um eine reibungslose Weiterverarbeitung und die angestrebten Qualitätsmerkmale des Endproduktes zu erzielen. Aufgrund wachsender Qualitätsanforderungen müssen diese Merkmale von Schüttgütern immer häufiger, reproduzierbarer und quantitativ exakter ermittelt werden. Dabei stößt die traditionelle Siebanalyse wegen ihres hohen Zeitaufwandes und ihres geringen Auflösungsvermögens zunehmend an ihre Grenzen. Zudem beinhaltet sie Nachteile, wie z.B. die Ungenauigkeiten der Siebmaschenweiten, die aufwendige Reinigung und den Ersatz beschädigter Siebe.
Daher werden Siebanalysen immer häufiger durch optische Messverfahren ersetzt. Thema dieser Arbeit ist die Untersuchung und Weiterentwicklung eines optischen Partikelmessgerätes, des Camsizer, dessen Messprinzip auf der Technik der digitalen Bildverarbeitung beruht.
Die Siebanalyse ist traditionell immer noch die häufigste Methode der Partikelgrößencharakterisierung der Anwender. Um diesen das Umsteigen auf neuere Verfahren zu erleichtern, wird angestrebt, die Messergebnisse von Siebanalyse und optischen Verfahren vergleichbar zu gestalten. Deswegen wird das neue optische Verfahren der Möglichkeit der Partikelcharakterisierung mittels Siebanalyse kritisch gegenübergestellt, wobei auch die Möglichkeit einer Siebungssimulation mit digitaler Bildverarbeitung erörtert wird.
Ein weiteres Thema dieser Untersuchung ist das Entwickeln einer neuen Software-Edition, die die Möglichkeiten der Korngrößen- und Kornformanalyse nach Kundenanforderungen stark erweitert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Unternehmensportrait
- 3. Grundlagen disperser Systeme
- 3.1 Statistische Längen und Partikelgröße
- 3.2 Größenverteilungen von Partikelkollektiven
- 3.2.1 Die Verteilungssumme Qr
- 3.2.2 Die Verteilungsdichte qr
- 3.2.3 Die Fraktionen pr
- 3.2.4 Anzahl- vs. Volumenverteilung
- 3.2.5 Spezielle Verteilungen
- 3.3 Formkenngrößen
- 3.3.1 Sphärizität (SPHT)
- 3.3.2 Prozentualer Anteil nichtsphärischer Partikeln NSP
- 4. Probenahme und Probenteilung
- 4.1 Probenahme
- 4.2 Probenteilung
- 5. Partikelcharakterisierung nach dem Stand der Technik
- 5.1 Siebanalyse
- 6. Probleme der Praxis, Wünsche der Hersteller
- 6.1 Die Kornform
- 6.2 Bestimmung der Kornform
- 7. Digitale Bildverarbeitung
- 7.1 Einführung
- 7.2 Partikelmessgerät Camsizer
- 7.2.1 Software
- 8. Messreihen Standard Camsizer-Software
- 8.1 Reproduzierbarkeit
- 8.2 Vergleich der Camsizer-Messergebnisse mit denen der Siebanalyse
- 8.3 Überlagerungen der Partikelprojektionen
- 8.4 Grafische Darstellung der Messergebnisse
- 9. Messreihen neue Camsizer-Software
- 9.1 Möglichkeiten und Grenzen
- 9.2 Messungen
- 9.2.1 Breitenmessung
- 9.2.2 Messen von Längen
- 9.2.3 Bestimmen der geringsten Partikelausdehnung durch Messen der kleinsten maximalen Sehne
- 9.2.4 Darstellung der Kornform, Kenngrößen
- 9.2.4.1 Sphärizität
- 9.2.4.2 Verhältnisse von Breiten und Längen
- 9.2.5 Anwendungen aus der Praxis
- 10. Ergebnisse der Versuchsreihen
- 10.1 Standard Camsizer-Software
- 10.2 Neue Camsizer-Software
- 11. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung und Weiterentwicklung eines optischen Partikelmessgeräts, des Camsizers. Es sollte untersucht werden, inwiefern die digitale Bildverarbeitung im Vergleich zur traditionellen Siebanalyse zur Partikelcharakterisierung geeignet ist und wie die Messergebnisse beider Verfahren verbessert und vergleichbar gemacht werden können.
- Vergleich der digitalen Bildverarbeitung mit der Siebanalyse
- Optimierung der Software des Camsizers zur genaueren Partikelcharakterisierung
- Verbesserung der Vergleichbarkeit der Messergebnisse beider Verfahren
- Bestimmung der Kornform mittels digitaler Bildverarbeitung
- Anwendung der Ergebnisse in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung der Untersuchung zur Weiterentwicklung optischer Partikelmessgeräte. Sie skizziert die Problematik bestehender Methoden und die Notwendigkeit der Verbesserung der Messgenauigkeit und Vergleichbarkeit mit etablierten Verfahren wie der Siebanalyse.
3. Grundlagen disperser Systeme: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis disperser Systeme und Partikelcharakterisierung. Es definiert wichtige Begriffe wie statistische Längen, Partikelgrößenverteilungen (Verteilungssumme, Verteilungsdichte, Fraktionen), und behandelt die Unterscheidung zwischen Anzahl- und Volumenverteilung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung verschiedener Formen von Partikelgrößenverteilungen und der Charakterisierung der Partikelform mittels Kenngrößen wie Sphärizität und dem prozentualen Anteil nichtsphärischer Partikel. Diese Grundlagen bilden die Basis für die spätere Auswertung der Messergebnisse.
4. Probenahme und Probenteilung: Das Kapitel beschreibt die notwendigen Schritte der Probenahme und Probenteilung, um repräsentative Messungen zu gewährleisten. Es behandelt die verschiedenen Methoden und Verfahren, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Probe ein exaktes Abbild des gesamten Materials repräsentiert. Die korrekte Probenahme und -teilung ist essentiell, um die Genauigkeit und Aussagekraft der späteren Messergebnisse zu gewährleisten und systematische Fehler zu vermeiden.
5. Partikelcharakterisierung nach dem Stand der Technik: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über etablierte Methoden der Partikelcharakterisierung, insbesondere die Siebanalyse. Es erläutert das Prinzip der Siebanalyse, ihre Vor- und Nachteile und ihre Bedeutung als Referenzmethode. Der Vergleich mit der digitalen Bildverarbeitung bildet einen wichtigen Aspekt der gesamten Arbeit. Die Grenzen der Siebanalyse bezüglich der Formgebung der Partikel werden hervorgehoben.
6. Probleme der Praxis, Wünsche der Hersteller: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Wünsche der Hersteller bezüglich der Partikelcharakterisierung in der Praxis. Es konzentriert sich auf die Bedeutung der Kornform und die Schwierigkeiten ihrer Bestimmung mit traditionellen Methoden. Es wird deutlich, dass ein Bedarf an verbesserten Messmethoden besteht, die nicht nur die Partikelgröße, sondern auch die Partikelform berücksichtigen. Diese Problematik wird später mit den Möglichkeiten der digitalen Bildverarbeitung konfrontiert.
7. Digitale Bildverarbeitung: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung als Methode der Partikelcharakterisierung. Es stellt das verwendete Messgerät, den Camsizer, vor und erläutert dessen Funktionsweise und die zugrundeliegende Software. Die Beschreibung der Software ist entscheidend, um die späteren Verbesserungen und Optimierungen zu verstehen.
8. Messreihen Standard Camsizer-Software: Dieses Kapitel dokumentiert die Messreihen, die mit der Standard-Software des Camsizers durchgeführt wurden. Es analysiert die Reproduzierbarkeit der Messungen und vergleicht die Ergebnisse mit denen der Siebanalyse. Probleme wie die Überlagerung von Partikelprojektionen werden diskutiert, und die grafische Darstellung der Messergebnisse wird erläutert. Die Ergebnisse dieses Kapitels bilden die Grundlage für die Bewertung der Verbesserungen durch die neue Software.
9. Messreihen neue Camsizer-Software: In diesem Kapitel werden die Messreihen mit der optimierten Camsizer-Software vorgestellt. Es werden die neuen Möglichkeiten und Grenzen der Software, insbesondere die verbesserte Auswertung von Partikelprojektionen und die Bestimmung verschiedener Durchmesser, diskutiert. Die Ergebnisse der Messungen werden detailliert dargestellt und analysiert. Die Bestimmung der kleinsten maximalen Sehne zur Charakterisierung der Partikelform wird als Schlüsselfunktion der neuen Software hervorgehoben.
10. Ergebnisse der Versuchsreihen: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Messreihen mit der Standard- und der neuen Camsizer-Software zusammen. Es werden die Verbesserungen durch die neue Software im Hinblick auf Genauigkeit und Vergleichbarkeit mit der Siebanalyse bewertet. Die Ergebnisse zeigen die Vorteile der digitalen Bildverarbeitung für die Partikelcharakterisierung.
Schlüsselwörter
Digitale Bildverarbeitung, Partikelmessgerät, Camsizer, Siebanalyse, Partikelcharakterisierung, Kornform, Sphärizität, Partikelgrößenverteilung, Messgenauigkeit, Softwareoptimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung und Weiterentwicklung eines optischen Partikelmessgeräts (Camsizer)
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht und optimiert die Verwendung des optischen Partikelmessgeräts Camsizer zur Partikelcharakterisierung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der digitalen Bildverarbeitung (Camsizer) mit der traditionellen Siebanalyse und der Verbesserung der Messgenauigkeit und Vergleichbarkeit beider Methoden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die digitale Bildverarbeitung mit der Siebanalyse zu vergleichen, die Camsizer-Software zur genaueren Partikelcharakterisierung zu optimieren, die Vergleichbarkeit der Messergebnisse beider Verfahren zu verbessern, die Kornform mittels digitaler Bildverarbeitung zu bestimmen und die Ergebnisse in der Praxis anzuwenden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Unternehmensportrait (falls vorhanden), Grundlagen disperser Systeme (statistische Längen, Partikelgrößenverteilungen, Formkenngrößen), Probenahme und Probenteilung, Partikelcharakterisierung nach dem Stand der Technik (Siebanalyse), Problemen der Praxis und Wünschen der Hersteller (Kornformbestimmung), digitaler Bildverarbeitung (Camsizer und Software), Messreihen mit Standard- und neuer Camsizer-Software (Reproduzierbarkeit, Vergleich mit Siebanalyse, Überlagerung von Partikelprojektionen), Ergebnisse der Versuchsreihen und Ausblick.
Welche Grundlagen werden zu dispersen Systemen behandelt?
Die Grundlagen behandeln statistische Längen, Partikelgrößenverteilungen (Verteilungssumme Qr, Verteilungsdichte qr, Fraktionen pr), die Unterscheidung zwischen Anzahl- und Volumenverteilung, spezielle Verteilungen und Formkenngrößen wie Sphärizität und den prozentualen Anteil nichtsphärischer Partikel.
Wie werden Probenahme und Probenteilung behandelt?
Das Kapitel beschreibt Methoden und Verfahren zur Sicherstellung repräsentativer Messungen, um systematische Fehler zu vermeiden und die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten.
Welche Methode dient als Referenzmethode im Vergleich zur digitalen Bildverarbeitung?
Die Siebanalyse dient als etablierte Referenzmethode für den Vergleich mit der digitalen Bildverarbeitung des Camsizers.
Welche Probleme und Wünsche der Hersteller werden angesprochen?
Die Herausforderungen betreffen insbesondere die Bestimmung der Kornform, da traditionelle Methoden hier limitiert sind. Es besteht Bedarf an verbesserten Methoden, die sowohl Partikelgröße als auch -form berücksichtigen.
Wie wird die digitale Bildverarbeitung beschrieben?
Das Kapitel beschreibt die Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung, stellt den Camsizer vor und erläutert dessen Funktionsweise sowie die verwendete Software. Die Softwarebeschreibung ist wichtig für das Verständnis der späteren Optimierungen.
Was wird in den Messreihen mit der Standard- und der neuen Camsizer-Software untersucht?
Die Messreihen untersuchen die Reproduzierbarkeit, vergleichen die Ergebnisse mit der Siebanalyse, analysieren die Überlagerung von Partikelprojektionen und die grafische Darstellung der Messergebnisse. Die neue Software wird auf ihre Möglichkeiten und Grenzen, verbesserte Partikelprojektionsauswertung und Bestimmung verschiedener Durchmesser untersucht. Die Bestimmung der kleinsten maximalen Sehne zur Formcharakterisierung ist ein Schwerpunkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Digitale Bildverarbeitung, Partikelmessgerät, Camsizer, Siebanalyse, Partikelcharakterisierung, Kornform, Sphärizität, Partikelgrößenverteilung, Messgenauigkeit, Softwareoptimierung.
- Citar trabajo
- Christian Scholl (Autor), 2001, Untersuchungen zur Weiterentwicklung von optischen Partikelmessgeräten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185774