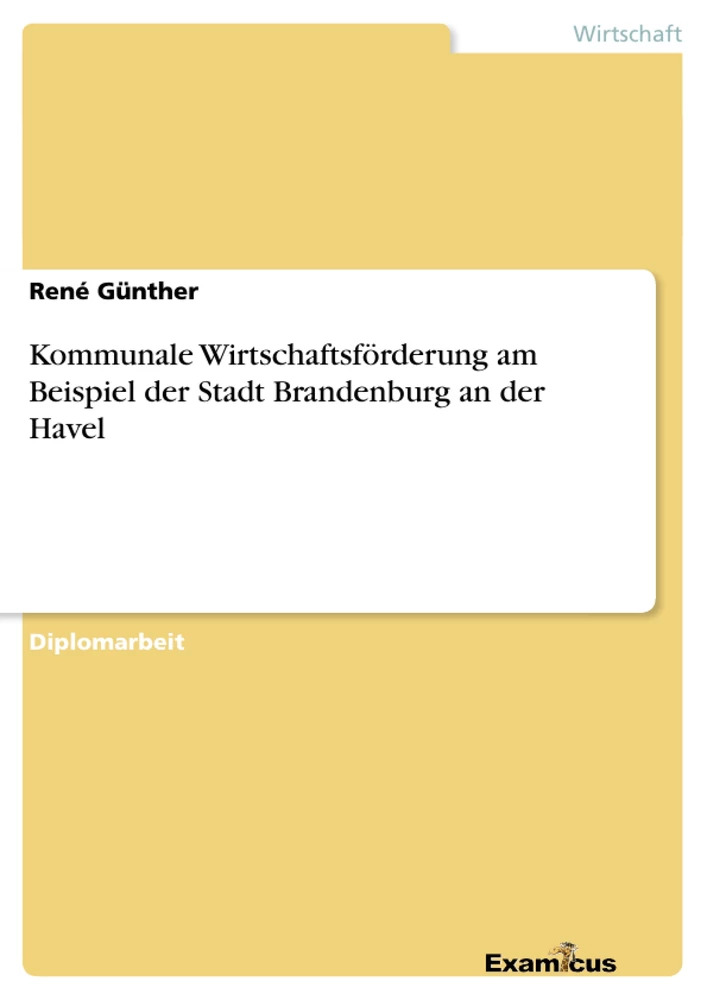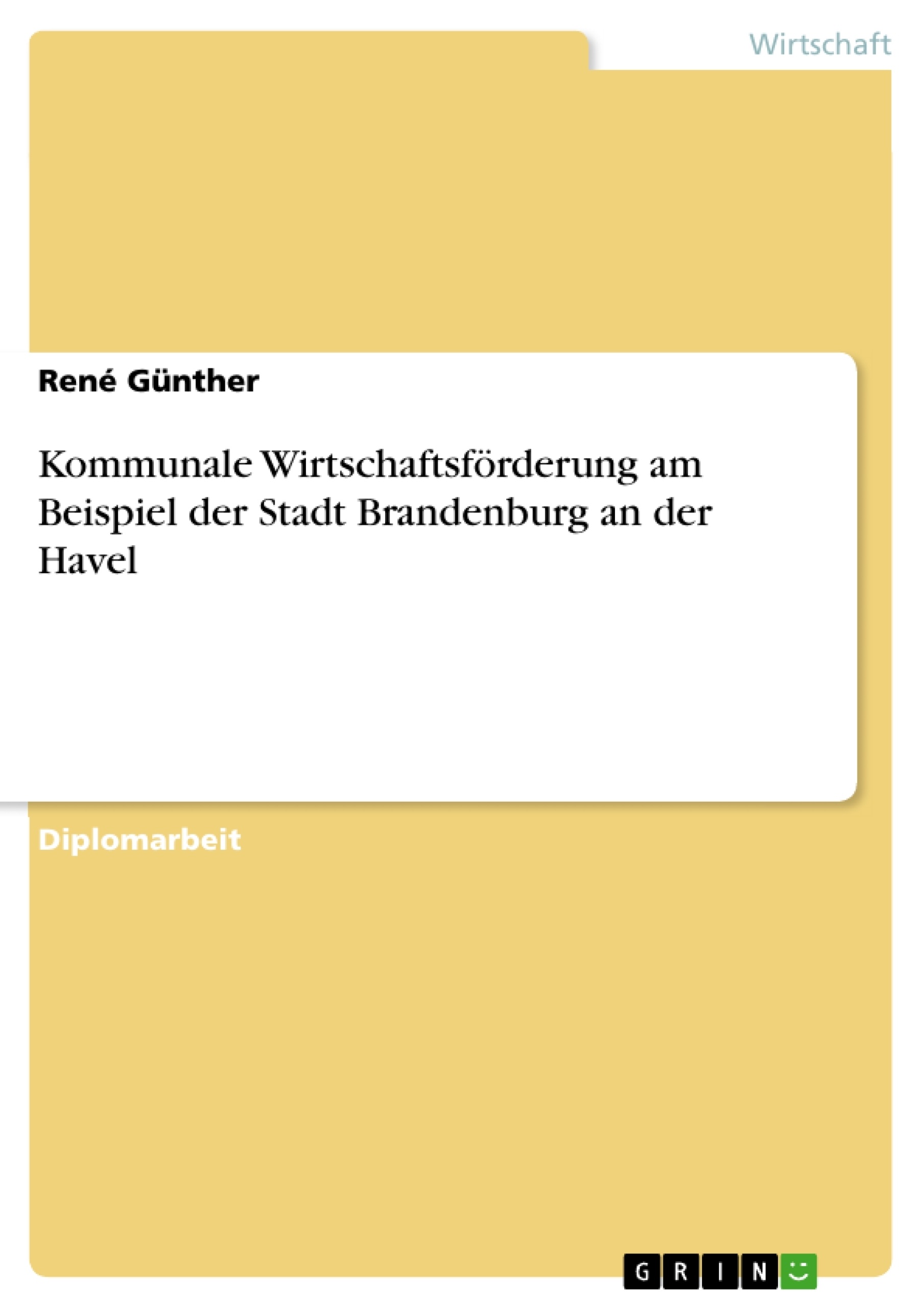In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, aus welchen Elementen
kommunale Wirtschaftsförderung besteht, welche Aufgaben Wirtschaftsförderer
haben und welche Instrumente ihnen zur Lösung dieser
Aufgaben zur Verfügung stehen. Im zweiten Teil wird die Qualität der
Wirtschaftsförderung in der Stadt Brandenburg an der Havel untersucht.
Wie ist die kommunale Wirtschaft strukturiert? Wie sind die Standortfaktoren
ausgeprägt? Wie effektiv ist die Arbeit des städtischen Amtes
für Wirtschaftsförderung? Daran schließt sich der Entwurf einer optimalen
Struktur der Wirtschaftsförderung an.
Diese Arbeit könnte daher für Lokalpolitiker und Verwaltungsangestellte
nützlich sein, die neue Anregungen suchen oder ihr Wirken auf eine
wissenschaftlich fundierte Grundlage stellen wollen, ohne selbst die
umfangreiche Fachliteratur zu lesen.
Jede Stadt oder Gemeinde braucht vor Ort ansässige Unternehmen. Sie
zahlen Steuern, schaffen Arbeitsplätze und sichern so das örtliche
Wohlstandsniveau. Die Zahl der Betriebe, die einen Standort suchen, ist
deutlich geringer als die Zahl der Kommunen, die sich um Neuansiedlungen
bemühen. Die einzelnen Städte und Gemeinden stehen also im
Wettbewerb um diese Betriebe. Die sogenannten mobilen Betriebe sind in
der komfortablen Lage, Bedingungen stellen und sich den für sie besten
Standort aussuchen zu können. Die kommunale Wirtschaftsförderung
versucht, bestehenden, entstehenden und ansiedlungsinteressierten Unternehmen
zu einer erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen. So können
ausreichend Arbeitsplätze geschaffen und das regionale Wohlstandsniveau
gehalten bzw. verbessert werden (siehe Kapitel 1). Die wichtigste
Größe in diesem Zusammenhang sind die Standortfaktoren. Unter ihnen
versteht man die Summe der an einem Ort anzutreffenden Gegebenheiten und Gestaltungskräfte mit positiver bzw. negativer Wirkung auf die
unternehmerische Tätigkeit (siehe Kapitel 2). Da Unternehmen sich im
allgemeinen für den Standort entscheiden, an dem ihre Anforderungen
am besten erfüllt werden, sollten die Standortfaktoren soweit wie möglich
optimiert werden. Für die kommunalen Wirtschaftsförderer bestehen
traditionell zwei zentrale Aufgaben (siehe Kapitel 3). Dies ist zum
einen die Akquisition mobiler Betriebe und zum anderen die Aktivierung
des endogenen Potentials. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung
und europäischen Integration gewinnen Kooperationen zunehmend
an Bedeutung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungs- / Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlage
- 2.1 Definition der kommunalen Wirtschaftsförderung
- 2.2 Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung
- 2.3 Standortfaktoren
- 2.3.1 Harte Standortfaktoren
- 2.3.2 Weiche Standortfaktoren
- 3. Aufgabenfelder
- 3.1 Traditionelle Aufgabenfelder
- 3.1.1 Akquisition mobiler Betriebe
- 3.1.2 Aktivierung des endogenen Potentials
- 3.2 Neue Anforderungen
- 4. Instrumente kommunaler Wirtschaftsförderung
- 4.1 Gewerbeflächenpolitik
- 4.2 Infrastrukturpolitik
- 4.3 Initiierung und Förderung von Standortgemeinschaften
- 4.4 Finanzhilfen und Tarifpolitik
- 4.5 Werbung und Standortmarketing
- 4.6 Beratung und Dienstleistungen
- 5. Regionalisierte Wirtschaftsförderung
- 5.1 Intrakommunale Zusammenarbeit
- 5.2 Interkommunale Zusammenarbeit
- 5.3 Public-Private-Partnership
- 6. Bestandsanalyse der Unternehmen in Brandenburg/Havel
- 6.1 Betriebsstättenstruktur
- 6.2 Entwicklung der Gewerbean- und -abmeldungen
- 6.3 Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes
- 6.4 Entwicklung des Baugewerbes
- 6.5 Entwicklung des Handels
- 6.6 Entwicklung des Tourismus
- 7. Analyse der Standortfaktoren in Brandenburg/Havel
- 7.1 Harte Standortfaktoren
- 7.1.1 Verkehrsanbindung
- 7.1.2 Arbeitsmarkt
- 7.1.3 Kommunales Flächenangebot
- 7.1.4 Förderangebote
- 7.1.5 Ansässige Hochschulen
- 7.1.6 Lokale Abgaben
- 7.1.7 Mietkosten
- 7.1.8 Energiekosten
- 7.1.9 Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten
- 7.1.10 Umweltschutzauflagen
- 7.2 Weiche Standortfaktoren
- 7.2.1 Lokales und regionales Wirtschaftsklima, Image der Region, der Stadt und des Betriebsstandortes
- 7.2.2 Karrieremöglichkeiten für Arbeitnehmer
- 7.2.3 Innovatives Milieu der Region
- 7.2.4 Wohnqualität und Wohnumfeld, Umweltqualität
- 7.2.5 Angebot an Schulen und Ausbildungsstätten
- 7.2.6 Freizeitwert, Angebot an Hoch- und Kleinkultur
- 8. Analyse der Qualität der Wirtschaftsförderung in der Stadt Brandenburg an der Havel
- 8.1 Entwicklung des endogenen Potentials
- 8.2 Akquisition mobiler Betriebe
- 9. Entwurf einer optimalen Wirtschaftsförderungs-Struktur
- 10. Fazit und Ausblick
- Anhang
- 1. Expertengespräche
- 1.1 Expertengespräch mit Wilfried Meier
- 1.2 Expertengespräch mit Heinz Morio
- 1.3 Expertengespräch mit Mathias Mischker
- 1.4 Expertengespräch mit Barbara Mangelsdorf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Kommunale Wirtschaftsförderung am Beispiel der Stadt Brandenburg an der Havel“ befasst sich mit der Analyse der Wirtschaftsförderung in einer mittelgroßen Stadt. Ziel ist es, die Aufgaben, Instrumente und Herausforderungen der kommunalen Wirtschaftsförderung zu beleuchten und anhand des Beispiels Brandenburg an der Havel zu untersuchen, wie die Stadt ihre Wirtschaftskraft stärken kann.
- Definition und Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung
- Standortfaktoren und deren Bedeutung für die Wirtschaftsentwicklung
- Analyse der Wirtschaftsstruktur und der Standortfaktoren in Brandenburg an der Havel
- Bewertung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Stadt
- Entwicklung eines Konzepts für eine optimale Wirtschaftsförderungsstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz des Themas erläutert. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der kommunalen Wirtschaftsförderung definiert, die Ziele der Wirtschaftsförderung erläutert und die wichtigsten Standortfaktoren vorgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Aufgabenfeldern der kommunalen Wirtschaftsförderung, wobei sowohl traditionelle als auch neue Anforderungen im Fokus stehen. Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung vorgestellt, darunter Gewerbeflächenpolitik, Infrastrukturpolitik, Initiierung und Förderung von Standortgemeinschaften, Finanzhilfen und Tarifpolitik, Werbung und Standortmarketing sowie Beratung und Dienstleistungen. Das fünfte Kapitel behandelt die regionalisierte Wirtschaftsförderung, wobei die Intrakommunale Zusammenarbeit, die Interkommunale Zusammenarbeit und die Public-Private-Partnership im Vordergrund stehen. Das sechste Kapitel analysiert die Bestandsstruktur der Unternehmen in Brandenburg an der Havel, wobei die Entwicklung der Gewerbean- und -abmeldungen, des Verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes, des Handels und des Tourismus betrachtet wird. Das siebte Kapitel analysiert die Standortfaktoren in Brandenburg an der Havel, wobei sowohl harte als auch weiche Standortfaktoren untersucht werden. Das achte Kapitel bewertet die Qualität der Wirtschaftsförderung in der Stadt Brandenburg an der Havel, wobei die Entwicklung des endogenen Potentials und die Akquisition mobiler Betriebe im Fokus stehen. Das neunte Kapitel entwirft ein Konzept für eine optimale Wirtschaftsförderungsstruktur. Die Arbeit endet mit einem Fazit und Ausblick.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die kommunale Wirtschaftsförderung, die Stadt Brandenburg an der Havel, Standortfaktoren, Wirtschaftsstruktur, Aufgabenfelder, Instrumente, Regionalisierung, Bestandsanalyse, Entwicklung des endogenen Potentials, Akquisition mobiler Betriebe, optimale Wirtschaftsförderungsstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der kommunalen Wirtschaftsförderung?
Ziel ist es, ansässige Unternehmen zu stärken, neue Betriebe anzusiedeln, Arbeitsplätze zu sichern und das regionale Wohlstandsniveau zu erhöhen.
Was ist der Unterschied zwischen harten und weichen Standortfaktoren?
Harte Faktoren sind messbar (z.B. Verkehrsanbindung, Steuern), weiche Faktoren sind subjektiver (z.B. Wohnqualität, Image der Stadt, Freizeitangebot).
Wie wird die Wirtschaftsförderung in Brandenburg an der Havel bewertet?
Die Arbeit analysiert die Effektivität des städtischen Amtes hinsichtlich der Akquisition mobiler Betriebe und der Aktivierung endogener Potenziale.
Welche Instrumente stehen Wirtschaftsförderern zur Verfügung?
Wichtige Instrumente sind die Gewerbeflächenpolitik, Infrastrukturplanung, Standortmarketing sowie Beratungs- und Dienstleistungsangebote für Firmen.
Was bedeutet „Aktivierung des endogenen Potentials“?
Es bezeichnet die Unterstützung und Förderung bereits ansässiger Unternehmen und lokaler Ressourcen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.
- Citation du texte
- René Günther (Auteur), 2002, Kommunale Wirtschaftsförderung am Beispiel der Stadt Brandenburg an der Havel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185786