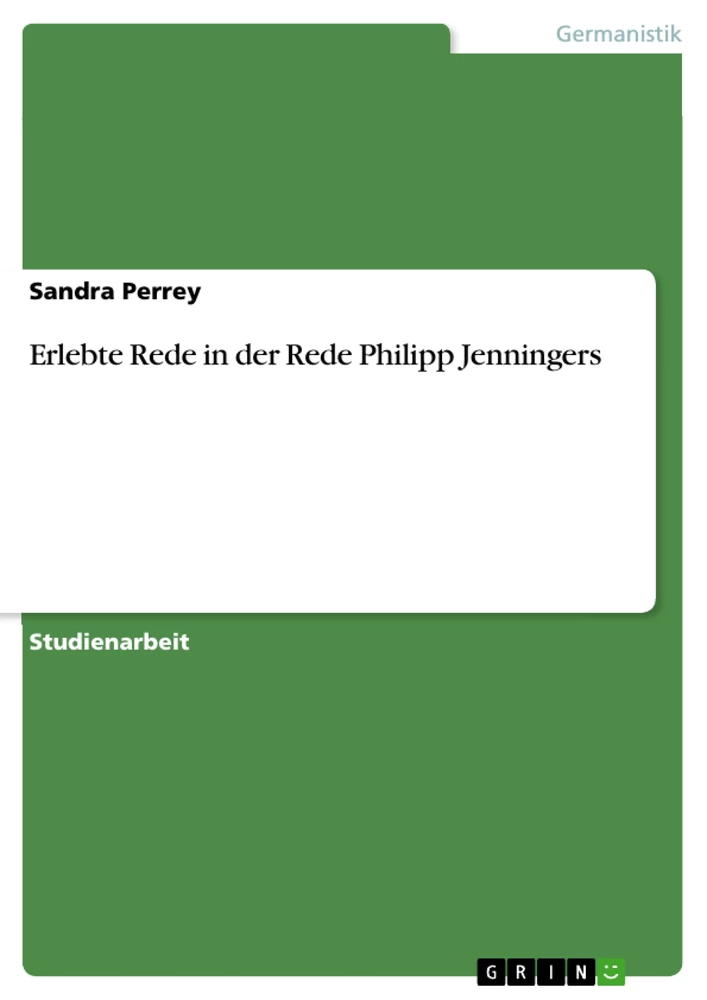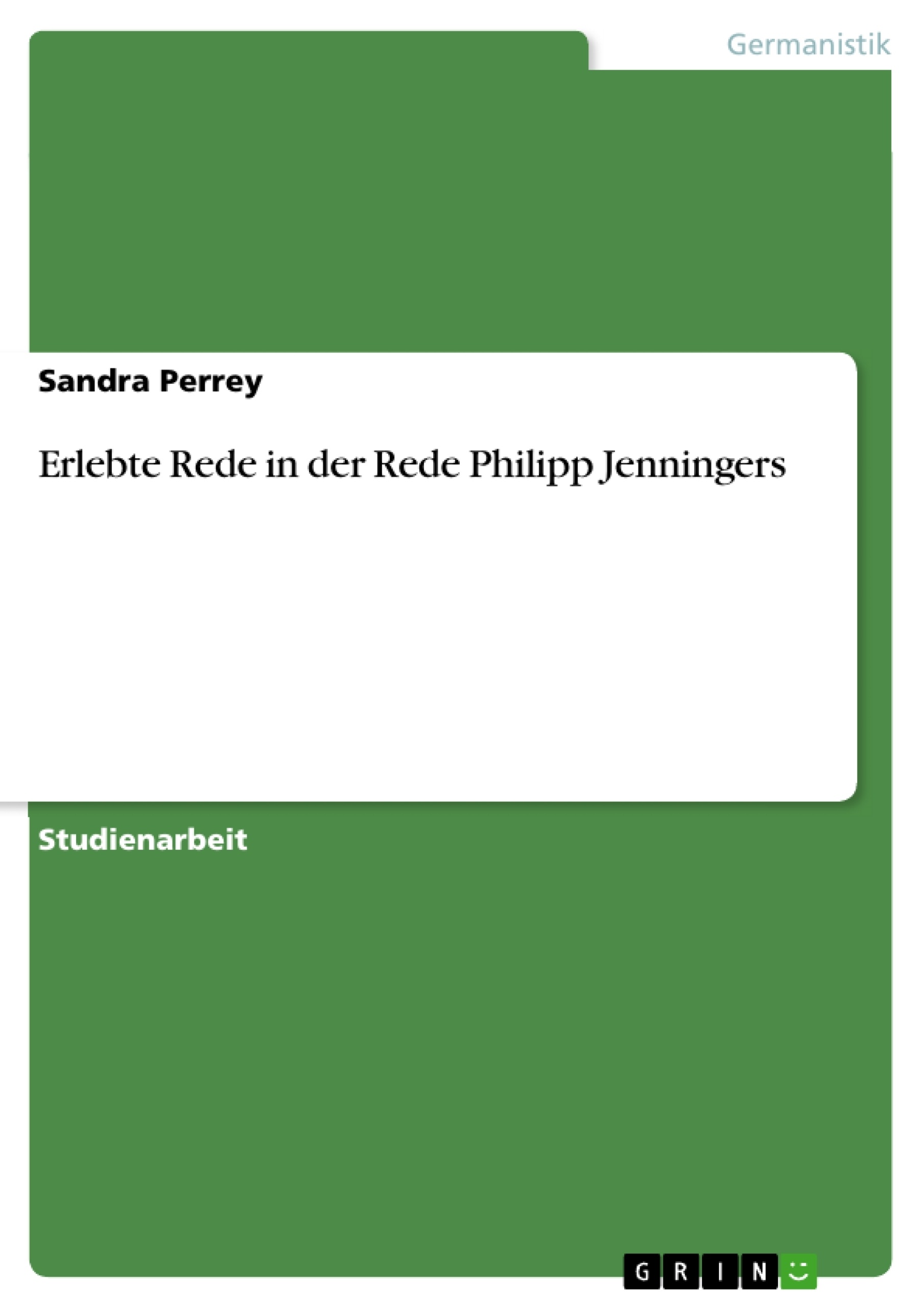Als Thema meiner Hausarbeit habe ich eine Untersuchung der Rede Dr. Philipp Jenningers vom 10. November 1988 anläßlich der Reichspogromnacht vor fünfzig Jahren gewählt. Die erste Begegnung mit (einem Exzerpt) der Rede machte ich im Rahmen des Hauptseminars ,,Redewiedergabe im Deutschen". Der Textausschnitt lag als Lektüretext vor, bei dem das Augenmerk auf die Anwendung des Stilmittels ,,Erlebte Rede" gelenkt wurde, das in diesem Kontext und in der auftretenden Intensität für die Rezeption des Textes verwirrend wirkte. Doch auch das mehrmalige Durchlesen dieser Passage erklärte noch nicht den Empörung hervorrufenden Effekt der Rede damals und die Konsequenz, nämlich Jenningers Rücktritt vom Amt des Bundestagspräsidenten. Die Wirkung der Rede konnte ich erst verstehen, nachdem ich die Rede auf Video sah und nicht Leser eines Textes sondern Zuschauer und -hörer war. Mein erstes Empfinden war Mitleid mit dem Redner, der offensichtlich die falsche Rede zu falschem Anlaß hielt. Zweifellos brachte er einen historisch-detaillierten Abriß der Geschehnisse des dritten Reiches, doch wirkten z.B. Worte, die ausschließlich Wortschöpfungen dieser Periode sind, wie arisch, Rassenschande, Ungeziefer, Verwesung oder Ausmerzung (die in der schriftlichen Fassung zwar durch Anführungszeichen gekennzeichnet sind, bei der vorgetragenen Rede aber wie ein gebrochenes Tabu wirken ) in einer Gedenkrede unpassend und unangebracht. Weitere Punkte, die immer wieder im Allgemeinen kritisiert worden sind, waren seine ,,nüchterne" Vortragsweise, die durch eine sehr sachlich-objektive Darstellung sowie durch die monotone Stimmlage, die jegliche Gefühlsäußerungen unterband, geprägt war, und das vordergründige Hineinversetzen in die Köpfe der Täter und das Untersuchen der Motive für die Passivität derselben anstatt das Gedenken der Opfer in das Zentrum der Rede zu stellen.
Nicht außer Acht lassen sollte man bei einer Betrachtung Jenningers Rede auch die Medien. Besonders die übertragende Fernsehanstalt, so kann man behaupten, hat die negative Wirkung der Rede forciert, indem sie ständig die ,wie erst später klar wurde, völlig erschöpfte, ermüdete Ida Ehre einblendete, die während des gesamten Redevortrags ihr Gesicht mit den Händen bedeckte. Zu einem späteren Zeitpunkt erklärte sie, sie sei nach der Rezitation von Celans Todesfuge so ergriffen gewesen, daß sie nichts von Jenningers Rede mitbekommen habe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der situative Kontext und die internalisierte Erwartungshaltung
- Zum Grundvorgang der Kommunikation
- Gestalt und Charakteristika der Gedenkrede
- Zur Vorgeschichte der Rede
- Die Erlebte Rede
- Eigenschaften und Einsatz der Erlebten Rede
- Die Erlebte Rede in der Rede Jenningers
- Die Vortragsweise
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das „Scheitern“ der Rede Philipp Jenningers anlässlich der Reichspogromnacht vom 10. November 1988. Die Zielsetzung ist es, die zentralen Gründe für das Missverständnis der Rede zu analysieren und diese im Kontext des situativen Kontextes, der Anwendung der erlebten Rede und der Vortragsweise zu beleuchten. Die Wechselwirkung dieser drei Aspekte soll aufgezeigt werden.
- Der situative Kontext und die Erwartungshaltung des Publikums
- Der Einsatz der erlebten Rede und ihre Wirkung
- Die Rolle der Vortragsweise (Intonation, Gestik, Mimik)
- Das Missverhältnis zwischen der Intention des Redners und der Rezeption des Publikums
- Die gesellschaftlichen Konventionen einer Gedenkrede und deren Verletzung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein: die Analyse der Rede Philipp Jenningers vom 10. November 1988. Sie beschreibt die anfängliche Irritation der Autorin beim Lesen eines Auszugs der Rede und wie sich ihr Verständnis erst durch das Ansehen der Videoaufzeichnung veränderte. Die Einleitung benennt die Hauptkritikpunkte an der Rede – die Verwendung von NS-Wortschöpfungen, die nüchterne Vortragsweise und die Fokussierung auf die Täter anstatt der Opfer – und kündigt die drei zentralen Aspekte der Analyse an: den situativen Kontext, den Einsatz der erlebten Rede und die Vortragsweise. Die Einleitung schließt mit einem kurzen Kommentar zur schriftlichen Fassung der Rede und ihrer Bedeutung im Kontext der deutschen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.
Der situative Kontext und die internalisierte Erwartungshaltung: Dieses Kapitel analysiert den situativen Kontext der Rede und die Erwartungshaltung des Publikums. Es beginnt mit der Feststellung, dass Kommunikation stets situationsabhängig ist und der Erfolg einer Rede von der Übereinstimmung zwischen der Intention des Senders und der Rezeption des Empfängers abhängt. Die Rede Jenningers scheiterte daran, diese Übereinstimmung herzustellen, was zu Empörung und Missverständnissen führte. Das Kapitel beleuchtet die heterogene Zusammensetzung des Publikums und die Reaktionen während der Rede (Zwischenrufe, Abgang von Abgeordneten). Es wird argumentiert, dass Jenninger gegen unausgesprochene, aber internalisierte Normen einer Gedenkrede verstieß und so vielfältige Deutungen seiner Worte hervorrief. Der Bezug auf Konventionen der Kommunikation und deren Bedeutung für wechselseitiges Verständnis wird ausführlich erläutert.
Die Erlebte Rede: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Verwendung der erlebten Rede in Jenningers Rede. Es wird die Bedeutung und Wirkung dieses Stilmittels im Kontext der Gedenkrede diskutiert, mit besonderem Fokus auf die Kritikpunkte und die von den Rezipienten wahrgenommenen Probleme. Die Analyse betrachtet, wie die erlebte Rede in der spezifischen Situation der Gedenkrede wirkt und wie sie das Verständnis des Publikums beeinflusst hat. Die ausführliche Erörterung dieses Stilmittels wird in Bezug zur Gesamtdeutung der Rede gesetzt und erklärt, warum die Anwendung der erlebten Rede in diesem Fall problematisch war.
Die Vortragsweise: Dieses Kapitel analysiert die non-verbalen Aspekte der Rede, wie Intonation, Gestik und Mimik. Es untersucht, wie die monotone Stimmlage und die nüchterne Vortragsweise die Wirkung der Rede beeinflussten und zum Missverständnis beitrugen. Die Analyse des Vortragsverhaltens wird mit Reaktionen der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht und zeigt auf, wie die visuelle Komponente – beispielsweise die Reaktion von Ida Ehre – die negative Rezeption verstärkte. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel der verbalen und nonverbalen Elemente und deren Gesamtwirkung.
Schlüsselwörter
Erlebte Rede, Philipp Jenninger, Gedenkrede, Reichspogromnacht, Kommunikation, situativer Kontext, Erwartungshaltung, Vortragsweise, Missverständnis, NS-Vergangenheit, Selbstverständnis der Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Rede Philipp Jenningers
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse untersucht das „Scheitern“ der Rede Philipp Jenningers anlässlich der Reichspogromnacht vom 10. November 1988. Es wird analysiert, warum die Rede bei vielen Zuhörern auf Missverständnis und Empörung stieß.
Welche Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Arbeit untersucht drei zentrale Aspekte: den situativen Kontext und die Erwartungshaltung des Publikums, den Einsatz der erlebten Rede und deren Wirkung, sowie die Rolle der Vortragsweise (Intonation, Gestik, Mimik). Die Wechselwirkung dieser drei Aspekte und deren Beitrag zum Missverständnis werden beleuchtet.
Wie wird der situative Kontext analysiert?
Der situative Kontext wird im Hinblick auf die heterogene Zusammensetzung des Publikums und die unausgesprochenen, aber internalisierten Normen einer Gedenkrede analysiert. Es wird gezeigt, wie Jenningers Rede gegen diese Normen verstieß und dadurch vielfältige, oft negative Deutungen hervorrief. Die Kommunikationstheorie liefert den Rahmen für die Analyse der Missverständnisse.
Welche Rolle spielt die „erlebte Rede“ in der Analyse?
Die Analyse untersucht den Einsatz der erlebten Rede in Jenningers Rede und deren Wirkung im Kontext der Gedenkrede. Es wird analysiert, wie die Verwendung dieses Stilmittels das Verständnis des Publikums beeinflusste und warum es in dieser Situation als problematisch empfunden wurde.
Wie wird die Vortragsweise bewertet?
Die Analyse betrachtet die non-verbalen Aspekte der Rede, insbesondere die monotone Stimmlage und die nüchterne Vortragsweise. Es wird untersucht, wie diese die Wirkung der Rede beeinflussten und zum Missverständnis beitrugen. Die Reaktion des Publikums (z.B. Zwischenrufe, Abgang von Abgeordneten) wird mit der Analyse des Vortragsverhaltens in Verbindung gebracht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Erlebte Rede, Philipp Jenninger, Gedenkrede, Reichspogromnacht, Kommunikation, situativer Kontext, Erwartungshaltung, Vortragsweise, Missverständnis, NS-Vergangenheit, Selbstverständnis der Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum situativen Kontext und der internalisierten Erwartungshaltung, ein Kapitel zur erlebten Rede, ein Kapitel zur Vortragsweise und ein Resümee. Jedes Kapitel beleuchtet einen Aspekt des „Scheiterns“ der Rede.
Welche Schlussfolgerung zieht die Analyse?
Die Analyse zeigt, dass das „Scheitern“ der Rede auf ein komplexes Zusammenspiel aus situativem Kontext, dem problematischen Einsatz der erlebten Rede und der monotonen Vortragsweise zurückzuführen ist. Diese Faktoren führten zu einem Missverhältnis zwischen der Intention des Redners und der Rezeption des Publikums.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Frage nach den verwendeten Quellen wird in der vorliegenden HTML-Datei nicht beantwortet. Die Quelle für die Zusammenfassung ist die bereitgestellte HTML-Datei mit dem Inhaltsverzeichnis, den Zielen, den Kapitelzusammenfassungen und den Schlüsselwörtern.
- Citation du texte
- Sandra Perrey (Auteur), 2001, Erlebte Rede in der Rede Philipp Jenningers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1857