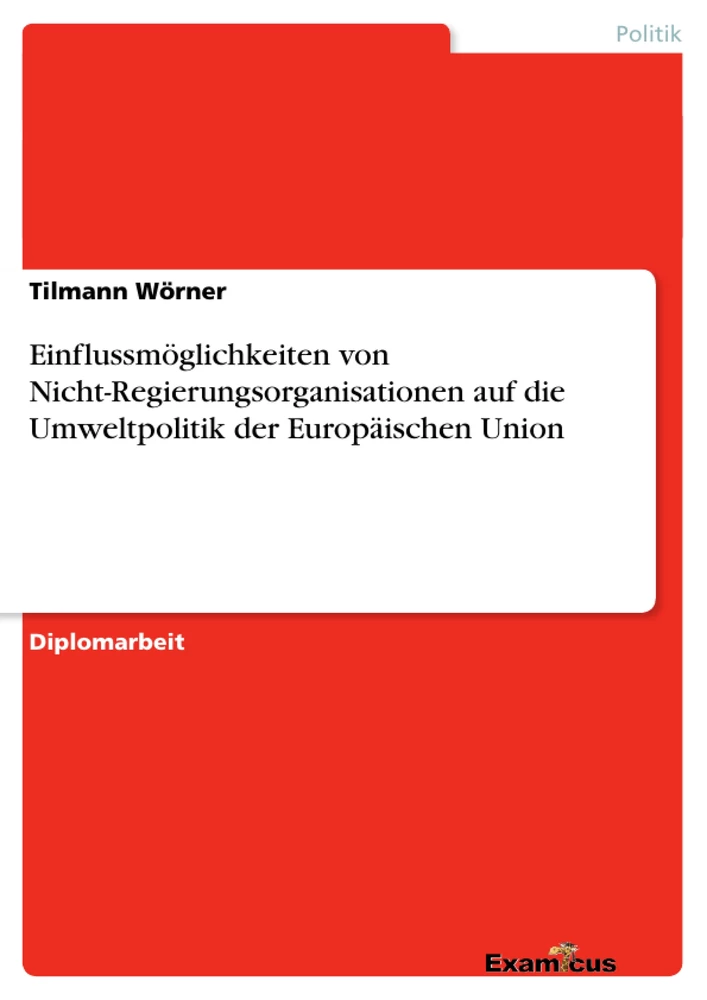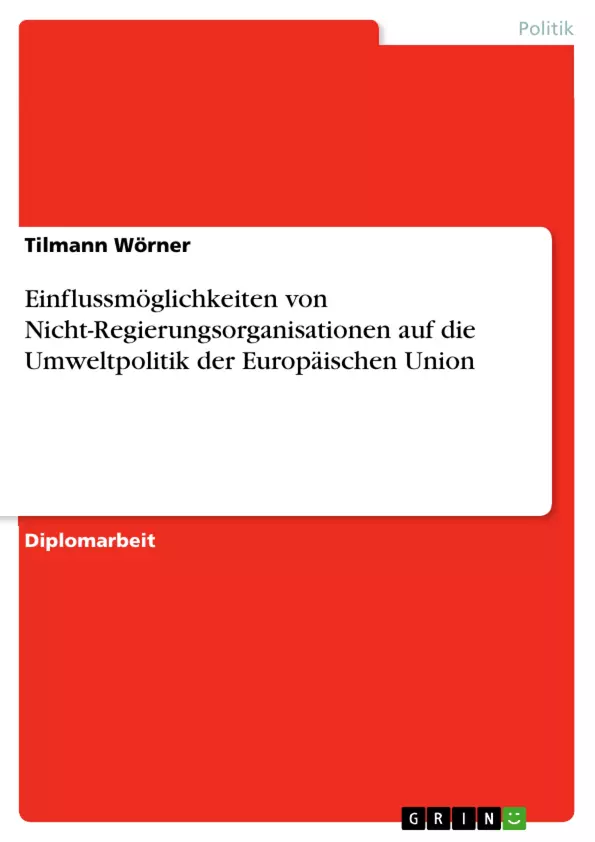Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Nicht-Regierungsorganisationen auf die Umweltpolitik der Europäischen Union. Im Mittelpunkt stehen hierbei Umweltverbände, die Lobbying bei den EU-Institutionen betreiben.
Es scheint sich sowohl bei den nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, als auch bei der jeweiligen Bevölkerung die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Umweltpolitik effizienter auf EU-Ebene betrieben werden kann.
In einer Spezialuntersuchung des Eurobarometers zum Thema Umweltpolitik wurden 1995 die Menschen in den Mitgliedsländern der Union dazu befragt, ob die Umweltpolitik eine nationale Angelegenheit ist, oder ob Umweltpolitik auf Gemeinschaftsebene praktiziert werden sollte.
Es zeigt sich, dass in allen Mitgliedsländern eine breite Mehrheit dafür ist, dass Umweltpolitik auf Ebene der EU betrieben werden sollte. Den höchsten Wert hat hierbei die Niederlande, wo über 85% der Bevölkerung dieser Meinung sind.
Auch innerhalb des politischen Systems der EU scheint die Umweltpolitik einen immer größer werdenden Stellenwert einzunehmen.
Angesichts globaler Umweltprobleme, die sich in länderübergreifenden Katastrophen widerspiegeln, scheint es erforderlich, Umweltpolitik auf supranationaler Ebene zu betreiben. Besonders das sog. „Jahrhundert-Hochwasser“ im August 2002 in Deutschland, Tschechien und Österreich vergegenwärtigt, dass bei der Lösung von Umweltproblemen länderübergreifende Maßnahmen nötig sind.
Auch wenn diese Hochwasserkatastrophe möglicherweise nicht kausal mit der Erhöhung des CO2-Anteils in der Atmosphäre zusammenhängt, so ist doch „wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch für die Erwärmung des Erdballs wesentlich verantwortlich ist“ und somit zumindest eine Ursache für die Veränderung des Weltklimas darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodische Vorgehensweise und Erkenntnisinteresse
- Die Europäische Union als Umweltunion
- Entwicklung der rechtlichen Grundlagen der Umweltpolitik
- Anfänge einer gemeinschaftlichen Umweltpolitik
- Gemeinschaftliche Umweltkompetenzen durch die EEA
- Artikel 130r, Absatz 1 und 2
- Artikel 100a
- Umweltschutzkompetenzen durch den Maastrichter Vertrag
- Umweltschutzkompetenzen durch den Vertrag von Amsterdam
- Subsidiaritätsprinzip in der Umweltpolitik
- Diskussion
- Bedeutung der EU für Umweltverbände
- Umweltverbände auf EU-Ebene
- Entwicklung der rechtlichen Grundlagen der Umweltpolitik
- Begriffsdefinitionen
- Nicht-Regierungsorganisationen
- Einflussnahme von Interessenverbänden
- Lobbying
- Begriffsdefinition Lobbying
- Lobbying als Tausch
- Lobbying bei politischen Akteuren
- Lobbying bei bürokratischen Akteuren
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Verbände im politischen Prozess
- Pluralismus
- Begriff
- Entstehung von Verbänden im Pluralismus
- Kennzeichen einer pluralistischen Interessenvermittlung
- Einbettung der Verbände ins pluralistische System
- (Neo-) Korporatismus
- Korporatismusbegriff
- Neokorporatismus
- Begriff
- Akteure
- Institutionelle Beteiligung von Verbänden beim Neokorporatismus
- Voraussetzungen für neokorporativ-verbandliche Strukturen
- Makro- und Mesokorporatismus
- Mitgliedschafts- und Einflusslogik
- Politik-Netzwerk-Konzept
- Die EU als Mehrebenen-Netzwerk
- Akteure
- Netzwerkfunktion
- Netzwerkstrukturen
- Machtverteilung
- Machtasymmetrie zwischen Umweltverbänden und anderen Verbänden
- Professionalisierung der Interessenpolitik
- Diskussion
- Offenheit der EU-Institutionen für das Lobbying von Umweltverbänden
- Die Kommission
- Kompetenzen der Kommission
- Einflussmöglichkeiten von NGO's auf die Kommission
- Lobbying-Verständnis der Europäischen Kommission
- Taktiken der Kommission in der Umweltpolitik
- Rat der Europäischen Union („Ministerrat")
- Kompetenzen des Rats der Europäischen Union
- Bedeutung des Rats der Europäischen Union für das Lobbying
- Europäisches Parlament
- Kompetenzen des Europäischen Parlamentes
- Bedeutung des EP's für die Einflussnahme von NGO's
- Lobbying-Verständnis des Europäischen Parlaments
- Europäischer Rat
- Ausschusswesen in der EU
- Ausschüsse des Rates
- Ausschüsse der Kommission
- Wirtschafts- und Sozialausschuss
- Europäischer Gerichtshof EuGH
- Gesetzgebungsverfahren
- Initiations- und Vorbereitungsphase
- Entscheidungsphase
- Implementationsphase
- Diskussion
- Die Kommission
- Determinanten der Zusammenarbeit von Umweltverbände
- Dachverbandsdilemma beim EEB
- Unterschiedliche Zielsetzung und Strukturen der Umweltverbände
- Unterschiedliche Politikstile
- Unterschiedlicher ideologischer Hintergrund der Umweltverbände
- Selbstverständnis der Umweltverbände
- Zusammenarbeit zwischen den Umweltverbänden
- Diskussion
- Organisationsfähigkeit und Interessenaggregation
- Theorie des kollektiven Handelns
- Kritik an Olsons Theorie
- Bereitschaft der Individuen zur Unterstützung eines Umweltverbandes
- Unterstützung der Umweltverbände durch EU-Bürger
- Anwendung der Theorie Olsons auf das Verhalten innerhalb der Umweltverbände
- Diskussion
- Fallbeispiel
Flora-Fauna-Habitatschutzrichtlinie
- Motivation der FFH-Richtlinie
- Entstehungsprozess der FFH-Richtlinie
- Umsetzung der Richtlinie
- Bewertung der FFH-Richtlinie
- Umweltverbände in der verbandstheoretischen Sicht
- Anzeichen für Pluralismus
- Anzeichen für (Neo-) Korporatismus
- Diskussion
- Resumee und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Einflussmöglichkeiten von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) auf die Umweltpolitik der Europäischen Union. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen der EU-Umweltpolitik, die Bedeutung der EU für Umweltverbände und die Rolle von NGOs im politischen Prozess. Die Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, wie z.B. Pluralismus und (Neo-) Korporatismus, um die Funktionsweise von NGOs im EU-System zu erklären. Darüber hinaus werden die Offenheit der EU-Institutionen für Lobbying von Umweltverbänden, die Determinanten der Zusammenarbeit zwischen NGOs sowie die Organisationsfähigkeit und Interessenaggregation von Umweltverbänden untersucht.
- Rechtliche Grundlagen der EU-Umweltpolitik
- Rolle von NGOs im politischen Prozess
- Einflussmöglichkeiten von NGOs auf die EU-Umweltpolitik
- Zusammenarbeit zwischen Umweltverbänden
- Organisationsfähigkeit und Interessenaggregation von Umweltverbänden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die methodische Vorgehensweise sowie das Erkenntnisinteresse. Kapitel 1 beleuchtet die Europäische Union als Umweltunion und analysiert die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen der Umweltpolitik. Es werden die verschiedenen Verträge und Artikel betrachtet, die die Umweltpolitik der EU prägen, sowie das Subsidiaritätsprinzip in der Umweltpolitik. Kapitel 2 definiert die Begriffe Nicht-Regierungsorganisationen, Einflussnahme von Interessenverbänden und Lobbying. Es werden verschiedene Formen des Lobbyings und die Rolle von Lobbying bei politischen und bürokratischen Akteuren erläutert.
Kapitel 3 stellt den theoretischen Bezugsrahmen der Arbeit vor. Es werden verschiedene Theorien, wie z.B. Pluralismus, (Neo-) Korporatismus, Mitgliedschafts- und Einflusslogik sowie das Politik-Netzwerk-Konzept, vorgestellt und auf die Rolle von NGOs im EU-System angewendet. Kapitel 4 untersucht die Offenheit der EU-Institutionen für das Lobbying von Umweltverbänden. Es werden die Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten von NGOs auf die verschiedenen EU-Institutionen, wie z.B. die Kommission, den Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament und den Europäischen Rat, analysiert. Kapitel 5 befasst sich mit den Determinanten der Zusammenarbeit von Umweltverbänden. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen NGOs, wie z.B. das Dachverbandsdilemma, unterschiedliche Zielsetzungen und Strukturen sowie unterschiedliche Politikstile und ideologischer Hintergrund, beleuchtet.
Kapitel 6 analysiert die Organisationsfähigkeit und Interessenaggregation von Umweltverbänden. Es wird die Theorie des kollektiven Handelns von Mancur Olson vorgestellt und auf die Bereitschaft von Individuen zur Unterstützung von Umweltverbänden angewendet. Kapitel 7 stellt die Flora-Fauna-Habitatschutzrichtlinie als Fallbeispiel vor und analysiert die Motivation, den Entstehungsprozess, die Umsetzung und die Bewertung der Richtlinie. Kapitel 8 untersucht die Umweltverbände in der verbandstheoretischen Sicht und analysiert, inwieweit die Umweltverbände Anzeichen für Pluralismus oder (Neo-) Korporatismus aufweisen. Das Resumee und der Ausblick fassen die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Einflussmöglichkeiten von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) auf die Umweltpolitik der Europäischen Union, die rechtlichen Grundlagen der EU-Umweltpolitik, die Rolle von NGOs im politischen Prozess, Pluralismus, (Neo-) Korporatismus, Lobbying, Interessenaggregation, Organisationsfähigkeit, Zusammenarbeit von Umweltverbänden und die Flora-Fauna-Habitatschutzrichtlinie.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben NGOs auf die EU-Umweltpolitik?
NGOs beeinflussen die Politik durch Lobbying bei EU-Institutionen, Teilnahme an Netzwerken und die Bereitstellung von Expertenwissen in Ausschüssen.
Was ist das „Dachverbandsdilemma“ beim EEB?
Es beschreibt die Schwierigkeit von Dachverbänden wie dem European Environmental Bureau, die oft unterschiedlichen Interessen und Ideologien ihrer Mitgliedsorganisationen zu bündeln.
Welche EU-Institution ist am offensten für Lobbying durch Umweltverbände?
Sowohl die Europäische Kommission (als Initiatorin von Gesetzen) als auch das Europäische Parlament gelten als wichtige Ansprechpartner für NGOs.
Was besagt die Theorie des kollektiven Handelns von Mancur Olson?
Die Theorie erklärt, warum es für große Gruppen (wie Umweltschützer) schwierig ist, sich zu organisieren, da Einzelne oft als Trittbrettfahrer agieren.
Was ist die Flora-Fauna-Habitatschutzrichtlinie (FFH)?
Die FFH-Richtlinie dient als Fallbeispiel in der Arbeit, um den Entstehungsprozess und die Einflussnahme von Verbänden auf konkrete EU-Naturschutzvorgaben zu zeigen.
- Arbeit zitieren
- Tilmann Wörner (Autor:in), 2003, Einflussmöglichkeiten von Nicht-Regierungsorganisationen auf die Umweltpolitik der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185828